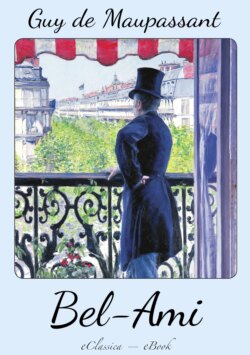Читать книгу Guy de Maupassant: Bel Ami (Deutsche Ausgabe) - Guy de Maupassant - Страница 5
III.
ОглавлениеGeorges Duroy befand sich wieder auf der Straße und überlegte, was er tun sollte. Er hatte Lust zu laufen, zu träumen, immerfort zu gehen, an seine Zukunft zu denken und die milde Nachtluft einzuatmen; doch der Gedanke an die Artikelserie, die Vater Walter bestellt hatte, gab ihm keine Ruhe, und er beschloss, sofort nach Hause zu gehen und sich an die Arbeit zu setzen. Mit eiligen Schritten ging er weiter, erreichte den äußeren Boulevard und gelangte endlich in die Rue Boursault, wo er wohnte. Seine Wohnung befand sich in einem sechsstöckigen Haus, das von etwa zwanzig Arbeiter- und Kleinbürgerfamilien bevölkert war. Er stieg die Treppe hinauf und beleuchtete mit Wachsstreichhölzern die schmutzigen Stufen, auf denen Papierfetzen, Zigarrenstummel und Küchenabfälle herumlagen. Er empfand ein widerwärtiges Gefühl und einen Drang, so rasch als möglich von hier fortzukommen und so zu wohnen, wie es die reichen Leute tun, in sauberen Wohnungen mit schönen Teppichen. Ein schwerer Geruch von Speiseresten, Unrat und unsauberer Menschlichkeit, ein stagnierender Duft von Fett und Mauern, den kein frischer Luftzug vertreiben konnte, erfüllte das Haus von oben bis unten.
Das Zimmer des jungen Mannes lag im fünften Stock und ging wie auf einen tiefen Abgrund, auf den weiten Einschnitt der Westbahn, gerade oberhalb der Tunneleinfahrt, vor dem Bahnhof Batignolles, hinaus. Duroy öffnete das Fenster und lehnte sich auf das verrostete, eiserne Fensterbrett.
Unter ihm glühten in der Tiefe der finsteren Wölbung drei rote, unbewegliche Signallaternen wie große, feurige Raubtieraugen, und weiter, immer weiter, sah er immer noch andere Lichter. Fortwährend gellten lange und kurze Pfiffe durch die Nacht, die einen nahe, die andern kaum hörbar in der Richtung nach Asnieres. Sie klangen wie menschliche, rufende Stimmen. Einer kam näher und näher, sein klagender Ton klang von Sekunde zu Sekunde lauter; plötzlich blitzte ein großes gelbes Licht auf, das lärmend dahinrollte, und Duroy sah die lange Wagenreihe in der Tunnelmündung verschwinden.
Dann sagte er zu sich: »Also an die Arbeit«, und stellte das Licht auf den Tisch. Doch wie er sich hinsetzen wollte, um zu schreiben, bemerkte er erst, dass er nur eine Schachtel Briefpapier hatte.
»Das ist kein Unglück«, er half sich, indem er die Bogen auseinanderfaltete und sie in ihrer ganzen Größe benutzte. Er tauchte die Feder in die Tinte und schrieb mit seiner schönen Handschrift auf den Kopf des ersten Bogens die Worte:
›Erinnerungen eines afrikanischen Jägers.‹
Dann suchte er nach dem Anfang des ersten Satzes. Er saß, den Kopf auf die Hände gestützt, die Augen auf das weiße Papier gerichtet, das sich vor ihm ausbreitete. Was sollte er schreiben? Er fand absolut nichts von dem wieder, was er kurz vorher erzählt hatte, keine Anekdote, keine einzige Tatsache, nichts. Plötzlich fiel ihm ein: »Ich muss mit meiner Abreise aus der Heimat beginnen.« Und er schrieb: »Es war ungefähr am 15. Mai des Jahres 1874, als das erschöpfte Frankreich sich von den Schicksalsschlägen der schrecklichen Kriegsjahre erholte.«
Dann stockte er wieder, er wusste nicht, wie er nun das Folgende schildern sollte, seine Einschiffung, die Reise, seine ersten Eindrücke ... Nachdem er zehn Minuten gegrübelt hatte, beschloss er, diesen einleitenden Teil auf den nächsten Morgen zu verschieben und einstweilen mit der Beschreibung von Algier zu beginnen.
Und er schrieb auf sein Papier:
»Algier ist eine ganz weiße Stadt...«, da blieb er wieder stecken. Er sah in Gedanken die hübsche, helle Stadt vor sich, die sich von der Höhe des Gebirges bis zum Meer hinunterzog, wie eine Kaskade von niedrigen Häusern mit flachen Dächern. Aber er fand keinen Ausdruck für das, was er gesehen und empfunden hatte.
Mit vieler Mühe und Anstrengung schrieb er weiter: »Sie ist zum Teil von Arabern bewohnt...« Dann warf er seine Feder auf den Tisch und stand auf. Auf seinem schmalen, eisernen Bett, in das sein Körper ein Loch eingedrückt hatte, sah er seine Werktagskleider herumliegen, schäbig, abgerissen, wie Lumpen aus der Morgue. Auf dem Strohstuhl stand sein Seidenzylinder, der einzige Hut, den er besaß, und schien hilfsbedürftig mit der Öffnung nach oben um ein Almosen zu bitten.
Die graue Tapete mit blauen Blumensträußen hatte ebensoviel Schmutz als Blumen, alte, verdächtig aussehende Flecke unbestimmter Herkunft, totgedrückte Insekten und Ölkleckse, fettige Fingerabdrücke und Seifenschaumspuren, die während des Waschens angespritzt waren. Das alles roch nach dem nacktesten Elend, nach dem Elend eines möblierten Zimmers. Und eine Erbitterung ergriff ihn gegen die Armseligkeit seines bisherigen Lebens. Er sagte sich, dass er sofort schon morgen aus ihr hinaus müsste, um endlich diesem kümmerlichen Dasein ein Ende zu machen.
Plötzlich überkam ihn ein neuer Arbeitseifer, er setzte sich wieder an den Tisch und suchte wieder nach Worten, um den eigenartigen und reizvollen Eindruck von Algier zu schildern, dieses Eingangstor in das geheimnisvolle und tiefe Afrika, in das Land umherstreifender Araber und unbekannter Negerstämme, in das unerforschte und verlockende Afrika, dessen unwahrscheinliche Tierwelt uns bisweilen in den öffentlichen Gärten gezeigt wird; ganz merkwürdige Tiere, wie aus dem Märchenland: Strauße, Riesenhühner, Gazellen, prächtige Ziegen, groteske Giraffen, schwere, ernste Kamele, ungeheuerliche Nilpferde, plumpe Rhinozerosse und Gorillas, diese seltsamen Ebenbilder der Menschen.
Unbestimmte Gedanken schweiften in seinem Kopf; er hätte sie vielleicht erzählen können, aber er vermochte sie nicht in geschriebene Sätze zu fassen. Seine Ohnmacht erregte ihn fieberhaft, er sprang wieder auf, seine Hände schwitzten und das Blut hämmerte in den Schläfen.
Seine Blicke fielen auf die Rechnung der Waschfrau, die der Concierge ihm heraufgebracht hatte, und von Neuem überfiel ihn eine grenzenlose Verzweiflung. Seine Freude war im Augenblick dahin und mit ihr sein Selbstvertrauen und die Hoffnung auf seine Zukunft. Es war aus — alles aus; er würde es zu nichts bringen und würde nichts werden. Er fühlte sich leer, unfähig, unnütz und verdammt. Er trat an das Fenster und blickte hinunter. Ein Zug kam mit tosendem Lärm aus dem Tunnel heraus, um über Felder und Ebenen nach der Meeresküste zu fahren. Und Erinnerung an seine Eltern erfüllte das Herz Duroys.
Dieser Zug würde nur wenige Meilen von ihrem Haus vorbeifahren. Er sah es wieder, dieses kleine Häuschen am Eingang des Dorfes Canteleu, oben auf dem Abhang, der Rouen und das weite Tal der Seine beherrschte. Sein Vater und seine Mutter hatten eine kleine Schenke, ein Wirtshaus, wo die Einwohner des kleinen Vororts Sonntags zu frühstücken pflegten. Es hieß ›Zur schönen Aussicht‹. Sie hatten aus ihrem Sohn einen ›Herrn‹ machen wollen und schickten ihn aufs Gymnasium. Nach Beendigung seiner Studienzeit fiel er beim Examen durch und hatte sich zum Militärdienst gemeldet, in der Absicht, Offizier, Oberst, General zu werden. Doch das Soldatenleben hatte ihn nicht befriedigt, und so war er, ehe er seine fünf Jahre Dienstzeit absolviert hatte, nach Paris gegangen, um dort sein Glück zu machen.
So war er hierher gekommen trotz der Bitten seiner Eltern, die ihn, als sie den Fehlschlag ihrer Hoffnungen einsahen, bei sich behalten wollten. Er seinerseits hoffte auf die Zukunft; der Erfolg musste kommen, er wusste nur nicht wie, aber er würde Mittel und Wege finden, ihn an sich zu reißen.
Schon im Regiment hatte er immer Glück bei Frauen gehabt und hatte in besseren Kreisen ein paar Abenteuer gehabt. Er hatte die Tochter des Steuereinnehmers verführt, die alles im Stich lassen wollte, um ihm zu folgen, und dann die Frau eines Anwalts, die, als er sie verlassen hatte, sich aus Verzweiflung zu ertränken versuchte.
Seine Kameraden nannten ihn einen Schlaukopf, einen Racker, der klug genug sei, sich aus der Klemme zu ziehen, und er hatte sich fest vorgenommen, dieser Kritik Ehre zu machen.
Sein angeborenes, normannisches Gewissen war durch die tägliche Praxis des Soldatenlebens, durch die Beispiele von Räubereien in Afrika, von unerlaubtem Missbrauch, von bedenklichen Prellereien abgestumpft und elastisch geworden; außerdem war er überreizt von den in der Armee geltenden Ehrbegriffen, von den quasi heroischen Taten, von denen die Unteroffiziere unter sich zu erzählen wissen und von dem ganzen Ruhmesglanz des Soldatenlebens, sodass sein Gewissen zu einer Art Kiste mit dreifachem Boden wurde, wo alles Mögliche zu finden war.
Doch der Drang, Karriere zu machen, beherrschte alles andere.
Ohne dessen bewusst zu sein, war er wieder in Träumereien versunken, wie das allabendlich geschah. Er träumte von einem Liebesabenteuer, das ihm mit einem Schlag die Erfüllung aller seiner Hoffnungen bringen sollte. Er würde die Tochter eines Bankiers oder eines vornehmen großen Herrn heiraten, nachdem er sie auf der Straße getroffen und auf den ersten Blick erobert hätte.
Der schneidende Pfiff einer einzelnen Lokomotive, die ganz allein, wie ein großes Kaninchen aus seinem Bau, aus dem Tunnel hervorkam und mit vollem Dampf über die Schienen nach dem Maschinenschuppen lief, erweckte ihn aus seinen Träumen. Die etwas verwirrten Gedanken an diese frohen Hoffnungen, die sein ganzes Innere erfüllten, hatten ihn erfrischt, und er warf einen Kuss in die Nacht hinaus, einen Liebesgruß an das Bild der ersehnten Frau, einen Kuss des Verlangens nach dem Glück, das er begehrte. Dann schloss er das Fenster und begann sich auszukleiden, wobei er murmelte: »Ach was, morgen früh werde ich besser aufgelegt sein. Heute Abend ist mein Kopf zu schwer, vielleicht habe ich auch ein bisschen zuviel getrunken. Unter solchen Bedingungen kann man nicht gut arbeiten.« Er legte sich zu Bett, blies die Lampe aus und schlief fast unmittelbar danach ein.
Er wachte frühzeitig auf, wie man an Tagen lebhafter Hoffnungen oder großer Sorgen aufwacht, sprang aus dem Bett und öffnete das Fenster, um einen Schluck frischer Luft zu nehmen, wie er zu sagen pflegte.
Die Häuser in der Rue de Rome gerade gegenüber, jenseits des breiten Eisenbahndammes, leuchteten im hellen Schein der Morgensonne, als wären sie mit Licht weiß gemalt. Rechts in der Ferne sah er den Hügel von Argenteuil, die Höhen von Sannois und die Mühlen von Orgemont in leichtem, bläulichem Dunst, wie hinter einem dünnen, durchsichtigen Schleier, der auf den Horizont geworfen war.
Ein paar Minuten blieb Duroy in der Betrachtung der weiten Landschaft versunken und murmelte: »Es wäre doch verdammt schön da draußen an einem solchen Tag wie diesem.« Dann fiel ihm ein, dass er arbeiten müsste, und zwar sofort, und dass er für zehn Sous den Jungen des Concierge zu seinem Bureau schicken müsste, um sich krank zu melden. Er setzte sich an den Tisch, tauchte die Feder in das Tintenfass, stützte den Kopf mit der Hand und suchte nach Einfällen. Alles vergebens. Nichts fiel ihm ein.
Trotzdem verlor er nicht den Mut. Er dachte: »Es ist nicht so schlimm, ich bin eben nicht daran gewöhnt. Das ist ein Handwerk, das man wie jedes andere lernen muss. Die ersten paarmal muss ich mir helfen lassen. Ich werde Forestier aufsuchen, und er macht mir meinen Artikel in zehn Minuten zurecht.
Er zog sich an.
Als er auf der Straße war, dachte er, dass es wohl noch zu früh sei, sich schon seinem Freund vorzustellen, denn er pflegte lange zu schlafen. Er ging langsam unter den Bäumen der äußeren Boulevards auf und ab.
Es war noch nicht neun Uhr. Er erreichte den Park Monceau, der vom frischen Tau noch ganz feucht war. Er setzte sich auf eine Bank und begann wieder zu träumen. Ein sehr eleganter, junger Mann ging vor ihm auf und ab, offenbar in Erwartung einer Frau.
Endlich kam sie, verschleiert, mit hastigen Schritten, und nach einem kurzen Händedruck nahm er sie beim Arm und verschwand.
Ein stürmischer Trieb nach Liebe schoss durch Duroys Herz, ein heißes Verlangen nach einem vornehmen, parfümierten, zarten Liebesabenteuer. Er stand auf, setzte seinen Weg fort und dachte dabei an Forestier. Hatte der Glück gehabt!
An der Haustür traf er mit Forestier zusammen, der gerade fortgehen wollte: »Du hier? So früh? Was willst du denn?«
Duroy war verlegen, dass er ihn gerade beim Aufbruch störte und stotterte: »Es... es ... es handelt sich um meinen Artikel, ich kann ihn nicht fertigbringen, weißt du, den Artikel, den Herr Walter über Algier haben will. Es ist eigentlich kein Wunder, weil ich doch bisher noch nie geschrieben habe. Hier, wie bei allem, ist Übung nötig. Ich weiß ganz genau, ich werde mich sehr leicht hineinfinden, aber jetzt beim ersten Mal weiß ich nicht recht, wie ich es anfassen soll. Ich habe wohl die Ideen, die sind alle da, aber es gelingt mir nicht, sie zum Ausdruck zu bringen.«
Er hielt inne und zauderte ein wenig. Forestier lächelte listig und sagte:
»Das kenne ich.«
»Ja«, fuhr Duroy fort, »so muss es am Anfang jedem gehen. Ich wollte also ... ich wollte dich daher bitten, mir eine kleine Anleitung zu geben. In zehn Minuten würdest du es mir schon zurechtmachen, mir den nötigen Schwung beibringen. Du würdest mir da eine gute Lektion im Stil geben, denn ohne dich, glaube ich, bringe ich es nicht fertig.«
Der andere lächelte noch immer vergnügt. Er klopfte seinem alten Kameraden auf den Arm und sagte:
»Geh zu meiner Frau hinauf, sie wird die Sache ebensogut in Ordnung bringen wie ich. Ich habe ihr diese Arbeiten beigebracht. Ich habe leider heute früh keine Zeit, sonst hätte ich es ja gern getan.«
Duroy wurde plötzlich wieder verlegen, er zögerte und getraute sich nicht.
»Aber jetzt zu dieser Zeit kann ich sie unmöglich stören?«
»Doch, sicher kannst du das. Sie ist auf. Du findest sie in meinem Arbeitszimmer, sie hat einige Schriftstücke für mich zu ordnen.«
Duroy weigerte sich noch immer, hinaufzugehen.
»Nein ... das geht nicht!«
Forestier packte ihn bei der Schulter, drehte ihn herum und schob ihn die Treppe hinauf: »Also, geh doch, dummes Schaf, wenn ich es dir sage. Du wirst mich nicht etwa zwingen wollen, die drei Treppen wieder hinaufzuklettern, dich vorzustellen und deine Sache auseinanderzusetzen.«
Da entschloss sich endlich Duroy. »Danke, ich gehe, ich werde ihr sagen, dass ich auf deine Veranlassung komme, dass du mich gezwungen hast, sie aufzusuchen.«
»Gut. Sei unbesorgt, sie frisst dich nicht auf. Aber vergiss nicht nachher um drei Uhr.«
»Oh, hab keine Angst.«
Forestier ging schnell davon, während Duroy langsam Stufe für Stufe die Treppe hinaufstieg, denn er wusste nicht recht, was er oben sagen sollte, und war nicht sicher, wie er empfangen würde.
Der Diener öffnete; er trug eine blaue Schürze und hielt einen Besen in der Hand.
»Der Herr ist ausgegangen«, sagte er, ohne eine Frage abzuwarten.
Duroy ließ sich nicht abweisen.
»Fragen Sie Madame Forestier, ob sie mich empfangen könnte, und sagen Sie ihr, dass ich im Auftrag ihres Gatten käme, den ich eben auf der Straße getroffen habe.«
Dann wartete er. Der Diener kam zurück, öffnete rechts eine Tür und meldete: »Madame lässt bitten.«
Sie saß auf einem Schreibtischsessel in einem kleinen Zimmer, dessen Wände durch schwarze Bücherregale mit wohlgeordneten Büchern gänzlich verdeckt waren. Nur die Einbände mit ihren bunten Farben, rot, blau, gelb, grün und violett, brachten Frohsinn in diese einförmigen Bücherreihen.
Bekleidet mit einem weißen, spitzenbedeckten Morgenkleid, wandte sie sich ihm lächelnd zu, und als sie ihm die Hand reichte, sah er unter dem weit geöffneten Ärmel ihren nackten Arm.
»So früh?« fragte sie, fügte aber hinzu: »Das soll durchaus kein Vorwurf sein, sondern bloß eine harmlose Frage.«
Er stammelte:
»Oh, Madame, ich wollte gar nicht heraufkommen. Doch ich traf unten Ihren Herrn Gemahl, er zwang mich dazu. Ich bin dermaßen verwirrt, dass ich nicht zu sagen wage, was mich eigentlich herführt.«
Sie wies auf einen Stuhl:
»Setzen Sie sich hin und sprechen Sie.«
Sie hielt zwischen den Fingern eine Gänsefeder, die sie geschickt herumdrehte, und vor ihr lag ein halb beschriebener Bogen Papier. Die Ankunft des jungen Mannes hatte offenbar ihre Arbeit unterbrochen. Es machte ganz den Eindruck, als fühlte sie sich an diesem Schreibtisch genau so zu Hause wie in ihrem Salon, als ob dieses ihr alltäglicher Beruf wäre.
Ein leichtes Parfüm entstieg dem Morgenrock, der frische Duft der eben beendeten Toilette. Und Duroy suchte den jungen, weißen, warmen Frauenkörper durch die Falten des weichen Stoffes zu erraten. Da er noch immer schwieg, fuhr sie fort:
»Also sagen Sie, was gibt es?«
Zögernd murmelte er:
»Also ... aber wirklich ... ich wage es gar nicht zu sagen ... Ich habe gestern bis spät in die Nacht gearbeitet ... und heute früh ... sehr früh morgens ... um den Artikel über Algier zu schreiben, den Herr Walter von mir haben will ... Es will mir nicht gelingen ... ich habe alles zerrissen ... Ich habe keine Übung in dieser Arbeit und da wollte ich Forestier bitten, mir etwas zu helfen ... für dieses eine Mal ...«
Sie unterbrach ihn und lachte glücklich und geschmeichelt aus vollem Herzen:
»Und da hat er Ihnen gesagt, Sie sollten mich aufsuchen? Das war lieb von ihm!« ...
»Ja, gnädige Frau, er sagte, Sie würden mir aus der Verlegenheit noch besser helfen, als er selbst ... Aber trotzdem wagte ich es nicht, ich wollte nicht ... Nicht wahr, Sie verstehen mich ...«
Sie stand auf.
»Das wird reizend sein, so mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Ich bin begeistert von Ihrer Idee. Also setzen Sie sich hier auf meinen Platz, denn bei der Redaktion kennt man meine Handschrift. Nun wollen wir Ihnen einen Artikel schreiben, aber einen guten, der auch Erfolg haben wird.«
Er setzte sich, nahm eine Feder, breitete ein Blatt Papier vor sich aus und wartete.
Madame Forestier sah seinen Vorbereitungen stehend zu, dann nahm sie vom Kamin eine Zigarette und zündete sie an:
»Ich kann nicht arbeiten, ohne zu rauchen. Also, was wollten Sie erzählen?«
Er blickte erstaunt zu ihr auf.
»Das weiß ich eben nicht, deswegen bin ich auch hergekommen.«
Sie fuhr fort:
»Ja, ich werde Ihnen dabei schon helfen. Die Sauce will ich Ihnen machen, Sie müssen mir aber den Braten geben.«
Er blieb verwirrt, endlich sagte er zögernd:
»Ich wollte meine Reise von Anfang an schildern ...«
Da setzte sie sich ihm gegenüber an die andere Seite des großen Schreibtisches und sagte, ihm in die Augen blickend:
»Nun gut, erzählen Sie mir zuerst, mir ganz allein, verstehen Sie, langsam und ohne etwas zu vergessen. Ich werde dann schon das Passende auswählen.«
Er wusste aber nicht, wo er anfangen sollte, und so begann sie, ihn auszufragen, wie ein Priester sein Beichtkind. Sie legte ihm ganz bestimmte Fragen vor, durch die ihm eine Menge vergessener Eindrücke, flüchtig bekannte Personen und verschiedene Einzelheiten ins Gedächtnis zurückgerufen wurden. Als sie ihn etwa eine Viertelstunde auf solche Weise ausgefragt hatte, unterbrach sie ihn plötzlich:
»Jetzt wollen wir beginnen. Zunächst nehmen wir an, Sie berichten Ihrem Freund Ihre Erlebnisse. Das erlaubt Ihnen, eine Menge Bosheiten zu sagen, Bemerkungen aller Art einzuflechten, und so natürlich und witzig zu sein, wie wir es irgend können. Also los:
›Mein lieber Henri, Du willst wissen, was Algier ist, Du sollst es erfahren. Da ich in der kleinen Hütte aus getrocknetem Lehm, die mir als Wohnung dient, nichts Besseres anzufangen weiß, will ich Dir eine Art Tagebuch über mein Leben schicken und Dir schildern, wie mein Leben sich Tag für Tag, Stunde für Stunde gestaltet ... Es wird manchmal etwas toll darin zugehen, einerlei: Du bist doch nicht verpflichtet, es den Damen aus Deinem Bekanntenkreise vorzuzeigen.‹«
Sie machte eine Pause, um die ausgegangene Zigarette wieder anzuzünden, und sofort hörte das kritzelnde Geräusch der Gänsefeder auf dem Papier auf.
»Nun weiter!« sagte sie.
›Algier ist eine ausgedehnte französische Besitzung an der Grenze der großen unbekannten Länder, die man die Wüste, die Sahara, Zentralafrika und so weiter nennt.
Algier ist das Tor, das weiße, bezaubernde Eingangstor dieses seltsamen Kontinents.
Aber zunächst muss man dieses Land erreichen und das ist nicht für jedermann so besonders angenehm. Du weißt, ich bin ein ausgezeichneter Reiter, denn ich muss ja die Pferde des Obersten zureiten. Aber man kann ein guter Reiter und dabei ein schlechter Seemann sein. Das ist bei mir der Fall.
Entsinnst Du Dich noch des Majors Simbreta, den wir den Doktor Ipéca nannten? Wenn wir uns reif für vierundzwanzig Stunden Lazarett fühlten, so besuchten wir ihn.
Er saß auf seinem Stuhl, die dicken Beine in den roten Hosen weit auseinander gespreizt, die Hände auf die Knie gestützt, die Ellenbogen in der Luft, sodass die Arme wie eine Brücke aussahen. Er rollte seine großen Augen und knabberte dabei an seinem weißen Schnurrbart. Entsinnst Du Dich noch seiner Verordnung?
‘Dieser Soldat hat einen verdorbenen Magen. Er bekommt das Brechmittel Nummer 3 nach meinem Rezept. Dann zwölf Stunden Ruhe und er ist wieder gesund.’
Dieses Brechmittel war allmächtig und unwiderstehlich. Man schluckte es runter, weil man es halt musste. Hatte man die Kur des Doktor Ipéca überstanden, dann genoss man zwölf Stunden teuer erkaufter Ruhe.
Nun, mein lieber Freund, um nach Afrika zu gelangen, muss man ein anderes, nicht minder unwiderstehliches Mittel nehmen, und zwar nach dem Rezept der Transatlantischen Dampfergesellschaft.‹«
Sie rieb sich die Hände, höchst zufrieden mit ihrem Einfall.
Dann stand sie auf, ging im Zimmer auf und ab, steckte sich eine neue Zigarette an und diktierte weiter. Sie blies den Rauch vor sich hin, der zuerst aus dem kleinen runden Loch zwischen ihren zusammengepressten Lippen kerzengerade emporstieg, dann wurden die Rauchringe immer breiter und verflüchtigten sich in der Luft als graue, durchsichtige Nebelstreifen, ähnlich einem Spinngewebe. Bisweilen zerstörte sie die leichten, übriggebliebenen Streifen mit einer schnellen Bewegung der flachen Hand, bisweilen durchschnitt sie dieselben langsam mit dem Zeigefinger und sah dann nachdenklich zu, wie die beiden Hälften allmählich verschwanden.
Duroy verfolgte jede ihrer Bewegungen, jede Stellung ihres Körpers, jede Veränderung in ihrem Gesichtsausdruck, die dies mechanische, gedankenlose Spiel bei ihr hervorrief.
Sie erfand jetzt Reiseerlebnisse, schilderte selbst erfundene Reisegefährten und entwarf eine Liebesgeschichte mit der Frau eines Infanteriehauptmanns, die ihrem Manne nachreiste.
Dann setzte sie sich wieder und fragte Duroy über die Bodenverhältnisse von Algier aus, von denen sie keine Ahnung hatte. Und in zehn Minuten wusste sie genau soviel wie er und machte daraus ein kleines Kapitel über politische und koloniale Geographie, um den Leser einzuführen und auf das Verständnis ernster Fragen vorzubereiten, die im folgenden Artikel behandelt würden.
Dann flocht sie eine Erzählung über einen frei erfundenen Ausflug nach der Provinz Oran ein, bei dem es sich vor allem um Frauen handelte, um Maurenmädchen, Jüdinnen und Spanierinnen.
»Das ist das einzige, was wirklich die Leute interessiert«, meinte sie.
Sie schloss mit einem Aufenthalt in Saida, am Fuß der Hochebene, und einem hübschen kleinen Liebesabenteuer zwischen dem Unteroffizier George Duroy und einer spanischen Arbeiterin, die in einer Spartograsflechterei in Ain-el-Hadjar beschäftigt war. Frau Forestier erzählte von dem nächtlichen Stelldichein in dem steinigen, kahlen Gebirge, wo inmitten von Felsblöcken Schakale, Hyänen und arabische Hunde heulten, schrien und bellten.
Und fröhlich sagte sie nun:
»Fortsetzung folgt!«
Dann stand sie auf.
»Sehen Sie, Lieber Herr Duroy, so schreibt man Artikel. Jetzt unterschreiben Sie bitte.«
Er zögerte.
»Schreiben Sie doch Ihren Namen.«
Da begann er zu lachen und schrieb unten auf den Rand der letzten Seite: ›Georges Duroy.‹
Sie rauchte und ging auf und ab; er betrachtete sie immerzu. Er fand keine Worte, um ihr zu danken. Er war glücklich, in ihrer Nähe zu sein; erfüllt von Dankbarkeit, genoss er das sinnliche Glück ihrer wachsenden Vertraulichkeit. Ihm war, als ob alles, was sie umgab, ein Teil ihrer selbst war, alles bis zu den bücherbedeckten Wänden. Die Stühle, die Möbel, die von Tabak durchtränkte Luft. Alles besaß etwas Eigenartiges, Reizendes, das von ihr kam.
Plötzlich fragte sie ihn:
»Was halten Sie von meiner Freundin, der Madame de Marelle?«
Er war überrascht.
»Nun ja, ich finde ... ich finde sie entzückend.«
»Nicht wahr?«
»Ja gewiss.«
Er wollte hinzufügen: »Aber doch nicht so entzückend wie Sie.« Doch er wagte das nicht.
Sie fuhr fort:
»Und wenn Sie wüssten, wie witzig, wie eigenartig, wie gescheit sie ist! Sie ist eine Zigeunerin, eine richtige Zigeunerin. Deshalb liebt ihr Mann sie auch nicht sehr. Er sieht nur ihre Fehler und weiß ihre Vorzüge nicht zu schätzen.«
Duroy war erstaunt, zu hören, dass Madame de Marelle verheiratet sei, obgleich das eine ganz natürliche Sache war.
Er fragte:
»So ... sie ist verheiratet! Und was tut ihr Mann?«
Frau Forestier zuckte leicht mit den Achseln und erhob die Augenbrauen mit einer einzigen, vielsagenden Bewegung.
»Oh! Er ist Inspektor der Nordbahn. Er verbringt im Monat acht Tage in Paris, das, was seine Frau die Arbeitswoche oder auch die heilige Woche nennt. Wenn Sie sie besser kennten, würden Sie sehen, wie klug und nett sie ist. Machen Sie ihr doch nächstens mal einen Besuch.«
Duroy dachte überhaupt nicht mehr ans Fortgehen. Ihm war zumute, als müsste er immer hierbleiben, als wäre er hier zu Hause.
Da ging die Tür geräuschlos auf und ein großer Herr trat unangemeldet ein. Er stutzte, als er den Mann sah. Madame Forestier schien einen Augenblick verlegen zu sein; dann sagte sie mit natürlicher Stimme, trotzdem eine leichte Röte von ihren Schultern zum Gesicht emporstieg:
»Kommen Sie doch näher, mein Lieber. Ich will Ihnen einen guten Freund von Charles vorstellen; Herr Georges Duroy, auch ein zukünftiger Journalist.« Dann setzte sie mit etwas anderem Ton hinzu:
»Unser bester und intimster Freund, Graf de Vaudrec.«
Die beiden Männer grüßten sich und betrachteten sich genau. Duroy verabschiedete sich gleich darauf. Sie hielt ihn nicht zurück.
Er stotterte noch einige Dankesworte, drückte die hingestreckte Hand der jungen Frau, verbeugte sich vor dem Grafen, der das kühle und ernste Gesicht eines Mannes aus der besten Gesellschaft bewahrte, und ging in höchster Verwirrung fort, als ob er eben eine Dummheit begangen hätte.
Auch auf der Straße fühlte er sich bedrückt und unbehaglich und hatte die dunkle Empfindung eines verborgenen Kummers. Er schritt vor sich hin und fragte sich nach dem Grund dieser plötzlichen Schwermut. Er fand keinen, aber die ernste Gestalt des schon etwas alten Grafen de Vaudrec mit dem grauen Haar und dem ruhigen, anmaßenden Gesicht eines unabhängigen, sehr reifen Mannes, trat ihm immer wieder vor die Augen.
Es wurde ihm klar, dass der Eintritt dieses Fremden nicht bloß das reizende Zusammensein gestört hatte, an das sein Herz sich schon zu gewöhnen begann, sondern in ihm auch diesen Eindruck von Kälte und Verzweiflung hervorgerufen hatte, wie es oft ein aufgefangenes Wort oder der flüchtige Anblick von Elend oder sonst irgendeine Kleinigkeit in uns auslöst.
Außerdem schien ihm auch, ohne dass er sagen konnte, warum, als ob dieser Mann unzufrieden gewesen sei, ihn dort zu treffen.
Bis drei Uhr hatte er nichts mehr zu tun, und es war noch nicht Mittag. Er hatte noch 6 Francs 50 in der Tasche. Er ging in die Bouillon Duval frühstücken. Dann trieb er sich auf dem Boulevard herum und Punkt drei Uhr stieg er die große prunkhafte Treppe zur ›Vie Française‹ hinauf. Die Laufburschen saßen mit gekreuzten Armen auf einer Bank und warteten, während hinter einem kleinen Katheder ein Beamter die soeben angekommene Post sortierte. Die ganze Aufmachung war vortrefflich und musste jedem Besucher imponieren. Alles hatte Haltung und Würde, wie es sich für den Warteraum einer großen Zeitung gebührt.
Duroy fragte:
»Ist Herr Walter zu sprechen?«
Der Diener antwortete:
»Der Herr Direktor hat eben eine wichtige Konferenz. Wenn der Herr einen Augenblick Platz nehmen will.«
Und er wies auf ein Wartezimmer, das schon voller Menschen war.
Man sah dort ernste, würdige Männer mit Ordensband, und auch etwas vernachlässigte Gestalten mit unsichtbarer Wäsche, deren bis zum Halse zugeknöpfte Röcke eine wahre Landkarte von Flecken zeigten.
Zwischen den Wartenden befanden sich drei Frauen; eine von ihnen war hübsch, elegant und lächelte freundlich; es schien eine Kokotte zu sein. Ihre Nachbarin blickte düster, ihr Gesicht war voller Runzeln; auch sie war besser gekleidet, doch sie hatte etwas Verbrauchtes, künstlich Erhaltenes, wie man es manchmal bei alternden Schauspielern sieht, eine Art falscher, abgestandener Jugend, die an ranzig gewordenes Parfüm d'Amour erinnert.
Die dritte Frau trug Trauer und saß in der Ecke, mit der Haltung einer untröstlichen Witwe. Duroy hielt sie für eine Bittstellerin.
Indessen wurde niemand vorgelassen, obgleich über zwanzig Minuten verstrichen waren.
Da hatte Duroy eine gute Idee; er ging nochmals zum Diener hinaus und sagte:
»Herr Walter hat mich um drei Uhr herbestellt. Sehen Sie bitte nach, ob mein Freund Forestier hier ist?«
Man führte ihn jetzt durch einen langen Flur in einen großen Saal, in dem vier Herren um einen großen grünen Tisch saßen und schrieben.
Forestier stand vor dem Kamin, rauchte eine Zigarette und spielte Bilboquet (Fangball). Er war ein vortrefflicher Spieler und fing die Kugel aus gelbem Buchsbaum mit der kleinen Holzspitze fast jedesmal richtig auf. Er zählte: »22 ... 23 ... 24 ... 25.«
»26!« rief Duroy.
Da blickte sein Freund auf, ohne seine regelmäßige Armbewegung einzustellen.
»Ah, da bist du ja«, rief er. »Gestern habe ich siebenundfünfzigmal hintereinander getroffen. Nur Saint-Potin kann es noch besser als ich. Hast du den Chef gesprochen? Nichts ist komischer, als diesen alten Norbert Fangball spielen zu sehen. Er reißt den Mund auf, als wollte er die Kugel runterschlucken.«
Einer der Redakteure drehte den Kopf nach ihm um.
»Weißt du, Forestier, ich kenne ein ausgezeichnetes Bilboquet aus Antillenholz, das zu verkaufen ist. Es soll der Königin von Spanien gehört haben. Man verlangt dafür sechzig Francs, das ist nicht teuer.«
»Wo ist es zu haben?« fragte Forestier.
Da er seinen 37. Wurf verfehlt hatte, öffnete er den Schrank, in dem Duroy gegen zwanzig wunderbare Bilboquets sah, die alle geordnet und nummeriert waren, wie Kostbarkeiten aus einer Kunstsammlung. Forestier stellte das Instrument auf seinen richtigen Platz und wiederholte die Frage:
»Wo steckt dieses Kleinod?«
Der Journalist antwortete:
»Bei einem Billetthändler beim Vaudeville-Theater. Wenn du willst, bringe ich dir das morgen mit.«
»Ja gut. Wenn es wirklich schön ist, nehm' ich es. Man kann nie zuviel Bilboquets besitzen.«
Dann wandte er sich zu Duroy.
»Komm jetzt, ich führe dich zum Chef, sonst kannst du hier warten bis zum späten Abend.«
Sie gingen wieder durch den Wartesaal, wo dieselben Personen genau in derselben Reihenfolge saßen. Als Forestier erschien, erhoben sich die junge Dame und die alte Schauspielerin und gingen schnell auf ihn zu. Er führte eine nach der andern in die Fensternische, und trotzdem sie sich ganz leise unterhielten, hörte Duroy, dass er beide duzte.
Dann stießen sie zwei Polstertüren auf und kamen zum Direktor.
Die wichtige Konferenz, die schon eine Stunde dauerte, bestand in einer Partie Écarté mit einigen Herren, die Duroy gestern wegen ihrer flachen Zylinderhüte aufgefallen waren.
Herr Walter spielte mit angespannter Aufmerksamkeit und vorsichtigen, abgemessenen Bewegungen, während sein Gegner die leichten, bunten Blätter mit Gewandtheit, Geschicklichkeit und Anmut eines geübten Spielers nahm, ausspielte und durch seine Finger gleiten ließ. Norbert de Varenne saß im großen Lehnstuhl des Direktors und schrieb einen Artikel, Jaques Rival lag mit geschlossenen Augen lang ausgestreckt auf einem Sofa und rauchte eine Zigarre.
Es roch hier in dem abgeschlossenen Zimmer nach dem Leder der Möbel, nach altem Tabak und nach Druckerschwärze. Man spürte den eigenartigen Duft der Redaktionszimmer, der jedem Journalisten bekannt ist.
Auf dem schwarzen, kupferbeschlagenen Tisch lag ein gewaltiger Papierhaufen, Briefe, Karten, Zeitungen, Rechnungen der Lieferanten, Drucksachen aller Art. Forestier schüttelte den Wettenden, die hinter den Spielern standen, die Hand und sah dann schweigend der Partie zu. Sobald Vater Walter gewonnen hatte, stellte er vor:
»Hier ist mein Freund Duroy.«
Der Chef warf über die Gläser seiner Brille einen raschen Blick auf den jungen Mann und fragte:
»Sie bringen mir meinen Artikel? Er kommt heute gerade recht zur Diskussion Morel.«
Duroy zog die zusammengefalteten Blätter aus der Tasche.
»Hier, Herr Walter.«
Der Chef schien entzückt und sagte lächelnd: »Sehr schön, sehr schön. Sie halten Wort. Sie müssen mir das wohl durchsehen, Forestier.«
»Das ist nicht notwendig, Herr Walter«, erwiderte schleunigst Forestier, »ich habe den Bericht mit ihm zusammen geschrieben, um ihm eine Anleitung zu geben. Der Artikel ist tadellos.«
Der Direktor erhielt eben die Karten von einem großen, mageren Herrn, einem Abgeordneten des linken Zentrums. Er fügte gleichgültig hinzu:
»Dann ist also alles in Ordnung.«
Noch ehe er die neue Partie beginnen konnte, beugte sich Forestier zu ihm hinab und sagte:
»Sie wissen, Sie haben mir zugesagt, Duroy an Stelle von Marambot zu engagieren. Soll ich unter denselben Bedingungen mit ihm abschließen?«
»Ja natürlich.«
Der Journalist nahm seinen Freund beim Arm und zog ihn fort, während Herr Walter weiterspielte.
Norbert de Varenne hatte nicht den Kopf erhoben; er schien Duroy nicht gesehen oder nicht wiedererkannt zu haben. Jaques Rival dagegen hatte ihm demonstrativ die Hand kräftig geschüttelt, um zu zeigen, dass er ein guter Kamerad sei, auf den man sich, verlassen könne.
Sie gingen wieder durch das Wartezimmer. Alle blickten auf, und Forestier sagte zu der jungen Frau so laut, dass auch die anderen Wartenden es hören könnten:
»Der Direktor wird Sie sogleich empfangen. Er hat jetzt gerade eine Konferenz mit zwei Mitgliedern der Budgetkommission.«
Dann ging er rasch weiter mit wichtiger und eiliger Miene, als wollte er eine Depesche von äußerster Wichtigkeit redigieren.
Als sie wieder in dem großen Redaktionssaal anlangten, griff Forestier sofort wieder zu seinem Bilboquet, vertiefte sich in das Spiel und sagte zu Duroy, indem er zwischen den Worten die Treffer zählte:
»Also: du kommst jeden Tag um drei Uhr hierher und ich werde dir sagen, welche Gänge und Besuche du am Tag, am Abend und am nächsten Morgen machen musst. — Eins. — Zunächst werde ich dir ein Empfehlungsschreiben für den ersten Bureau-Chef in der Polizeipräfektur geben. — Zwei. — Der wird dich zu einem seiner Beamten weisen. Mit ihm setzt du dich in Verbindung über alle wichtigen — drei — Polizeinachrichten, offiziell und halboffiziell. Verstanden? Wegen aller Einzelheiten wendest du dich an Saint-Potin, der Bescheid weiß. — Vier. — Du wirst ihn gleich oder morgen kennenlernen. Vor allen Dingen kommt es darauf an, die Leute, die du besuchst, zum Reden zu bringen — fünf — und überall Zutritt zu finden trotz verschlossener Türen. — Sechs. — Dafür bekommst du ein monatliches Gehalt von zweihundert Francs, außerdem zwei Sous pro Zeile für alle Neuigkeiten, die du selbst entdeckt hast. — Sieben. — Ebenso zwei Sous pro Zeile für alle Artikel, die du über vermischte Nachrichten zu schreiben hast. — Acht.«
Dann kümmerte er sich nur noch um sein Spiel und fuhr langsam fort zu zählen. Neun — zehn — elf — zwölf — dreizehn. Den vierzehnten Wurf verfehlte er, und er begann zu fluchen: »Die verfluchte Dreizehn bringt mir immer Pech. Verdammt noch einmal, am 13. sterbe ich sicher.«
Einer der Redakteure, der mit seiner Arbeit fertig war, nahm jetzt ebenfalls ein Bilboquet aus dem Schrank. Es war ein winziger Mensch mit einem Kindergesicht, obgleich er schon 35 Jahre zählte. Mehrere andere Journalisten kamen auch herein und gingen einer nach dem andern zum Schrank, um das Spielzeug zu holen, das ihnen gehörte. Bald waren es sechs, die mit den Rücken gegen die Wand nebeneinander standen und mit der gleichen regelmäßigen Bewegung die je nach der Holzart roten, gelben und schwarzen Kugeln in die Luft warfen. Es begann ein Wettkampf, und die beiden anderen Redakteure, die noch arbeiteten, standen auch auf, um als Schiedsrichter die Treffer zu zählen. Forestier gewann mit 11 Points. Der kleine Mann mit dem Kindergesicht hatte verloren. Er klingelte und rief dem eintretenden Boten zu: »Neun Bier!«. Dann begannen sie wieder zu spielen, in Erwartung des erfrischenden Getränks.
Duroy trank ein Glas Bier mit seinen neuen Kollegen und dann fragte er seinen Freund:
»Was soll ich jetzt tun?«
»Heute habe ich nichts mehr für dich«, erwiderte der andere, »du kannst gehen, wenn du willst.«
»Und ... unser ... unser Artikel, wird er noch heute Abend gedruckt?«
»Ja, aber du brauchst dich darum nicht zu kümmern, ich werde die Korrektur lesen. Mache morgen den zweiten Artikel fertig und sei, wie heute, um drei Uhr hier.«
Duroy schüttelte allen die Hände, ohne die Namen der dazu gehörenden Personen zu kennen und stieg dann wieder mit frohem Mut und leichtem Herzen die schöne Treppe hinab.