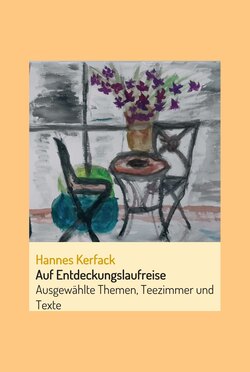Читать книгу Auf Entdeckungslaufreise - Hannes Kerfack - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеThemen
1. Forschungsprojekt zur „Liebe"2 zu (heiligen) Gegenständen als Teil der Objekt-Theologie
Grundlegende Gedanken
Während die Vorgedanken in mein theologisches Denken vom Gegenstand einführen, behandeln die folgenden, ausgewählten Aufsätze mehr praktisch-theologische und philosophische Themen in alle Richtungen, die nur gedacht werden können. Sie können auch noch weitergedacht werden: Wo gibt es noch solche Formen und Objekte der „Liebe“ beziehungsweise Zuneigung? Aufsätze und Ideen können gerne ergänzt werden. Z.B. gibt es in der religionswissenschaftlichen Diskussion noch die Frage nach dem „Masken-Fetisch“ im subsaharischen Afrika bei einigen indigenen Völkern. Daraus kann man noch weitere Gedanken entwickeln. Ich kann an dieser Stelle nur Gott danken und allen Menschen (es sind so viele), die mir in meinem Leben begegnen, dass sie mir ihr Herz öffneten, ich mit ihnen sprechen konnte, und für die (unentdeckten) Talente und Ideen, sowie die sprudelnden Gedanken und meine eigene Offenheit.
„Habe den Mut, ein Zeitzeuge deiner Zeit zu sein", schrieb ich einmal in einer Predigt im homiletischen3 Seminar. Ich bin kein hervorragender Theologe und manchmal zu leidenschaftlich bei der Sache, was nicht in die Vorlesung gehört, bin aber der Meinung, dass sich alle Theologen und damit auch Nicht-Theologen nicht hinter großen Persönlichkeiten verstecken müssen und sie sich als Vorbild nehmen können. Es ist unsere Lebenszeit, dessen Zeuge wir sein können, wenn wir nur ein Erdenleben wahrscheinlich haben, um die von Gott geschenkte Zeit zu erfüllen und nicht nur mit der Zeit der vergangenen und zukünftigen Persönlichkeiten. Auch wenn wir von diesen lernen, durch ihre Bücher, ihre Reden, was andere über sie berichtet haben, sind sie eine Bereicherung.
Keine Angst vor Minderwertigkeit und dem Sich-Klein-Machen oder Klein-Machen-Lassen durch Andere. Ich schreibe hier auch völlig aus meiner theologischen Leidenschaft heraus und versuche die Wissenschaft so gut wie möglich, wie mit kritischen Fußnoten, mitschwingen zu lassen. Das „Selbstverständliche ist das Erstaunliche."4 schrieb Klaus-Peter Hertzsch in seiner Überschrift von seinem Buch, wo Predigten und Meditationen von ihm gesammelt sind. Gerade im Einfachen, Naiven und Leichtgläubigen scheint sich eine enorme, theologische Kraft zu befinden.
Auch im Objekt, also auch wenn ich ein Buch lese, gibt es mir bedingungslos etwas, wenn ich es verstehen kann, wenn es mir zusagt, wenn ich Lust bekomme, es komplett durchzulesen. Ich schlage es auf und verschlinge es. Es will es ja auch. Bildung ist toll und eine Bereicherung des Lebens (Liebe zur Bildung) oder auch Liebe zum Leben und seinen schönen Möglichkeiten, auch als Projektionsfläche. Sowie hier in diesem Band, die Zeit, das Leben und die Bildung zu nutzen, für andere und mich zu schreiben. Dass ein Objekt daher ein lebloser Gegenstand ist, wage ich zu bezweifeln, wenn andere Menschen in ihren Büchern Gefühle niederschreiben und von sich selbst etwas Anderen geben, etwas er-zeugen, durch die Projektionsfläche eines Buches, für Andere. Das ist ja auch eine Aufgabe dieses Kreativbuches.
Dann kann ein Buch schon eine von Menschen geschaffene Seele haben, die Anderen und mir gut tun kann. Wobei es dabei weniger um ein Lebewesen aus Fleisch und Blut geht, das sich selbstständig weiterentwickeln, ernähren und fortpflanzen kann. Es pflanzt und ernährt sich durch den Bezug auf den Anderen weiter, der für das Objekt „Gefühle“ entwickelt und durch sich dann (als Wechselbeziehung) das weitergeben kann, was er im Buch über seine Gefühle niedergeschrieben hat.
Das Objekt, das Ich und der Andere sind eng miteinander als „Liebesbeziehung“ verbunden. Das Fleisch sind höchstens die blutigen, leidenschaftlichen Worte, aus denen ein Buch besteht, die aber wieder eine Projektionsfläche meiner „Liebe“ sind!
Im Nachhinein stellte man nach dem Attentat in Berlin 2016 fest, dass ein Bordcomputer, eine von Menschen installierte „Auto-Seele“ (Autos werden in Zukunft immer schlauer werden), Schlimmeres verhindert hat. Ein Gegenstand hat also immer etwas Menschliches durch den Menschen selbst, wobei wieder schwierig wird, wenn es sich bei dem vermeintlichen Gegenstand (also auch Tiere und sogar Pflanzen! - abgestuftes Lebewesen-Sein? Wie intelligent ist eine Pflanze oder ein Tier?) wirklich um ein Lebewesen handelt, das die Biokriterien wirklich erfüllt und selbständig leben und sich weiterentwickeln kann. Aber Menschen vermenschlichen auch Tiere, mal so mal so, aufgrund ihrer Gefühle zu diesen. Andererseits werden Tiere auch als „Objekte“ behandelt, denken wir an die Erfahrungen mit Tierzucht und co.
Es ist interessant, wie Menschen im vermeintlichen, toten „Gegenstand“ Selbstidentität stiften. Frei zu argumentieren und zu improvisieren kann eine enorme theologische Sprengkraft, besonders das Leichtgläubige, auslösen, aber es muss auch kritisch betrachtet werden. Leidenschaft und Kritik müssen zusammen gedacht werden. Ich war als Kind auch ein begeisterter RMS Titanic-Fan und ich wusste so gut wie alles darüber und gerade in dieses Schiff wurde auch Gottesebenbildlichkeit hinein projiziert, mit fatalen Folgen: Ein unverfügbarer Eisberg und Schaden am Rumpf (die schicksalhafte „6. Abteilung“. Bei 5 vollgelaufenen Abteilungen hätte sich das Schiff noch über Wasser halten können!), machte den Traum der Meere in dieser Zeit ein Ende. Aber Leidenschaft muss nicht von jedem geteilt werden. Als ich einmal im Gespräch mit einem Pastor war, der mich mit seiner theologischen Leidenschaft „zu textete“, kam das nicht bei mir an. Ich konnte ihm irgendwann nicht mehr zuhören. Das heißt: Man muss sich gegenseitig auch zuhören und gegebenenfalls seine Leidenschaft zugunsten eines gelingenden Gesprächs mit dem Anderen zurückstellen. Mutig war, dass ich dem Pastor das sogar sagte und er mit Verlegenheit darauf reagierte, welch schlaue Antwort ich wohl gab. Andererseits ist ein Feedback immer auch etwas „von oben herab“, sodass immer die Empathie im Blick bleiben muss und das Priestertum aller Gläubigen. Den Ehrenamtlichen eine „Chance“ geben, sich zu entfalten, mal eine Predigt halten usw. Das entlastet den Pastor ja auch, aber das muss gleichzeitig der verantwortlichen Kommunikation gegenüber einem Hörerkreis unterliegen. Das setzt eine gewisse Ausbildung, auch nur eine kurzzeitige oder „ein kurzer Blick“ auf das Manuskript voraus. Der alttestamentliche Aufsatz greift die Ambivalenz der Objektliebe auf. Die Auslegung der Geschichte vom goldenen Kalb zeigt das Spannungsfeld. Einerseits macht sich das Volk Israel seinen Gott in Form eines goldenen Kalbes aus den Ringen aus Ägypten, weil sie keinen Gott sehen, ihn nicht anfassen können. Das kann zermürbend sein. Also: Was ich mir nicht vorstellen kann, daran kann ich auch nicht glauben. Also mache ich mir etwas, woran ich glaube. Gott schickt Mose die zwölf Tafeln, um doch etwas in die Hand geben zu können, was man anfassen und lesen kann, sodass das goldene Kalb nicht anstelle Gottes verehrt wird. Neutestamentlich wäre die Frage nach dem Verhältnis von Sub- und Objekt im Kreuz und Sakrament Christi interessant. Also: Wie viel göttliches und wie viel menschliches Werk ist im Kreuz und daher auch im Abendmahl? Ist die Hostie ein menschliches Werk? Ja oder nein? Systematisch spielt die Tierethik und das Verhältnis zum vermeintlichen Objekt eine große Rolle. Wie viel Subjekt ist im Tier? Im praktischtheologischen Teil habe ich schriftliche Ergebnisse von Collagen aufgenommen. An eine umfassende, empirische Studie mit Fragebögen und Interviews habe ich mich nicht getraut. Denn ich glaube kaum, dass viele, die meinen nichtreligiös zu sein, dass sie zugeben wollen, dass sie doch „religiöser“ sind als sie selbst glauben. Religion ist seit spätestens der Aufklärung eine Privatsache geworden und die Kirche verliert oder gewinnt in anderer Gestalt an neuer Bedeutung. Objektliebe ist ein faszinierendes Thema, aber zugleich auch ein riskantes Thema, weil die Unterscheidungen zwischen Hetero- , Homu-, Bisexualität und so weiter immer noch weit verbreitet sind und durch die Behauptung, dass der Mensch alles lieben kann, in Grund und Boden gedrückt werden. Aber trotzdem gibt niemand zu, dass er seine Tasche, seine Schuhe (bei den Frauen) gerne mal vergöttert und ein Vermögen an Geld für sie ausgibt, teilweise egoistisch und „selbst ergötzend“. Daher ergibt sich die These: Die Menschen und Christen sind „objektliebender“ als sie es selbst zugeben würden, weil sich die Gefühle auf eine andere Art entladen (auch im möglichen, negativen Sinn), wo sie enthalten werden müssen. Das ist aber auch etwas Menschliches und total Wunderschönes: Gefühle zu haben. Gefühle zuzulassen, lassen Dämme brechen. Der Körper wehrt sich dagegen, weil er es einfach will und es tut weh, wenn Gefühle unterdrückt werden. So sind wir geschaffen von Gott mit Gefühlen, die auch widergöttlich missbraucht werden können. Sind die Gefühle ein menschliches oder göttliches Werk? Denken wir an den Sündenfall, so ist es etwas Menschliches, sich verführen zu lassen - menschliches Versagen oder göttliches Versagen? Der Baum war ja da, als geschaffenes Objekt Gottes. Oder ein gelingendes Scheitern für mehr Liebe auf der Erde? Es sind so viele Spannungsfelder und Fragen und ich kann sie in diesem Sammelband nur exemplarisch ausführen. Und ich finde, dass es eine Chance für mehr Liebe auf der Welt ist, für alle Menschen, wenn der Mensch erkennt, dass er alles lieben kann, solange es keine schädliche Liebe ist (Liebe zu Waffen und co.), wo wir wieder die Ambivalenz der Objekt-Theologie sehen, um den anderen Menschen ihre Gefühlswelt und Leben zu lassen. Erinnern wir uns an die Attentate von Nizza und Berlin im Dezember 2016, wo die physikalische Wucht der Geschwindigkeit eines Autos missbraucht wurde, um andere Menschen zu töten und schwer zu verletzen, als Mittel des Attentates. Vielleicht drückt das auch Zweideutigkeit aus. Religion und ObjektTheologie können missbraucht oder gebraucht werden. Es ist eine Frage der Deutung und der Interpretation. Diese sprechen ganz deutlich im Sinne der engemannschen Auredits5, was ich in die indirekten Sätze hinein interpretieren soll. In diesem Sinne kann ich nur sagen: Stehe zu deinen Gefühlen und was du magst. Es muss dir nicht peinlich sein. Es ist etwas Wunderschönes und Menschliches zugleich, was eine enorme Energie im Alltag und Beruf entfalten kann, wenn wir uns der Liebe Gottes in all seinen Facetten und seinen Engeln öffnen. Sich von Gott streicheln lassen, wenn das Göttliche in einem erkannt wird und in anderen, dann entfliehen wir der Demut hinein in die Freiheit des Lebens. Das hat wenig mit Selbstbezogenheit zu tun, denn das Doppelgebot der Liebe sagt: „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst.“ Also: Wenn ich mich lieben kann, kann ich meine Liebe auch dem Anderen weitergeben, ohne vollkommen auf mich bezogen zu sein. Ich bin kein Narzisst dadurch, indem ich mich selbst gerne habe, ohne zu vergessen, dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt.
Praktisch-theologische Collage
Das erste Fragment gehört zur Geschichte von Fabian, der Goldschmied, wo das Geldsystem kritisiert wird. Ich glaube, dass Geldgier auch eine Form der Objektliebe ist, von der ich mich abhängig machen kann, weil Glücksgefühle ausgelöst werden. Immer mehr haben wollen, hat etwas mit einer pathologischen Sucht (Sammelsucht) zu tun. Der Zins steuert zu dieser Sammlung ja immer mehr dazu. Der Film kritisiert die Funktion des Zinses-Zins und zeigt die Grenzen des Geldsystems auf, das Schulden dadurch in das Unermessliche steigen und die Hauptschuld nicht abgetragen werden kann. Folgen sind Armut, Kriege und soziale Ungleichheit, dessen Faktoren sich alle wechselseitig bedingen. Der Film führt dazu Beispiele an.6
Ein weiteres Beispiel für Objektliebe ist die Liebe zu Büchern. Sie verbindet mehrere Dinge. Erstens kann Objektliebe auch eine pathologische Sammelsucht bezeichnen. Denken wir an die „bibliophilen“ Autoren wie Goethe und Schiller, die dutzende Bücher in ihrem Leben angesammelt und geschrieben haben. Sie leben in ihren Büchern weiter. So ist die Frage, ob ein toter Gegenstand sich nicht „fortpflanzen“ kann, etwas hinfällig und relativ zu betrachten. Das Buch ist mein Freund (amicus inter amicos), auch wenn es ein relativ lebloser Gegenstand ist, so ist er doch lebendig durch das, was wir in die Bücher hineinschreiben. „Etwas von der Seele schreiben“ ist ein gutes Stichwort dafür, wie man es auch in Tagebüchern schreibt. Bücher werden durch die Namensschilder personifiziert. Ich identifiziere mich damit, indem ich meinen persönlichen Stempel dahinein setze (z.B. Exlibris).
Die „Liebe zum Laufen“, die ich in Läufer-Foren einmal gefunden habe, ist wahrscheinlich nicht nur eine Metapher, sondern eine Tatsache. Ich kenne das Gefühl nach dem Laufen, dass ich glücklich und ausgeglichen werde. Und es gibt Beispiele, dass Paare nach dem Laufen mehr Lust auf Sex haben, sodass da ein enger Zusammenhang mit den Glücksgefühlen liegt. Und wenn das Laufen ein sportlicher Gegenstand, ein sportliches Thema ist, dann ist es auch eine Hinwendung zu einem Gegenstand, der auch Gefühle bieten kann.
Die Schiffstaufe ist ein zivil-religiöses Fest. Das heißt: Es ist nicht explizit kirchlich orientiert, nimmt aber andererseits religiöse und liturgische Elemente auf. Fraglich ist, wenn wir Gegenständen so nahe stehen, also Schiffen z.B. durch die Namenstaufe Namen geben, ist es dann noch gerechtfertigt, dass es nicht auch andere alternative Kasualien und Formen der „Liebe“ geben könnte? Das Problem ist, denke ich, die Anerkennung. Während die Schiffstaufe in der Welt mit unterschiedlichen Formen weit verbreitet ist, so werden beim Thema „Liebe“ die Grenzen stärker. Der Ablauf hat interessante Parallelen zur christlichen Taufe. Es gibt einen Taufpaten (eine Frau), eine Kasualrede und den Sektschlag, mit dem das Schiff seine Namensidentität und einen Reisesegen erhält. Überall wo das Schiff hinfährt, soll es von Gott gesegnet sein. In diesem Sinne ist es nicht nur ein zivil-religiöser Akt, sondern eine religionshybride Erscheinung, in dem sowohl weltliche als auch religiöse Dinge miteinander verschmelzen und neu gedeutet werden.
Ein weiteres Beispiel: Da die Single-Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten immer größer werden, mehr Priorität auf die Karriere gelegt wird, kann die Arbeit auch zu einer Ersatz-Liebe werden. Ob die Arbeit als Gegenstand bezeichnet werden kann, ist eine Deutungsfrage. Aber wenn in der Theologie die Arbeitsgebiete vom Alten Testament, Neuen Testament usw., als Gegenstand des Studiums bezeichnet werden, dann kann das als Zuwendung zu einem Gegenstand verstanden werden. Da spielen auch geringe Selbstwertgefühle eine Rolle, die mit mehr Arbeit kompensiert werden möchten. Sie werden auch „Work-Alholics“ genannt, die freiwillig oder unfreiwillig (z.B. durch ständige Erreichbarkeit) mehr Arbeit verrichten. Kritisch ist daran die Burnout-Gefahr zu sehen, wenn das Gefühl für die Arbeit verschwindet, aber andererseits kann ich Anderen mit meiner Arbeit auch etwas von mir geben. Zwischen diesem Spannungsfeld stehen wir, denke ich.
Ich habe das Beispiel aus einer Vorlesung zur Kirchenkybernetik vergessen, wo der Professor uns einen Katholischen Gottesdienstablauf zeigte und der Priester das Buch des Evangeliums küsste, Liebe zum Evangelium und zu Gott über das Medium eines Buches. Es war aber eine Videoaufnahme. Wobei es sich dabei wahrscheinlich um eine symbolische und weniger leidenschaftliche Funktion handelt, das der Gottesdienst dem Evangelium und der Heiligen Schrift gewidmet ist.
Dann gibt es das „Bild“ eines Priesters bei der Betrachtung einer Hostie vor der Transsubstantiation (also Wesensverwandlung des Brotes und Weines zu Christus), die kein menschliches Werk ist, sondern ein durch Konsekration erzeugter (Weihung) göttlicher Gegenstand. Ich denke, dass die Liebe Gottes als geistliche Stärkung durch das Abendmahl da auch eine Rolle spielt. Im evangelischen Glauben tritt der Weihzustand hinter die Realpräsenz unter der gesamten Gemeinde („Christentum aller Gläubigen, aller Getauften“) zurück. Der Pastor ist in diesem Sinne ein Gemeindemitglied wie jeder andere. Er hat keine höhere Weihstellung vor der Gemeinde mehr. Keine Unterscheidung zwischen Klerus und Laien. Er ist nur durch die Ordination dazu befugt, die Sakramente ordnungsgemäß zu verwalten, wobei das Sakrament des Abendmahls jeder gläubige Christ im evangelischen Glauben u.a. spenden kann. Es besteht aber eine klare Unterscheidung zwischen dem Beruf, dem Amt, genauer gesagt, die Profession und dem Ideal. Bei der Elevation frage ich mich, also dem Hochhalten, dem Präsentieren des Kelches vor der Gemeinde und dem Altar: Sprechen wir zum Altar nicht auch über einen Gegenstand zu Gott? Im Altar und im Kelch ist das Göttliche. Es sind zwar von Menschen gemachte Objekte, aber das Göttliche wird da auch hinein projiziert. Es handelt sich an dieser Stelle wohl mehr um eine symbolische Objektliebe, genauso wie beim Buchkuss. Das bedeutet nicht, dass eine Liebe zum Abendmahl und zum Buch nicht auch Gefühle freisetzen kann. Abendmahl und Heil haben immer etwas haptisches und geschmackliches, um selbst Heil wirken zu lassen oder das diejenige Person, die das Abendmahl empfängt, ein „plausibles“ Heil erhalten hat.
Das ist wohl die größte Objektliebe der letzten Jahre geworden. In Windeseile verbreitete sich die „Digiphilie“ im Sinne des großen Erfolges des Smartphones. Der Smiley auf dem Smartphone zeigt, dass Smartphones Gefühle empfangen können (Emoticons in den Gesprächen) und dem Gesprächspartner daher auch bieten kann. Mir fiel in der Universitätsbibliothek auf, wie viele Studenten mehr Zeit auf Facebook und co. verbringen, seitenweise Texte schrieben und quasi in einer Abhängigkeitssituation waren, die sie von der eigentlichen Arbeit ablenkt. Also: Gefühle machen süchtig, weil sie Anerkennung bei Anderen vermitteln und diese unbedingt zu erlangen (aus Angst vor „Schuld und Strafe“ im privaten Bereich), um vielleicht von etwas anderen abzulenken, was Angst (Stress, Druck, Phobie) macht. Eine Moderatorin in einer Fernsehsendung über Objektliebe erinnert die Zuschauer daran, dass, wenn sie ihr Smartphone streicheln und wischen, dass sie ein bisschen „objektophil“ sind. Das ist aber auch eine Deutungsfrage, weil Objektliebe etwas ausschließliches hat. Ich würde aber Objektliebe nicht als „Krankheit“ bezeichnen, wenn diese Form der Digiphilie schon als „Volkskrankheit“ der Moderne bezeichnet wird.
Auch ein Religionshydrid: Animismus, Ahnenkult und ein Flugzeug. Manche Völker verehren in Melanesien Flugzeuge und Waren aus der westlichen Welt, weil sie nur überirdischem Ursprung sein können, weil die Eingeborenen sie selbst nicht herstellen können. Die fehlenden Waren werden dann immer eingeflogen. Sie werden auch als Boten der verstorbenen Ahnen aus dem Jenseits gedeutet. In diesem Sinne auch eine Hinwendung zu einem Menschen durch ein Objekt, dem Flugzeug.
Die verschriftlichte (objektive!) Predigt ist auch eine Spiegelfläche der Liebe zum Evangelium, zu Gott, zum Nächsten und zu mir Selbst. Denn über die Liebe Gottes, der Bibeltext und die Predigt als Projektionsfläche für die Liebe zur Theologie und Gott kann Anderen Liebe durch Gottes Wirken geschenkt werden. Es gibt in der Predigtlehre auch die Lesart, dass in einer Predigt die eigene, religiöse Bewegtheit weitergegeben werden kann. Ob die nun für den Hörer plausibel ist, ist abhängig von der jeweiligen Situation und dem jeweiligen Individuum (homiletische Situation). Hier sehe ich ganz klar, dass ich mit meinem Wissen und meiner Auslegung, Anderen etwas Gutes geben kann durch meine religiöse Bewegtheit und Gefühl. Auch beinhaltet die Liebe Gottes hier die Liebe in all ihren möglichen Facetten (Universalität und Dynamik der Liebe), wo der Hörer anknüpfen oder nicht anknüpfen kann. Denn Liebe kann auch in Hass und Anti-Liebe umschlagen, wenn sie untereinander fehlt. Gleiches gilt für die Projektionsflächen der Liebe Gottes im Hohelied Salomos und der Paulus Liebe zu Gott im 1. Kor 13.
Alttestamentlicher Zugang: Die Geschichte vom goldenen Kalb (Ex 32)
Textfassung (Zürcher Bibel), Ex 32, 1-11.14-16.19-20
1 Das Volk aber sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam. Da versammelte sich das Volk um Aaron, und sie sprachen zu ihm: „Auf! Mache uns Götter, die vor uns herziehen! Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat - wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist.“ 2 Da sprach Aaron zu ihnen: „Reißt die goldenen Ringe ab, die eure Frauen, eure Söhne und Töchter an den Ohren tragen, und bringt sie mir.“ 3 Da rissen sich alle die goldenen Ringe ab, die sie an ihren Ohren trugen, und brachten sie zu Aaron. 4 Und er nahm es aus ihrer Hand und bearbeitete es mit dem Meißel und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: „Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben!“ 5 Und Aaron sah es und baute davor einen Altar. Und Aaron rief und sprach: „Morgen ist ein Fest des HERRN.“ 6 Und früh am Morgen opferten sie Brandopfer und brachten Heilopfer dar, und das Volk setzte sich, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu vergnügen.7 7 Da redete der HERR zu Mose: „Geh, steige hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. 8 Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt: „Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben.“ 9 Dann sprach der HERR zu Mose: „Ich habe dieses Volk gesehen, und sieh, es ist ein halsstarriges Volk. 10 Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen.“ 11 Da besänftigte der Mose den HERRN seinen Gott und sprach: „Warum, HERR, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit so großer Kraft und mit starker Hand aus dem Ägyptenland herausgeführt hast?“ 14 Da reute es den HERRN, das er seinem Volk Unheil angedroht hatte. 15 Mose aber wandte sich um und stieg hinab vom Berg, mit den zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. 16 Und die Tafeln waren Gottes Werk, und Schrift war Gottes Schrift, eingegraben in die Tafeln. 19 Und als er sich dem Lager näherte, sah er das Kalb und die Reigentänze. Da entbrannte der Zorn des Mose, und er warf die Tafeln hin und zerschmetterte sie unten am Berg. 20 Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht haben, und verbrannte es im Feuer und zerstampfte es, bis es Mehl war, und streute es auf das Wasser und ließ die Israeliten trinken.
Kurzkommentar
V. 1 greift wahrscheinlich den Unmut des Volkes Israel auf, nachdem Mose nicht vom Berg Sinai zurückkommt (Ex 24). Es liegen ja auch einige Kapitel dazwischen und es vergeht eine Menge Zeit, bis Jahwe (hebräisch für HERR) Mose die Gesetze auf dem Berg erläutert hat (Ex 24-31, Priester, Salböl, Opferkult, Tempelbau usw.). Dieser Unmut des Volkes führt dazu, dass die Israeliten sich Gott nicht vorstellen können, solange sie nichts Handfestes haben. Oder Warten kann unerträglich sein. Das Fehlende wird auf etwas anderes übertragen: Die Schaffung eines goldenen Kalbes aus goldenen Ringen aus Ägypten (V. 2-3). Gerade Aaron tut es, ein Weggefährte Mose, quasi als Gegenentwurf und -gestalt, als Rivale. V. 5 greift dann das auf: Das goldene Kalb ersetzt Jahwe nur im Sinne Mose, aber nicht im Sinne des Volkes Israel, das das goldene Kalb mit dem Gottes Namen gleichsetzt, obwohl es im Sinne Mose widergöttlich ist. (V. 7f.). Dass dann in V. 6 Opferformen für das goldene Kalb angewendet werden, zeigt einerseits, dass das Volk Israel, die in den vorherigen Kapitel aufgeführten Gesetze kennt, aber sie sie andererseits widergöttlich auf das goldene Kalb anwenden. Interessant ist in objektliebender Sicht, die Betonung des Vergnügens und der Reigentänze (V. 19). Hier wird ein großes Festspiel der Lust gezeichnet und gefeiert, dass der Mensch fähig ist, zu allem ein tiefes Gefühl der „Liebe“ aufzubauen. Wie das nun genau aussieht, ist wohl auch Sache der Intimität, was nicht genau beschrieben wird. Die Bibel lässt oft offene Räume der Interpretation. Ich stelle es mir so vor, wie, als Faust auf dem Hexentanzplatz ist. Gut ist das Lustspiel in den Augen Jahwes nicht, denn sein Zorn entbrennt über das Volk Israel (V. 10). Mose stellt eine „Totschlag-Frage“: Warum dieser Zorn Gottes, obwohl Jahwe das Volk Israel aus dem Land Ägypten befreit hat? (V. 13) Diese Frage führt zur Reue des Herrn im folgenden Vers. Aber gleichzeitig zeichnet sich ein Kompromiss ab. Obwohl Jahwe nicht zornig ist, kann er es nicht zulassen, dass das Volk Israel ihn durch ein goldenes Kalb ersetzt. So schickt er ihnen durch die Hand Mose doch etwas Fassbares, die 10 Gebote, womit sie sich nicht nur selbst lieben können, sondern ihre religiösen Gefühle zu Gott auch dem Nächsten und Gott weitergeben können. „Du sollst deinen Herrn ehren und keine anderen Götter haben neben dir.“ (1. Gebot). Diese Gebotstafeln sind ausdrücklich Gotteswerk und Schrift und kein Menschenwerk wie das goldene Kalb (V. 16). Aber wieder die Frage: Wie viel Gottes Werk steckt im goldenen Kalb? Hier erst mal gar nicht, was zum Tod führt, wenn goldenes Wasser getrunken wird (V. 20). Das Objekt der Gefühle führt zum Tod. Vielleicht darf man sich etwas einbilden, wenn die Gebote gehalten werden? An dieser Stelle führt es aber zur Strafe durch die Sünde Israels, gegen das erste Gebot gehandelt zu haben, wo ich aber zur Verteidigung sagen muss, dass diese Gebote in der Narration jedenfalls noch nicht handfest waren. Und dann bleibt eher das Risiko dafür, sich etwas einzubilden und das etwas ausbleibt. Menschen sind nach dem Sündenfall anders geworden und entwicklungsbedürftig, auch durch Schuld und Strafe.
Religionsgeschichtliche Einordnung und Argumentation
Das goldene Kalb greift die Ambivalenz der Objekt-Theologie als Objekt-Antitheologie genau auf. Hier wird etwas verehrt und von etwas gesprochen, was zu dem Widergöttlichen gehört. Gleichzeitig ist dem Menschen die Fähigkeit zum Einbilden und zur Phantasie gegeben, um die Sehnsucht nach etwas Schönem zu erfüllen, was Sinn stiftet, was einfach „da“ ist, was man sich vorstellen kann. Gleichzeitig tritt diese Phantasie, sich etwas neben Gott zu erschaffen, auf ein Spannungsfeld, wie in dieser Bibelgeschichte entfaltet wird. Im jüdischen, monotheistischen (oder monolatrischen) Glauben, die theologische Entwicklung Israels ist evident, kann es nur einen Gott geben und man darf sich kein Bild von ihm machen. Schuld und Strafe ist ein Thema im Alten Testament, besonders im deuteronomischen Geschichtswerk. Die Grundfrage: Warum bröckelt die Gottesbeziehung Israels und wie fügt sie sich wieder zusammen? Das goldene Kalb und die Anti-Kalb-Gebote sind wohl ein Grund und eine dynamische Wechselbeziehung dafür. Die Entwicklung läuft dabei auf einen strengen Monotheismus und einen verborgenen Gott zu, der sich nur noch in Engelsgestalten zeigt oder das Deuteengel auftreten (im Daniel-Buch, die Offenbarung der kommenden Reiche), die im Sein das Sein und Werden Gottes und der Geschichte apokalyptisch und Endzeit bezogen neu deuten. Grunderfahrung ist
wahrscheinlich die Angst vor der Strafe Gottes. Bestimmte geschichtliche Ereignisse (wie die Zerstörung Jerusalems, 587 v. Chr.) werden so begründet, dass Israel Gott vergessen hat, andere Götter anbetet oder sich zu wenig dem Nächsten zuwendet (Kult- und Sozialkritik der Propheten). Aus dieser Erfahrung heraus, wird der Gott Israels als sich entfernender Gott gedeutet, der aber trotzdem immer noch da ist. Folgerichtig geht es im alten Israel auch um die Auseinandersetzung mit dem Fremden (Israel und Kanaan), dem metaphorischen „Kalb“. Woher kommen wir, wohin gehen wir, woher nehmen wir etwas mit, was geben uns andere? Dabei handelt es sich wahrscheinlich nicht um zwei verschiedene Völker, die während der Landnahme im Stammessystem aufeinandertrafen (Josua-Buch), sondern um eine synthetische Kultur, ein Religionshybrid.8 Palästina ist ein Durchgangsland. Die Voraussetzungen stehen also gut, dass sich Religionen miteinander vermischen, also auch Jahwe und Baal.9 Dass Göttervorstellungen also vermischt worden sind, ist evident. Vielleicht zeigt sich dies jetzt auch bei der Geschichte mit dem goldenen Kalb, das die anderen Gottheiten, mit denen sich Israel auseinanderzusetzen hat, repräsentiert. Das sind Kategorien, die erst später entstanden sind: Monotheismus, Polytheismus und co. Und sie sind „neuzeitliche Kunstwörter“10. Baal und Jahwe waren zu bestimmten Zeiten ein und derselbe Gott.11 Generell kann gesagt werden, dass sich die Gottes-Begriffe mit der Zeit wandeln, also wie auch Völkernamen und die Völkerstrukturen.12 Auch wurden die Kulte beeinflusst, durch äußere Mächte, wie Ägypten und ihre Kulte (denken wir an den Sonnenhymnus des Pharaos Echnaton). Der Sonnenhymnus ist ein Produkt aus dem 11. Jh. v. Chr. und zeigt Parallelen zum Psalm 107. Echnaton war der erste Monotheist, der versuchte, die polytheistischen Gottheiten Ägyptens zu vereinen und ist selbst Repräsentant Atons auf Erden. Aton und Jahwe werden beiderseits als Schöpfer der Welt bezeichnet. Religionshybride sind auch im Alten Testament etwas entscheidendes und prozesshaftes, wie auch eine ägyptische Grabkammer, die dem Gott Anubis geweiht ist. Klar sind die Fahrzeuge links und rechts zu sehen. Wenn im ägyptischen Glauben ein Mensch stirbt, dann fährt er quasi in die Unterwelt hinab, um mit einem Schiff durch das Unterweltmeer Richtung Westen (Sonnenuntergang gleich Untergang des Lebens) zu fahren, um im Osten (Sonnenaufgang gleich Lebenserneuerung) in das jenseitige Leben zurückzukehren. Dort kann er als Ahne von der Familie und den Hinterbliebenen weiter verehrt werden. Der Streitwagen prägte sein Leben wohl als ein General und Streiter. Es kommt zu einer Biographisierung eines Objektes.
Hier der Text, ein Auszug im Vergleich mit dem Psalm 104:
| Psalm 104 | Aton-Hymnus |
| 1 Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 2Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. 3Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Sturmes. 4Du machst dir die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu deinen Dienern. 5Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet; in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.13 | Schön erstrahlst du am Himmelshorizont, du lebender Aton, du Anfang des Lebens. Wenn du am östlichen Horizont aufgegangen bist, dann hast du jedes Land mit deiner Vollkommenheit erfüllt. Du bist schön und groß, licht und hoch über jedem Lande, deine Strahlen umarmen die Lande bis hin zu alledem, was du geschaffen hast. |
Und ich frage mich, ob das goldene Kalb, wie die goldene Sonne des Aton, in deren Gestalt er sich zeigt, sowohl eine Vergöttlichung eines materiellen Gegenstandes ist, als auch „Vergötzung“ stattfindet. Also wenn schon im Psalmenbuch etwas anscheinend „Widergöttliches“ rezipiert worden ist, dann ist es wohl eine Selbstverständlichkeit, sich Gott in anderen Dingen abzubilden und es kritisch zu sehen ist, das als „gottlos“ zu bezeichnen. Einen ähnlichen Zusammenhang haben wir auch beim Sol-Invictus-Kult festgestellt, wo Jesus mit der Sonne gleichgesetzt wird. Wir sehen, Gegenstände und Objekte sind Projektionsflächen für Göttliches und vermeintlich Anti-Göttliches. Durch die Geschichte vom goldenen Kalb scheint die Götzenkritik in eine Geschichte hinein gespiegelt worden zu sein. Monotheismus ist eine exklusive Kategorie, die Götzen ausschließt. Aber wenn z.B. die Trinität eine Dreiergestalt Gottes ist, wird die Götzenkritik auch wieder relativiert. Wir stellten auch fest, dass die Gottesbildentwicklung auch von der eigenen Umwelt abhängig ist. Inklusiver Monotheismus bleibt dagegen tolerant (Monolatrie).14 Die daraus folgende Kultausübung ist privat als auch als eine öffentliche Sache (Kultstätten, öffentliche Plätze) zu betrachten. Interessant sind die Ahnenkulte mit verschiedenen Figuren15, die göttliche Gestalt annehmen (anthropomorphe Gestalten), die in der Ikonographie als der Bildermalerei eine entscheidende Rolle spielen.16 Aus objektliebender Sicht findet die Heiligung und Verseelung durch die Liebe zu den Ahnen statt, und dass der Mensch hier fähig ist, alles zu lieben. Vielleicht möchte man sich wieder an sie erinnern, sie nicht vergessen, sie in ihrem Sein zu lassen und aus dem Nicht-Mehr-Sein zu lösen. Abbildungen von Jahwe sind eine Selbstverständlichkeit, aber mit Beginn der Kultkritik schien sich das zu ändern. Ich glaube, dass diese Kulte auch missbraucht werden können, für das Kommerzielle, für das Unmenschliche. Wahrscheinlich kommt es daher durch die Pluralität auch zu einer Kultzentralisierung im 7. Jh. durch Joschias Reformen, um den Blick auf den einen Gott und die Gebote wieder zu stärken.17 Das sind deuteronomische Reformen, sodass wir da auch die Kritik und den Aspekt der Schuld und Strafe in Israel sehen. Wenn Gott durch die vielen Objekte vergessen, der Blick auf das Wesentliche verloren wird (z.B. Gebote der Nächstenliebe, zu viel Selbstbezogenheit), dann ist es gottlos oder nicht? Phantasie oder Einbildungsbildungskraft ist dem Menschen zu eigen. Ich möchte meinen Gott auch anfassen können, ihn spüren können. Problematisch ist, wie gesagt, die Selbstbezogenheit, aber die wird durch die Liebe zu den Ahnen ja auch aufgehoben. Zusammenfassung: Vermenschlichungen oder Vergöttlichungen im Alten Testament sind an der Tagesordnung und teilweise religionshybride Produkte. Die Fähigkeit des Menschen alles lieben und sich einbilden zu können, ist ihm zu eigen. Es ist etwas Menschliches, wenn jemand sich etwas „macht“, um es sich vorstellen zu können. Kritisch wird es, wenn der Blick für das Wesentliche verloren geht (gegenseitige Nächstenliebe, Liebe zum Herrn), was in die Kult-Kritik mündet und das Verhältnis von Schuld und Strafe im Alten Testament abgebildet wird. Ohne Liebe untereinander, keine Liebe zu Gott und somit auch Strafe, möglicherweise Vergebung und Reue Gottes.
2. Die Grundkonzepte des Literathons und der Lauf- , Schreib- und Kreativwerksta(d)tt „PoliS“
Der Literathon erscheint als Zeitung im neuen Jahr wahrscheinlich alle 4 Wochen und kann gratis auf der Website, der Startseite heruntergeladen werden. Die Schreibund Kreativwerkstatt „PoliS“ ist im Grunde eine Idee für Kurzvorlesungen zu verschiedenen Themen (Universität, Kunstgalerie), mit einer Bibelschule und einer E-Kirche mit Gottesdiensten.
In meinem Kopf entstehen sehr viele Ideen. Aber ich bin nicht alleine. Wir könnten theoretisch schon ein paar Monate im Voraus das Teezimmer planen, aber das wäre langweilig, sodass ich immer kurz vor dem Teezimmer das nächste Teezimmer danach schon auf der Website ankündige. Aber ich bin auch offen für andere Themen.
Gibt es weitere Themenvorschläge?
Die Geschichte und „Verfassung“ des Literathons und der Polis
Die Geschichte des Literathons beginnt wahrscheinlich schon 2007, als ich ein erstes Buch „Quo vadis Graecus?“ zum Aufstieg einer Arbeiterbewegung in einem fiktiven Griechenland schrieb und nach 4 Jahren, 2011, abschließe und die Chance sehe, nebenberuflich Schriftsteller zu werden. 2012 stehe ich zum ersten Mal bei einer Laufveranstaltung an der Startlinie beim Rostocker Citylauf und laufe freiwillig, neben meinem Shotokan-Training (Träger des 6. Kyu-Gürtels), das ich 2015 beende. 2014 und 2015 begegnet mir die Idee mit den Besinnungshalten in Seminaren zum Thema „Lebenskunst“ und „Reise". Im November 2016 wird die Idee in einem Seminar „Erfolgsfaktoren Beruflicher Selbständigkeit“ an der Universität Rostock genannt, konnte mich aber noch nicht durchsetzen, einen Eigenverlag „PoliS“ zu gründen und dann anfange das alleine umzusetzen. Dabei entstehen die ersten Schriften in einem Schriftenverzeichnis. Im Dezember 2018 entsteht durch die Erfahrungen mit Blogs, die verschiedene Themen behandeln (z.B. Laufen und Ernährung), der Literathon und die Schreib- und Kreativwerksta(d)tt „PoliS". Der Geburtstag des Literathons ist der 1. Dezember 2018. Von 2018 - 2019 entstehen erste Laufveranstaltungen (Adventskalender-Laufstreak, Halbmarathon in den Mai). Das erste Jahrbuch erscheint 2020 - „Auf Entdeckungslaufreise". Anfang 2020 konstituiert sich der Literathon neu und reformiert sich selbst und soll ein nebenberufliches Unternehmen werden.
Am 2. April 2020 erfolgt die Gründung und der Baubeginn des virtuellen „Fernsehstudios“ auf dem YouTube-Kanal: Es ist das Fernsehstudio des Literathons. Hier wird (fast) alles abgedreht. Die Kreativwerksta(d)tt nimmt nun wirklich Formen an. Das Fernsehzentrum nimmt eine zentrale Stellung ein. Die Bauzeit beträgt 3 Monate, doch werden die einzelnen Studios und Teile der Stadt nach und nach gebaut, da der Sendebetrieb schon vor der Einweihung aufgenommen wird, was bei Minecraft18 oder in anderen Fiktionen sicher ein Vorteil ist, da sie die Naturgesetze umgehen, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich habe mich sehr über die Idee gefreut. Die Kamera auf dem Laptop funktioniert auch, um die anderen Funktionen des Computers zu nutzen. Es gibt aber noch Probleme zu lösen, wie z.B. die notwendige, absolute Studio-Stille, um saubere Aufnahmen zu machen. Auch bin ich nicht sicher, ob Heil in einer virtuellen Kirche wirken kann. Pro Woche gibt es maximal 5 Sendeplätze (mit 10-15 Minuten Sendezeit oder weniger) und mindestens 3 Sendeplätze, die auch mit anderen Ideen gefüllt werden können. Dafür bin ich gerne offen, für Vorschläge.
Aus meiner Sicht ist es ein Gebäude der Superlative mit einem Audimax, in dem vielleicht 15-18000 Studenten Platz haben (wenn man nach der Anzahl der Würfel geht) und vielleicht der größte, virtuelle Hörsaal der Welt. Das ist mehr als die Uni Rostock an Studenten hat. (Fast) jeden Sonntag veröffentliche ich hier auch eine Losungsauslegung, eine Predigt, einen (christlichen) Gedanken als Teil der digitalen Kirche, die Ausdruck des Priestertums aller Gläubigen ist. Die BLITH(E) ist die Bürgeruniversität des Literathons. „Blithe“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie "unbeschwert", „unbekümmert", „fröhlich", „heiter", also alles sehr positive Adjektive. Das soll diese Universität sein, etwas Unbeschwertes, wo du fröhlich und gebildet hinaus gehen beziehungsweise laufen kannst. Es besteht kein Zwang. Alles ist freiwillig, wie im Studium auch, wo du dich selbst organisieren musst, um erfolgreich zu sein. Bürgeruniversitäten haben die Aufgabe, möglichst weite Teile der Bevölkerung für akademische Themen zu begeistern. Sie gehen daher weiter als Volkshochschulen. Aber beide dienen der Weiterbildung und dem lebenslangen Lernen. Ich werde hier Vorträge und Vorlesungen, sowie Seminare und Übungen (als Video) veröffentlichen. Themen sind sowohl der Laufsport als auch das weite Feld der Philosophie und der Theologie, die sehr interdisziplinär arbeiten. Themen sind daher unerschöpflich, da immer neue Vernetzungen und Übertragungen älterer Theorie auf neue Praxisherausforderungen möglich sind.
Weitere Gebäudeideen und -pläne und Buchprojekte
Das sind z.B. verschönerte, sozialistische Platten- und Wohnungsbauten im Stile der Hängenden Gärten von Babylon. Vorbild sind die treppenähnlichen Plattenbauten in Rostock beim Hauptbahnhof, deren Bewohner die Balkons sehr begrünt haben. Dann gibt es das Laufstadion als Mittelpunkt sportlicher Ertüchtigung, um die drei möglichen, virtuellen Disziplinen (Boot fahren, Laufen und Gymnastik) in dieser Kulisse anzubieten. Alles andere ist zu aufwändig und auch zu gefährlich und im eigenen Zimmer kaum umzusetzen (z.B. ein Speerwurf). Dann gibt es die Idee des Obeliskenparks mit einzelnen Kleinwäldern und riesigen Obelisken, die in die Luft ragen. Jetzt zu den Buchideen und eine Vorstellung des geplanten Gesamtwerks. Küstermord: Ein kaltblütiger Mord oder ein grausamer Selbstmord erschüttert eine Kirchengemeinde in der Nähe von Stralsund in Vorpommern. Der neu eingeführte Küster „Herr Kunz“ wird vor einem Gottesdienst auf der halben Turmebene blutüberströmt und am Glockenseil aufgehängt gefunden. Zuvor gab es eine Morddrohung, aber gleichzeitig wird ein Abschiedsbrief gefunden. Die Polizei tappt im Dunkeln. Es gibt keine Spuren für ein Gewaltverbrechen. Der dortige Pfarrer Kehrling geht dem Fall nach, reist nach Schweden, durchleuchtet Archivmaterial aus der Geschichte der Kirchengemeinde und findet Brisantes, dass einige Mitglieder des Kirchengemeinderates einer Gruppe angehören, die einen geheimen Kult betreiben. Doch niemand glaubt ihm. Dann geschieht ein zweiter Mord. Der Kirchengemeinderat möchte den Schnüffler-Pfarrer los werden, dem ein Amtsenthebungsverfahren droht und in einem zweiten Fall auf die Insel Rügen strafversetzt wird. Aus der Demut zur Freiheit und Liebe Gottes: Dieser Sammelband von persönlichen Dokumenten aus dem Theologiestudium in den Jahren 2011 - 2018 ist gleichzeitig eine Einführung in das Theologiestudium. Meditationen, Zusammenfassungen, Textwerkstätten, Predigten und vieles mehr enthält diese Sammlung. Die Texte und Methoden werden kommentiert, erklärt und vor allem die selbstkritische Auseinandersetzung mit eigenen Texten ist ein Kernelement. Kritikfähigkeit und das autodidaktische Lernen werden auf frühere Texte angewendet, die nicht verändert werden, um den Lernprozess aus Altem und Neuem darzustellen. Gebet und Hoffnung auf Erfüllung: Kann, muss oder soll ich beten? Diese Frage möchte die Antwort des offenen Gebetes beantworten. Zwischen der Gebetstheorie und praktischer Beispiele befinden sich die weißen Seiten der Offenheit, auf denen man das Buch nach der Inspiration mit eigenen Gebeten weiterschreiben kann, z.B. in einer Laufpause, wo Zeit für ein Sitzen auf einer Bank im Wald, in der Stadt und so weiter bleibt, um einen Laufmehrwert zu haben. Das Buch wird mit den Hausgottesdienstentwürfen zusammen veröffentlicht und bietet auch in diese praktisch-theologische Praxis eine Einführung. Die Polis war im antiken Griechenland ein autonomer Stadtstaat mit einem Stadtgebiet und einem umliegenden Land, ähnlich wie die Städte Bremen, Hamburg oder Berlin. Beispiele für antike Städte sind Athen oder Sparta. Doch hier geht es mehr um die Stadt als Werkstadt mit verschiedenen Ebenen und Gebäuden, die systematisch und gemeinsam zusammenarbeiten. Hier auf der Website ist sie eher ein imaginäres Gebilde. Sobald du die Website als Läufer betrittst, bist du in der Stadt und kannst einen Besinnungshalt einlegen. Der Umgang mit Fremden war auch in der Antike wichtig. Der Fremde war zugleich ein Gast (griech. xenos), den man in sein Haus einlud, was zum guten Umgangston gehörte. Weitere Grundkonzepte: In der digitalen Kirche erstelle ich Musik- und Hördateien für verschiedene Gottesdienstformen, Andachten und Kasualien, wie z.B. Konfirmation oder Taufe. Diese können auf die Lauftour mitgenommen werden, um sie bei einem Besinnungshalt für sich abzuspielen. Daneben besteht sicher auch die Möglichkeit, dass ich öffentlich als weltlicher Redner oder Prediger bei einer Veranstaltung auftreten kann, Hochzeiten, Beerdigungen, wenn das gewünscht wird. Da bin ich offen, auch für neue Methoden, z.B. Laufschuhe als Erinnerungsstücke am Grab eines Läufers, der seine Identität behalten möchte, auch über den Regenbogen hinweg. Oder wenn jemand eine Andacht oder Predigt zu einem Thema oder bestimmten Tag geschrieben haben möchte, ist das auch möglich. Im Film- und Musikstudio erstelle ich kurze Filme und Musiktitel zu verschiedenen Themen und das literarische Teezimmer, das zugleich ein Parlament und eine Teeküche ist, wo Entscheidungen für die Website getroffen werden oder Teerezepte erstellt werden.
Der neue Fokus im Jahr 2020
Ein neues Jahr hat begonnen. Der Literathon geht in das zweite Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu! Daher habe ich mich dazu entschlossen, sein Konzept und die Angebote zu fokussieren und zu aktualisieren.
1. Der Kern - Der Dialog zwischen Theologie und Philosophie in Form des literarischen Teezimmers und der digitalen Kirche und zwischen Christen und Nicht-Christen
In erster Linie ist der Literathon ein Diskussionsforum (wie im antiken Griechenland auf der agora, dem zentralen Marktplatz einer Stadt beziehungsweise polis, zu dem und zu der alle Straßen hin führen) über philosophische Allerweltsthemen und eine Art „Ruhepol“ durch wöchentliche Andachten und christliche Angebote. Ich bin nicht nur Theologe, sondern auch Ethiker und daran interessiert, solche Themen plausibel und anschaulich zu gestalten und an „weltlichen“ Themen interessiert, in einer Zeit, in der Kirche und Religion (vermeintlich) durch die Säkularisierung und die Pluralisierung der Gesellschaft und ihrer Angebote an Bedeutung verlieren. Allein bin ich auf dem Markt der „religiösen Angebote". Ich versuche durch eine Verbindung etwas Neues zu schaffen.
2. Mehr Plausibilität und Einfachheit
Schon allein, dass ich den Text hier größer schreibe, bedeutet, dass es mir um mehr Anschaulichkeit geht. Lange Texte und „Blablas“ sprechen nur wenige Leute an. Kurze Sätze. Keine langen, abstrakten Schachtelsätze mehr. Anschauliche Bilder. Wenige Fremdwörter, außer wenn sie genau erklärt werden. Das ist auch bei der Gestaltung von Predigten für eine Hörergemeinde sehr wichtig.
3. Kostenlose Angebote
Außer den E-Books und den Schreibhilfen, werden sämtliche Angebote kostenlos sein. Die digitale Kirche und das literarische Teezimmer haben immer eine Laufzeit von 10-15 Minuten, da auch in der Praktischen Theologie die „Hörfähigkeit“ beziehungsweise die Zeit, in der ein Mensch (einer Predigt) konzentriert zuhören kann, nicht länger ist. Das war vor 50 bis 100 Jahren noch anders. Da konnten Predigten auch schon mal über eine Stunde dauern, da ein Pfarrer nicht nur ein Prediger war, sondern auch eine Art „Professor“ und Lehrer. Ein Pfarrer trug auch (immer) einen Doktortitel, sodass Vorlesungspult und Kanzel eine Einheit bildeten.
4. Mehr Sport
Der Laufsport, das Wandern, das Flanieren werden dann als System zusammen mit dem literarischen Teezimmer und der digitalen Kirche aktiv. Laufen befreit den Geist, fördert den Ideenreichtum, genauso wie die frische Luft für den Kopf draußen. Kern sind die so genannten Besinnungshalte während der Touren, eben wie das Logo auf der Oberseite der Webseite, die immer präsent ist.
5. Ausbau der Kreativwerksta(d)tt
Wichtig ist auch die Einbindung dieser Konzepte in ein Gesamtkonzept, als eine Art „Über-Sein", in Form der Kreativwerksta(d)tt „PoliS", in der alle diese Konzepte zusammenarbeiten, eben wie in einer Stadt, besonders die Polis im antiken Griechenland. Alle Artikel werden kontinuierlich weiterentwickelt. Doch eine Länge von einer oder zwei A4-Seiten sollten sie nicht überschreiten (Stichwort: Einfachheit). Ein Ziel von mir ist es zu vermitteln, dass jeder Mensch einen Preis oder eine Urkunde verdienen kann. Das ist nicht abhängig von berühmten Oskar-Verleihungen, Weltmeisterschaften oder anderen Wettbewerben, die aber nicht unbedingt auch nicht schlecht sind. Aber wichtig ist das Selbstbewusstsein und seine Stärkung und das jeder ein Gewinner sein kann. Es ist auch nicht das Privileg von Marathon-Weltmeistern und co. Klar, man „giftet“ dabei auch an. Das Schlimmste war einmal, dass man mir Respektlosigkeit vorwarf, obwohl ich nur helfen wollte und mich dafür auch bedankte. Ich plane jetzt mehr Konsequenz ein. Es soll jede Woche ein Teezimmer, eine Andacht und einen Artikel geben. Das klingt nach viel Arbeit, aber eine Routine ist auch im Arbeitsalltag wichtig. Und mir gelingt das immer noch nicht so ganz beziehungsweise gar nicht. Es ist auch nicht immer so leicht, Ideen für Teezimmer zu finden. Drei ist auch eine magische Zahl und sinnvoll. Ich versuche auch dreimal die Woche Sport zu treiben, mindestens eine halbe Stunde oder 10000 Schritte pro Tag. Das ist mein Ziel und Ziele sind auch immer wichtig. Die jeweiligen Videos dauern aber nur 10-15 Minuten, ganz im Sinne der „Hördauerfähigkeit“ von Zuschauern. Das soll kein Vorwurf sein, dass man nicht so lange zuhören kann, aber in der Mehrheit ist die Kommunikationsforschung der Meinung, dass die Hördauerfähigkeit in den letzten Jahrzehnten nachgelassen hat. Dieses wurde von der praktischen Theologie bzw. ihrem Teilgebiet, der Homiletik, der Lehre von der Predigt, bestätigt. Ein Grundsatz dieser Lehre ist die Schaffung und Produktion von „guten“ Predigten. Zeit und Dauer ist dabei ein Aspekt, aber auch z.B. Satzlänge. Ein weiterer Punkt, der auch das neue Jahr 2020 betrifft ist: Die Kreativwerkstadt ist für alle geöffnet. Es gibt keine Klassengesellschaft. Es gibt keine Ernährungsklassen usw. Wer mir etwas anbietet, das nehme ich auch meist an, so lange es mir selbst nicht schadet, ganz im Sinne des Freiheitsverständnisses im Deutschen Grundgesetz z.B., zwischen positiver und negativer Freiheit. Jeder kann seine Freiheit nutzen, solange er dem Anderen nicht schadet oder zu einer Handlung zwingt. Was die weitere Entwicklung des Literathons für das Jahr 2020 angeht, ist zunächst einmal eine „Sortierung“ entscheidend. Jeder Blog-Eintrag wird mit der jeweiligen „Werkstadt“ in der Kreativstadt verbunden und verlinkt, z.B. wurde die Erinnerung des Literathons auf der Seite des Parlaments der PoliS verlinkt, um einen Schnellzugriff zu ermöglichen.
Das pädagogische und theologische Konzept
Mein pädagogisches Handeln im Umgang mit anderen Menschen stützt sich im Grunde auf diese Prinzipien, die Ausdruck in der digitalen Kirche, dem literarischen Teezimmer und den Webinaren finden und im Unterricht.
1. Didaktische Gleichheit beziehungsweise didaktisches Gleichgewicht (nach Wolfgang Klafki)
Das ist sicher das wichtigste Konzept, an dem sich alles orientiert. Ich gehe davon, dass jeder Mensch dieselben Fähigkeiten beziehungsweise dieselben Anlagen hat, ein individuelles Talent zu entwickeln. Zwar hat nicht jeder dieselben Talente, aber eben eins oder mehrere, die ihn besonders machen.
Diese zu wecken und dazu zu ermutigen, ist eine Hauptaufgabe des Literathons. Gleichzeitig soll sich diese auch manifestieren (z.B. in Form eines selbstgeschriebenen Buches, das im Selbstverlag erscheinen kann), um die Pluralität und Vielfältigkeit der Gesellschaft individuell zu erweitern. Jeder hat die Chance, zur „Elite“ zu gehören. Dazu soll ermuntert werden, ein Teil der Optimum-Gesellschaft zu werden, sie aber auch kritisch zu sehen und sich mit seinen individuellen Talenten darin einzufinden. Jedes Talent wird gerühmt, durch die Urkundenwerkstatt, die aber keine Urkundenfälschung betreibt, da eine Verifizierung immer notwendig ist.
Entscheidend ist ein demokratisches Handeln im „Klassenraum“, auch im virtuellen. Dieses Prinzip geht auf
Wolfgang Klafki zurück19, der im Sinne einer didaktischen Gleichheit von der prinzipiellen Gleichheit zwischen Lehrer und Schüler ausgeht. Ein Lehrer kann auch Schüler sein und ein Schüler kann auch Lehrer sein und sich beide Seiten auf diese Weise wechselseitig bedingen.
2. Prinzip der Lebenskunst im Sinne der Montessori- Pädagogik
Die Philosophie der Lebenskunst geht von der prinzipiellen Selbstgestaltung des Lebens des einzelnen Menschen aus und das dieser dafür selbst verantwortlich ist. Diese Philosophie wird durch die Montessori-Pädagogik gestützt, die das „Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe“ anwendet. Ein Lehrer soll einen Schüler anleiten, sich selbst zu helfen und sein Leben zu gestalten.
3. Antiautoritäre Erziehung mit passiver und aktiver Lenkung durch diese und zur Herstellung von individuellen Plausibilitäten
Der Literathon ist eine konfessionslose Website und bietet christliche und nicht-christliche Angebote in Form der digitalen Kirche und des literarischen Teezimmers an, als zwei Eckpunkte. Dazwischen gibt es immer wieder Mischformen, um wechselseitige Plausibilitäten im Sinne von „Aha“-Effekten aufzubauen. Religion verändert ihr Gesicht und äußert sich vielfältig und versteckt in der Gesellschaft. Niemand soll zur Ausübung einer Religion gezwungen werden.
Es geht nicht direkt um eine „Missionierung“, sondern eher um eine passive Mission und Aufklärung über die christlich-abendländische Tradition. Daneben werden weitere Formen von Religion und Konfession in der gesamten Welt behandelt, die Ähnlichkeiten untereinander aufweisen.
Theologisches Konzept
1. Priestertum aller Getauften / Gläubigen
Jeder kann faktisch ein Pastor sein, aber es muss zwischen Profession und Ideal unterschieden werden. Die „Hauskirche“ des Literathons ist eine YouTube-Kirche, mit einer Kanzel, auf der jeder gläubige Christ stehen und verkündigen oder auch das Abendmahl halten kann. Auch Luther war der Meinung, dass jeder gläubige Christ ein Pastor sein „muss“. Entscheidend ist die verantwortungsvolle Kommunikation. Eine solche Tätigkeit setzt eine gewisse Ausbildung in Hinblick auf die Empathie zu Hörern und Zuschauern voraus. Diese Ausbildung wird im Grunde auch von anderen Studiengängen und Ausbildungen geleistet (z.B. Germanistik, Kommunikationswissenschaft und Journalismus), um verantwortungsvoll mithilfe der jeweiligen Kontexte der Hörer über einen Text oder ein anderes Medium zu kommunizieren. Die Inhalte können autodidaktisch oder durch eine ergänzende, theologische Ausbildung nachgeholt werden.
2. Pluralität der Systematischen Theologie - Ethik der Authentizität
Beispielsweise gibt es die Ansicht, dass die „Auferstehung von den Toten durch Jesus Christus“ die eine eschatologische, christliche, Antwort auf das Leben nach dem Tode ist. Aber Eberhard Jüngel20 hat angefragt, ob das noch zeitgemäß ist, weil es viele Menschen gibt, die nicht an ein Weiterleben glauben und daher vielleicht so viel es geht aus dem Leben machen möchten, oder an andere Vorstellungen glauben, wie z.B. Reinkarnation. Der Literathon geht aufgrund seines konfessionslosen Charakters von einer generellen Pluralität aus.
3. Universalität der Liebe Gottes in Hinblick auf atheistischem Theismus
Gott ist in einer Blume, in anderen schönen Dingen, überall kann er begegnen, und Glücksgefühle auslösen. Das ist das Konzept der universellen Lieben Gottes von und zu allen Dingen. Dieses Konzept reicht auch in atheistische Vorstellungen hinein. Wahrscheinlich gibt es auch in anderen quasi-religiösen Vorstellungen gottähnliche Strukturen, auch im vermeintlich „atheistischem“.
Digitale Diktatur?
Ich trete hier in diesem Sinne als ein Anhänger der fiktiven Republik Griechenland auf, wie in „Quo vadis Graecus?“ beschrieben, und muss dafür sorgen, dass sie nicht untergeht. Die Republik Griechenland ist im weiteren Sinn das demokratische Land, in dem man lebt, mit den jeweiligen Gesetzen und Bestimmungen. Es ist daher keine autonome Stadt und kein rechtsfreier Raum, anders als jetzt z.B. in der griechischen Polis, in der jede Stadt ihr eigenes Recht hat.
Andererseits bietet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einen Raum zur Entfaltung von Freiheit, für die man aber selbst verantwortlich ist. Das geschieht hier durch die verantwortungsvolle Kommunikation, der Datenschutzerklärung, dem Impressum, der Einhaltung der Urheberrechte und so weiter und trotzdem ist die Werksta(d)tt auch wieder im weiteren Sinn eine „Diktatur“, wie die von Volgin angestrebt wird, aber er macht es im Sinne einer „Reform“ der geschundenen „Republik Griechenland“, aber letztendlich durch einen Machtausbau seiner selbst. Genau das soll verhindert werden, dass es zu einer Desintegration von Menschen kommt, Barbarei und einem individuellen Machtausbau. Es gilt also, ein Gleichgewicht herzustellen, zwischen kreativer Freiheit und dem Gesetz des Landes, in dem man lebt. So etwas wie Volgin und Alexander dürfen sich im übertragenen Sinn hier in dieser Stadt nicht wiederholen. In den Büchern wird beschrieben, wozu das letztendlich führte, Krieg, Not, Trauer.
Wichtig ist, denke ich, ein Maß zwischen Autorität als Administrator und dem Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen um einen herum. Die Urkundenwerksta(d)tt, der Gedanke der Bürgeruniversität, all das sind kommunistische und egalitäre Ziele, dass jeder denselben Zugang zum Erfolg, zum Glück und zur Bildung haben soll. Das soll den Neid unterbinden. Der Neid kann dadurch auch aktiv bekämpft werden.
Die Klassengesellschaft ist auf diesem Blog aufgehoben, da in der Fiktion jeder Professor, Dozent usw. weiter sein kann, wobei da wieder entscheidend ist, dass z.B. „ungeschützte Berufsbezeichnungen“ verwendet werden sollen, um die Legalität nach Außen zu sichern. Ich bin z.B. Direktor dieses Sendezentrums, habe aber diktatorische Vollmachten in dem Sinne, dass ich z.B. festlegen kann, welche Kommentare zugelassen werden, welche Videos abgedreht werden, und dass nur ich Zugang zum virtuellen Unternehmen habe (es sei denn, es gibt einen HackerAngriff).
Neid fließt in jedem Fall in das Leere, weil ich in der Fiktion nicht aufgehalten werden kann und das ist auch ein Ziel, was ich mir für die anderen Leser wünsche, reale Unmöglichkeiten zumindest in der Fiktion zu überwinden, zwischen zwei Welten zu gehen, aber auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Fiktion kritisch betrachtet wird und sie sich teilweise in die Realität abbildet. Zusammenfassung: Kontrolle der „digitalen Diktatur“ innerhalb der Demokratie geschieht in erster Linie durch einen Selbst und durch die verantwortungsvolle Kommunikation und die Einhaltung der Gesetze des Landes, in dem man lebt.
Eine absolute Freiheit gibt es hier nicht, weil sonst ein Vakuum und ein rechtsfreier Raum entstehen können, die zum Untergang der Demokratie und der Republik führen (im Sinne einer „öffentlichen Sache“), wie z.B. durch Hasskommentare gegenüber Religion, die auf dem Literathon verboten sind. Kritisch-konstruktive Kritik ist dagegen erlaubt.
Das Tri-Konzept
Die Zahl 3 spielt beim Konzept des Literathons eine sehr wichtige Rolle, sie legt gleichzeitig auch Grenzen und Möglichkeiten dieses Konzepts vor. Ich habe auch mal gehört, dass Unternehmen einen Fokus brauchen. Das heißt, nicht so viel und nicht zu wenig Inhalt, der genau aufeinander abgestimmt ist.
1. Das virtuelle und fiktive Sendezentrum als Kulisse und Stadt
2. Reale Bilder und Videos, die in diese Kulissen eingefügt werden (YouTube-Kanal)
3. Texte und Bilder
Es ist eine Mischung zwischen einem analogem und digitalem Konzept, sowie eines fiktiven und realen Konzepts, die alle beide aufeinander abgestimmt werden, um das Tri-Prinzip zu speisen und zu unterstützen.
1. Digitale Kirche
2. Literarisches Teezimmer
3. Sendungen
Das Laufen mit Mehrwert übernimmt, wie im antiken Griechenland oder im Stoa-Glauben, die Funktion eines Logos, der die gesamte Welt durchzieht und so neue Ideen aus der Fiktion wie aus der Realität genommen werden. Logos bedeutet auch „Wort“ und „Rede“, also sollen konkrete Schreibideen entwickelt werden, Worte. Das monatliche Rundschreiben des Literathons sind dann quasi die Leseproben.
1. Krakeln
2. Tippen
3. Entwickeln
Dieses Konzept mündet in die konkrete Entwicklung von Schreib- und Buchideen, hier in Form des „Krakelns“, das heißt, dass man immer ein Notizbuch bei sich tragen soll, auch während des Laufens und während eines Besinnungshaltes auf dieser Tour, um die Ideen aus dem „befreiten Geist“ heraus zu entwickeln. Dann geht es darum, diese Notizen abzutippen, auf dem Computer, und gegebenenfalls weiterzuentwickeln und daraus ein konkretes Buch mit drei oder mehreren Abschnitten zu entwickeln. Das Tri-Konzept sorgt dafür, dass die Stadt und der Einzelne nicht überlastet und gleichzeitig auch gefordert werden können.
Die Zahl 5 ist immer so eine Begrenzung der Stadt und ihrer Gebäude. Ich versuche mich auf die wesentlichen Aspekte zu beschränken, also nur maximal 5 Sendeplätze pro Woche. Dann gibt es Instagram, Twitter, Strava, YouTube und Facebook als höchste Begrenzung für soziale Netzwerke und Kanäle usw., wo die „Gemeindemitglieder“ herkommen.
Ist dieses Konzept sinnvoll und durchdacht? Wo sind Grenzen und Möglichkeiten dieses Konzepts? Gibt es weitere Vorschläge und Ideen?
3. Kunstprojekte21
Die Herrenanlage aus Minecraft
Das Herrenhaus aus Resident Evil (1996 / 1998) kennen sicher alle. Ich hatte 2017 versucht, das Gebäude und die Anlage (Herrenhaus, Garten und unterirdische Anlage, Labor, Residenz und Schlafräume) nachzubauen und dabei entstand etwas Neues und wahrscheinlich auch Einzigartiges, z.B. dass das Labor mit einem Wasser-MagmaGemisch mit Strom versorgt wird, oder dass ein gigantisches Blocklabor entstand. Im Grunde habe ich aber vieles so gelassen, wie im Spiel. Es gibt eine gigantische Pflanze, einen Wassertank zur Versorgung dieser und anderes. Viel entscheidender ist noch, dass ich die Kontraste stärker gesetzt habe. Es gab in dem Haus auch heilige Räume, die aber in einem scharfen Kontrast zu diesen „Forschungen“ stehen, z.B. wenn ich jetzt eine Kapelle in der Anlage einbaue. Der Zugang zu dem Labor ist streng reglementiert. Es liegt unter einem geheimen Brunnen. Niemand würde ahnen, was sich wirklich hinter oder besser gesagt unter diesem Haus abspielt. Dabei interessierte mich im Nachhinein die praktisch-philosophische Perspektive auf das Thema der Wissenschafts- und Bioethik. Das heißt u.a.: Welche Dinge dürfen erforscht werden, damit sie der Menschheit nicht schaden? Wo liegen die Grenzen der Forschung? Was hat das für Konsequenzen in Hinblick auf Moral, Konfessionszugehörigkeit usw.? Den Umgang mit Biowaffen und seine Legitimierung gab es schon zwischen den Weltkriegen, aber in einer anderen, „milderen Form“. Die Genfer Konvention regelte u.a. den Umgang mit Biowaffen (z.B. Gaswaffen, die in der Schlacht von Verdun eingesetzt wurden). Auch schon im Mittelalter gab es Biowaffen, indem z.B. Hornissennester auf feindliche Truppen geworfen oder Kadaver auf Katapulte geladen wurden und schwere Krankheiten in den Städten auslösten, oder dass z.B. Brunnen vergiftet worden sind, um die Bevölkerung zu demoralisieren. Hier an dieser Stelle wird dieser Umgang anscheinend etwas relativiert. Das heißt: Es gibt immer noch geheime Biowaffenforschungen, trotz der Verbote und Einschränkungen durch Gesetze und Regelungen. Wie z.B. in der Fiktion „Resident Evil“, das in den 1990er Jahren spielt. In dem Computerspiel brach zu Beginn der so genannte T- Virus aus (ein Virus, das abgestorbene Zellen wiederbelebt (auch im noch lebendigen Körper (!), der dann langsam mit spezifischen Symptomen mutiert), das heißt den Tod „auf eine andere Art“ überwindet), an dem die Forscher in einem geheimen Labor unter einem Herrenhaus (das SpencerAnwesen) arbeiteten. Das Virus geriet aber außer Kontrolle und stand wahrscheinlich noch in der Frühphase und die Folgen dieser Fehlentwicklung waren fatal. In Folge dessen wurden sämtliche Mitarbeiter mit diesem Virus verseucht, sowie viele der untersuchten und entwickelten Subjekte brachen aus, die sich in Zombies verwandelten. Aus Raccoon City brachen zwei Teams der S.T.A.R.S. auf, um diesen Fall zu untersuchen. In Wahrheit sollten sie in das Anwesen gelockt werden, damit die Forschungsfirma Umbrella Testergebnisse sammeln konnte, der das Labor gehörte. Aber vielleicht lässt sich dieses Labor ja auch in ein gutes Labor verwandeln? Auch angesichts der Corona-Krise, der vielen Verschwörungstheorien, kann dieses Thema interessant sein. Vielleicht sind wir schon alle „Masken-Zombies“.
Filmprojekt zum Filmwettbewerb der Nordkirche zum Thema „Luther, lass mich auch mal ans Ruder"
Das war der Beitrag zu einem Filmwettbeweb von der Nordkirche, der leider nicht mehr stattfinden konnte, weil 2017 zu wenig Einsendungen eingingen, aber vielleicht findet das Projekt jetzt durch diesen Band Aufmerksamkeit. Es geht darum, dass sich die evangelische Kirche immer wieder reformieren muss, das kein abgeschlossener Prozess ist und das in der Hand des einzelnen Gläubigen liegt, wie die Kirche reformiert wird.22
Der Insel-Hüpfer-Park
Der Insel-Hüpfer-Park (mit einer vorgefertigten Achterbahn) war ein Projekt vom Januar 2018. Das war ein Projekt zu Erstellung einer Parkanlage. Auf der linken Seite gab es den Eingangsbereich mit Geschäften und Kiosks. In Mitte gab es Attraktionen und ein Schwimmbad. Auf der rechten Seite gab es weitere Attraktionen und eine Achterbahn. Der Park hatte eine hohe Beliebtheit und brachte sehr viele Einnahmen.
Grundlage war das Spiel: Rollercoaster Tycoon 3 (von 2004).
2 Den Begriff der Liebe setze ich in Anführungszeichen, weil ich nicht genau sagen kann, ob es sich um „Liebe“ handelt, höchstens um eine Form der besonderen Zuneigung. Auf jeden Fall muss die Zuneigung jeweils skaliert und kritisch betrachtet werden. Es gibt viele Formen von Liebe und Zuneigung. Sie unterscheiden sich untereinander in ihrer Intensität. Die Rede von Gott in Gegenständen existiert schon immer, nur wird sie hier um den Begriff der Zuneigung und des Gefühls ergänzt. Das Forschungsprojekt stammt von 2016 / 2017 und war die Vorbereitung für meine Magister-Arbeit über „Die Entstehung des Trienter Bilderdekretes von 1563. Quellenkontexte in der Ikonen- und Bilderfrömmigkeit.“
3 Viele Wörter beziehungsweise „Fehler“ kennt mein Schreibprogramm nicht und diese Wörter sind auch meistens Neologismen, die eine mehrdeutige, theologischwissenschaftliche Bedeutung haben, die sonst schwer zu umschreiben sind und auch so in der Forschung rezipiert werden.
4 Hertzsch, Selbstverständliche, 1.
5 Engemann, Homiletik, 11.
6 Film unter: https://www.voutube.com/watch?v= h0ozLvUTb0 (zuletzt abgerufen am 14. 6. 20), Neue Impulse Ev. „Gib mir die Welt plus fünf Prozent“.
7 In der Übersetzung Martin Luthers: „mit ihm Lust zu treiben“.
8 Gertz, Grundinformation, 60.
9 Gertz, Grundinformation, 61.
10 Gertz, Grundinformation, 69.
11 Gertz, Grundinformation, 69.
12 Gertz, Grundinformation, 67.
13 Text und Erläuterungen bei: Spitzner, Gerald: Psalm 104 und der Hymnus Echnatons im Vergleich. Frei verfügbar unter: (https://geraldspitzner.wordpress.com/psalm-104/textvergleich-hymnus-des-echnaton-und-psalm-104/ (zuletzt abgerufen am 11. Juni 2020).
14 Gertz, Grundinformation, 70.
15 Beispielbilder von vergöttlichten Objekten: Gertz, Grundinformation, 73-75.
16 Gertz, Grundinformation, 76.
17 Gertz, Grundinformation, 77.
18 Die beschriebenen Bilder von Minecraft in diesem Band, auch bei den Kunstprojekten, gehen auf das gleichnamige Programm von Mojang / Microsoft zurück, mit denen es aber keine Kooperation gibt.
19 Vgl. auch: Klafki, Funkkolleg Erziehungswissenschaft.
20 S. Eberhard Jüngel, Tod, 1971.
21 Für Bilder, für die ich keine Genehmigung erhalten habe, muss ich auf meine Galerie auf der Seite www.der-literathon.iimdofree.com verweisen. Ich kann sie hier nur so als Text beschreiben. Das Bild selbst muss angeschaut werden.
22 Das Bild von der Tür konnte ich mit der jeweiligen Quelle nicht mehr finden. Für Hinweise bei einer Neuauflage bin ich dankbar.