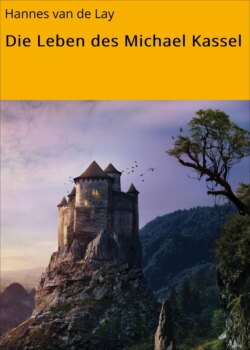Читать книгу Die Leben des Michael Kassel - Hannes van de Lay - Страница 3
1
ОглавлениеIch spürte ein Feuer von ungeheurer Intensität. Von überall her schlugen mir Flammen entgegen, züngelten um meinen Körper und griffen nach mir. Ich fühlte schneidende Hitze auf der Haut, die sich wie ein Flächenbrand weiterfraß, um sich dann plötzlich in meinem Kopf zu konzentrieren. Er schien erfüllt von einem lodernden und knisternden Inferno. Erst als ich mühsam die Augen aufschlug, begann die Hitze langsam abzuschwellen.
Was für ein Traum, dachte ich, an die makellos weiße Decke starrend. Doch bereits einen Augenblick später überkamen mich wieder die Schmerzen, die mich zuvor schon gequält hatten. Nicht so stark wie noch vor einigen Sekunden, aber sie waren dennoch da und griffen nach mir mit pulsierender Pein. Es schien fast so, als wollte mein Kopf jeden Moment zerbersten. Ich hatte Mühe mich zu konzentrieren, darüber nachzudenken, wo ich mich befand. Doch dass etwas nicht in Ordnung sein konnte, war mir bewusst.
Nur ganz langsam wichen die Schmerzen und ließen mir etwas Freiraum zum Nachdenken. Ich ließ die Blicke über die Decke gleiten bis an die Wand zu meiner Linken. Als ich den Kopf drehen wollte, bemerkte ich, dass dieser verbunden war. Ein kräftig angelegter Verband verdeckte wohl den größten Teil meines Gesichts. Mir schien auch, als steckte irgendetwas in meiner Nase, das bis hinunter in den Rachen reichte. Völlig sicher war ich mir nicht, da mein Körper weitgehend taub zu sein schien. Es mochte sein, dass es nur eine Schwellung war, die ich dort im Hals spürte.
Doch als ich endlich den Kopf gedreht hatte, starrte ich wiederum nur auf Weiß. Hell und steril hüllte mich das Zimmer ein und mir wurde bewusst, dass ich mich in einem Hospital befand.
Aber was war geschehen? Ich hatte keine Erinnerung daran und je öfter ich darüber nachdachte, was passiert sein konnte, desto brennender war der Schmerz in meinem Kopf. Resigniert schloss ich die Augen und ergab mich diesem Brennen.
Plötzlich vernahm ich ein Geräusch und ich drehte meinen Kopf schnellstmöglich - mir kam es jedoch wie eine Ewigkeit vor - in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Ich sah, dass die Tür offen stand und eine Schwester rückwärts ins Zimmer kam. Sie zog einen fahrbaren Teewagen hinter sich her. Vorsichtig manövrierte sie ihn durch die Türöffnung, wohl um mich so wenig wie möglich zu stören. Ich betrachtete ihr langes blondes Haar, das zu einem Zopf geflochten war, der bei jeder abrupten Kopfbewegung von Schulter zu Schulter schwang. Die blauweiße Schwesternkleidung saß wie angegossen und betonte ihre hübschen weiblichen Formen.
Als sie den Wagen ins Zimmer gezogen hatte, drehte sie sich zu mir um.
Sie mochte Anfang zwanzig sein. Mir fielen ihre geröteten Wangen und eine Haarsträhne auf, die sich aus der Frisur gestohlen hatte und ihr nun in die Stirn hing. Doch da war noch etwas, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Diese großen Augen, die kaum ihre Verblüffung verbergen konnten, als sie mich völlig perplex anblickte.
Mein Verstand funktionierte immer noch nicht richtig, wie mir schien, denn ich begriff absolut nicht, weshalb sie plötzlich aus dem Raum rannte.
Ich hörte sie draußen den Flur entlanglaufen und nach jemandem rufen, doch ich konnte die Worte nicht verstehen.
Was war hier los? Was war geschehen? Je mehr ich mich bemühte, das alles zu begreifen, desto deutlicher fühlte ich diese Anstrengung in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, er müsste gleich platzen. Dann, so fürchtete ich, würde alles, was sich an vorläufiger Orientierung darin befand, verpuffen, als hätte es nicht existiert.
Dieser Gedankengang enthielt etwas Erschreckendes. Nicht existiert! Ich existierte und fühlte mich doch zugleich wie ausgelöscht. Was hatte ich hier zu suchen? Keine Antwort. Verzweiflung machte sich in mir breit und drohte mich in einen tiefen Abgrund zu reißen. Ich suchte nach einem Halt und rief mir das Bild der Schwester vor mein geistiges Auge zurück, die Erinnerung an die erste Person, die ich seit meinem, ja, … seit meinem… ja, was eigentlich? Unfall, Krankheit, ich wusste es einfach nicht, gesehen hatte. Ich versuchte mich auf sie zu konzentrieren. Sie würde bestimmt gleich wiederkommen, denn der Teewagen stand noch immer mitten im Raum und da gehörte er nicht hin. Was für ein blödsinniger Gedanke, sagte ich mir selbst. Ich war wohl verrückt, vielleicht war das die Erklärung für das Durcheinander in meinem Kopf.
Die Schwester. Sofort hatte ich ihr Bild wieder vor Augen. Also war doch da oben noch etwas heil geblieben, schlussfolgerte ich. Wie sie wohl hieß, dachte ich und ärgerte mich, dass ich nicht auf das Namensschild gesehen hatte, als sie eben vor mir stand. Sie hatte bestimmt auch einen hübschen Namen! Doch schon wieder erfasste mich eine tiefe Panik. Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich mit der Frage nach ihrem Namen etwas zu verdrängen versuchte, nämlich die Frage: Wer war ich selbst? Und wie hieß eigentlich ich? Ich wusste es nicht. Jeder Gedankenvorstoß traf auf eine unüberwindliche Barriere.
Ich hatte nicht die leiseste Vorstellung, wer ich war. Ich wusste nichts von meiner Vergangenheit. Erst seit meinem Erwachen registrierte ich das Leben. Es war so, als wäre ich gerade erst geboren.
Noch einmal zwang ich meine Gedanken, nach meiner Identität zu forschen, doch in meinem Kopf herrschte eine beängstigende Leere, und je mehr ich mich anstrengte, desto mehr nahm der Druck in meinem Schädel zu. Aber es war unmöglich aufzugeben, ich musste weitermachen, musste weiter darüber nachdenken, wer ich war, wer ich sein könnte. Plötzlich bemerkte ich, dass ich vor Kopfschmerzen schrie. Erschrocken hielt ich inne und versuchte den Schmerz zu unterdrücken. Mein Blick fiel wieder auf den Teewagen. Zu sehen, dass er noch mitten im Raum stand, und zu wissen, dass daher die Schwester sicher gleich wiederkommen würde, gab mir irgendwie Trost.
Plötzlich hörte ich Schritte und meine Blicke flogen in Richtung der offenen Tür.
Ein Arzt im weißem Kittel trat ein, gefolgt von der Schwester, die den Teewagen gebracht hatte.
Der Mann hatte graues Haar. Sein faltiges Gesicht zierte eine Benjamin-Franklin-Brille, über die er mit seinen stahlblauen Augen blickte. Langsamen Schrittes näherte er sich und gab mir so das Gefühl, als könne er das, was er zu sehen erwartete, kaum glauben. Doch dann fiel plötzlich die Zurückhaltung von ihm ab und ein Lächeln trat auf seine Lippen, als er einen Stuhl an mein Bett zog und sich zu mir setzte.
»Ich heiße Dr. Gajewski. Wie fühlen Sie sich?«
Seine Stimme überraschte mich, sie passte nicht zu ihm. Sie wirkte erstaunlich jung für sein Alter.
»Was ist passiert?« Meine Stimme klang heiser, sie war belegt und ich begann mich zu räuspern, was schließlich in ein Husten umschwang. Mir kam es vor, als hätte ich eine Ewigkeit nicht mehr gesprochen.
»Nur die Ruhe!« Dr. Gajewski tätschelte mir den Arm, er schien meinen Gemütszustand zu begreifen. »Sie sind nach einem Autounfall zu uns gekommen.«
»Nach einem Autounfall?«, krächzte ich. Wenn noch ein Funken Hoffnung in mir gewesen war, mich vielleicht zu erinnern, sobald mich jemand auf die Vergangenheit stoßen würde, so war dieser spätestens jetzt erloschen. In meinem Gedächtnis existierte weder ein Bild von einem Auto noch die Erinnerung an einen Unfall.
Schweigend sah der Arzt mich an.
»Ich kann mich nicht erinnern«, flüsterte ich, da meine Stimme noch immer nicht zurückgekehrt war.
»Beruhigen Sie sich«, sagte er und musterte mit kurzem, geschultem Blick meinen Gesichtsverband. »Es kommt öfter vor, dass bei Kopfverletzungen Erinnerungslücken auftreten.«
Erinnerungslücken? Wovon redete der Mann? Lücken? Ich hatte meine Erinnerungen vollkommen verloren. Mit Lücken hätte ich im Moment gut leben können.
»Ich kann mich an gar nichts erinnern!«, brachte ich hervor. Die Panik und Wut, die ich fühlte, ließen meine Stimme fester klingen. Jedoch machte mir irgendetwas im Hals Schwierigkeiten. Dann begriff ich plötzlich, dass es der Schlauch einer Magensonde oder etwas Ähnliches sein musste.
Dr. Gajewski ignorierte meinen Gefühlsausbruch. »Wie ich schon sagte«, wiederholte er sich mit nüchterner Freundlichkeit, »kommt eine vorläufige Amnesie bei Kopfverletzungen häufiger vor. Das wird sich mit der Zeit wieder geben.«
Sollte ich ihm das glauben? Irgendwo in meinem Hirn tat sich ein Spalt der Erinnerung auf und es schien mir, dass ich davon schon einmal gehört hatte, aber das konnte auch alles Einbildung sein. Ich war einfach nur verwirrt.
»Was ist passiert?«, fragte ich den Arzt abermals. Der Doktor begann sich das Kinn zu reiben und rückte schließlich die Brille zurecht. »Sie sind ein ungewöhnlicher Fall.« Er machte eine Pause. Das ging mir alles zu langsam. Ich hätte gerne nachgeholfen, so begierig war ich, mehr über meinen „ungewöhnlichen Fall“ zu erfahren.
»Können Sie mir Ihren Namen sagen?« Nun war die Katze aus dem Sack: Der Mann in Weiß wusste nicht viel mehr als ich auch!
»Und Sie? Können Sie ihn mir sagen?«, entgegnete ich ihm etwas bissig.
Anstatt Ärger trat ein verständnisvolles Lächeln in sein Gesicht und sein Blick gab mir irgendwie Trost.
»Ich kann mir vorstellen, wie Sie sich fühlen. Sie sind verunsichert und Sie haben keine Ahnung, warum Sie überhaupt hier sind. Ich will versuchen Ihnen zu helfen. Beginnen wir damit, dass ich Ihnen erzähle, was ich weiß.«
Um ihn bloß nicht aufzuhalten, schwieg ich und sah ihn erwartungsvoll an. Er rückte seine Brille zurecht und räusperte sich.
»Vor knapp vier Monaten wurden Sie mit starken Verbrennungen im Gesicht und unzähligen Prellungen hier bei uns ins St. Michael Hospital in Kassel eingeliefert. Der Grund Ihrer Verletzungen war ein Autounfall auf der A 49, einige Kilometer vor Kassel. Sie können von Glück sagen, dass Sie mit dem Leben davongekommen sind. Es grenzt fast an ein Wunder.«
Dr. Gajewski machte eine Pause und sah mich an. Er beobachtete, wie ich es aufnahm.
Ich hörte seinem Monolog mit einer Gelassenheit zu, als wäre nicht ich die Person, über die da gesprochen wurde. Erst als ich mich zwang, diese Geschichte so zu akzeptieren - was blieb mir auch anderes übrig, außerdem klang sie wahrheitsgetreu - erst da stellten sich allmählich Emotionen bei mir ein. Vier Monate ohne Bewusstsein, dachte ich.
»Im Koma?«, murmelte ich vor mich hin und starrte zur Decke.
»Ja, Ihre Kopfverletzungen hatten diesen Zustand ausgelöst. Aber machen Sie sich deshalb keine Sorgen mehr. Sie sind auf dem Wege der Besserung.« Der Arzt tätschelte mir abermals den Arm, wohl um mir Mut zu machen, dann sagte er irgendetwas von … Ruhe, ich bräuchte noch etwas Ruhe … wir könnten uns morgen weiter unterhalten … bis dann also … Er verließ mit der Schwester den Raum.
Ich reagierte nicht, konnte nichts sagen, ich war zu sehr mit meinen Gedanken beschäftigt. Es gab bedeutendere Dinge, über die ich nachsinnen musste, als diesen Doktor zu verabschieden.
Koma, ein Wort, das ich kannte. Es war offensichtlich aktiver Bestandteil meines Sprachschatzes. Ich wusste jedenfalls etwas damit anzufangen.
Vier Monate hatte ich einfach dahinvegetiert und konnte von Glück reden, dass dieser Zustand nicht ewig angehalten hatte. Aber plötzlich schoss mir ein aberwitziger Gedanke durch den Kopf: Was war, wenn ich immer noch im Koma lag und das hier nur Gespinste eines geplagten und erschütterten Gehirns waren!
Angestrengt versuchte ich, meinen rechten Arm zu bewegen. Kraftlos schien er neben mir zu liegen und nur mühsam gehorchten die Muskeln meinem Befehl. Doch dann bewegte er sich langsam zu meinem Gesicht. Es geschah wie in Zeitlupe, wie im Traum. Ich brauchte Gewissheit, ob dies die Realität war. Meine Finger tasteten sich vor bis zum Schlauch der Magensonde. Leicht zog ich an ihm, aber es rührte sich nichts. Dann fühlte ich den Klebstreifen, mit dem der Schlauch an dem Verband befestigt war, und ich begann ihn zu lösen. Abermals zog ich leicht an dem Schlauch und dieses Mal bewegte er sich. Ich spürte einen geringen Schmerz in meiner Nase und das genügte mir. Vorsichtig schob ich den Schlauch zurück und befestigte ihn wieder mit dem Klebstreifen. Ich war wach, konnte nur wach sein. Das schien mir nun gewiss.
Dieser Schmerz war real gewesen. In Träumen kam Schmerz so konkret nicht vor, das wusste ich. Woher? Einige grundsätzliche Erinnerungen waren mir wohl geblieben und doch war ich voller Zweifel. Immer neue Gedanken und Überlegungen kreisten durch mein Gehirn – ohne jedes Ergebnis. Die Zeit musste Aufschluss bringen, sagte ich mir, und schloss mich damit Dr. Gajewski an. ‚Erinnerungslücken kommen bei Kopfverletzungen häufiger vor.’ Na schön, es würde sich also alles aufklären. Doch dann bedrängte mich eine andere Stimme, die mir sagte: Wer weiß, ob es sich jemals aufklären wird. Und vielleicht willst du es ja gar nicht. Vielleicht würdest du gar nicht vermissen, was du vergessen hast. Stimmen über Stimmen drangen auf mich ein und fast glaubte ich, dass ich nicht nur an Amnesie, sondern auch an Schizophrenie litt. Ich atmete tief durch und versuchte mich abzulenken. Diese verdammten Stimmen!
Allmählich gelang es mir, mich in den Griff zu bekommen und Ruhe kehrte ein. Ich starrte einfach zur Decke und versuchte an nichts zu denken. Wie durch ein Wunder funktionierte es und ein friedliches Gefühl erfüllte mich. Ich spürte noch, wie mich eine tiefe Müdigkeit umfing, und schlief ein.
Ich hörte die Wellen, wie sie am steinigen Ufer rieben. Sah den Fluss, der sich durch das Tal schlängelte. Ich sog den Duft von Tannen in mich ein, bis er mich berauschte. Ich genoss den Wein in vollen Zügen und sah die Reben, die ihn hervorgebracht hatten.
Ich war zu Hause. Ein Glücksgefühl! Geborgenheit!
Plötzlich befand ich mich in einem Raum, der aussah wie eine Bibliothek, und ich wusste, dass dieser Raum nur einer von unzähligen Räumen war. Ich war in einer Villa.
Sie war mir vertraut. Aber ein nicht zu beschreibendes Gefühl der Angst lastete schwer auf mir und ich vermochte nicht es abzuschütteln. Ich schlich durch die Bibliothek, schaute auf die unzähligen Bücher, die ordentlich in Regalen und Schränken standen. Dann erblickte ich das Fenster, ein riesengroßes Fenster, das gleißendes Licht in den Raum warf, und ich hielt darauf zu. Meine Augen brannten und ich kniff sie zusammen. Dann öffnete ich das Fenster und sah hinaus auf meine Heimatstadt. Wie im Nebel lag sie zu meinen Füßen, nur schemenhaft waren die Häuser zu erkennen. Zunehmend verschwamm das Bild vor meinen schmerzenden Augen..
»Hallo!«, hörte ich eine weibliche Stimme sagen und jemand berührte meine Hand.
Erschreckt schlug ich die Augen auf und sah in das lächelnde Gesicht der Schwester.
Ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, wo ich mich befand.
»Sie haben im Schlaf gestöhnt und Ihren Kopf von einer Seite zur anderen geworfen. Ich hielt es für besser, Sie zu wecken. Außerdem wird Dr. Gajewski gleich nach Ihnen sehen.«
Sie behielt ihr Lächeln auf den Lippen und hätte mein Verband nicht gestört, ich hätte zurückgelächelt, so wohltuend war es.
»Haben Sie schlecht geschlafen?«
»Nein, im Gegenteil«, antwortete ich. »Geschlafen habe ich ausgezeichnet, nur der Traum war etwas merkwürdig.« Meine Stimme hörte sich schon besser an als gestern. Zumindest schien es mir so.
»Wie heißen Sie?«, fragte ich die Schwester und sie zeigte auf ihr Namensschild.
»Ich bin Schwester Judith.«
Wie dumm von mir, dachte ich. »Tut mir Leid, dass ich mich nicht vorstellen kann, aber ich bin inkognito hier.« Ich wunderte mich selbst über meinen schwarzen Humor. Schwester Judith fand meine Bemerkung offensichtlich amüsant. »Nun, dann wollen wir hoffen, dass Sie uns Ihren Namen bald preisgeben.« Sie zog die Bettdecke zurecht, lächelte mir noch einmal zu und verließ das Zimmer.
Es dauerte keine fünf Minuten, bis die Tür schwungvoll aufgestoßen wurde und Dr. Gajewski eintrat. »Guten Morgen, der Herr, und wie geht es uns heute?«
»Besser«, entgegnete ich und es war noch nicht einmal geschwindelt.
Die Depression war von mir abgefallen. Natürlich war ein bitterer Nachgeschmack geblieben und die Verstimmungen würden vielleicht auch zurückkehren, aber im Moment fühlte ich mich einigermaßen gut.
»Das freut mich.« Der Arzt zog einen Stuhl heran und setzte sich. Lächelnd begann er den Gesichtsverband abzutasten. »Den machen wir heute Nachmittag ab!«, stellte er etwas salopp in Aussicht.
»Was ist mit den Verbrennungen?« Ich sah ihn erwartungsvoll an.
Dr. Gajewski hielt meinem Blick stand, nahm jedoch einen tiefen Atemzug, bevor er mir antwortete.
»Nun, Sie haben Verbrennungen dritten Grades erlitten, das heißt, dass eine plastische Deckung notwendig war.«
Er sah mich prüfend an.
»Eine Hauttransplantation?«, fragte ich ihn mit unsicherer Stimme.
»Ja, das ist richtig!« Er begann zu lächeln. »Zu diesem Zweck haben wir einen Hautlappen Ihres linken Oberschenkels verwandt.«
Ich hatte schon einmal von solchen Transplantationen gehört. Irgendwo aus dem Chaos filterte mein Gehirn auch dieses Wissen. Ich wusste auch, dass es sogenannte Schönheitschirurgen gab, welche die wundersamsten Dinge mit einem Skalpell vollbringen konnten.
Aber der Gedanke, dass sich in meinem Gesicht irgendwelche verkohlten Stellen oder riesige Narben kreuz und quer hindurchzogen, machte mir Angst.
Unvermittelt tauchte in mir das Bild eines maskierten Gesichtes auf, eine vage Erinnerung, ja „Phantom der Oper“, so hieß die Gestalt. Vielleicht brauchte auch ich in Zukunft solch eine Maske.
Als hätte Dr. Gajewski meine Gedanken erraten, beugte er sich etwas nach vorne und berührte leicht meinen Arm, um mich zu beruhigen.
»Ich kann mir vorstellen, was jetzt in Ihnen vorgehen mag. Aber glauben Sie mir, wir sind heutzutage in der Lage Hauttransplantationen durchzuführen, bei denen nichts weiter als geringfügige Narben zurückbleiben. Sogar diese verblassen nach einigen Monaten, so dass selbst derjenige, der weiß, wo sie sich befinden, sie nur bei genauem Hinsehen entdecken kann.«
Ich wollte ihm das glauben, allzu gerne wollte ich ihm das glauben und hoffte, er möge Recht haben.
Ich hielt in meinem Gedankengang inne, als ich sah, dass sich sein Gesicht sorgenvoll verdüsterte. »Wir hatten allerdings ein Problem.«
Seine Stimme hörte sich plötzlich ernst an.
»Da wir nicht wussten, wer Sie sind und Sie keinen Ausweis oder Führerschein bei sich hatten, wussten wir somit auch nicht, wie Sie vor dem Unfall aussahen. Jedoch duldeten Ihre Verletzungen keinen Aufschub. So haben wir Ihr Gesicht nach bestem medizinischen Wissen, aber auch ohne eine Vorstellung von Ihrem früheren Aussehen zu haben, operieren müssen. Ich hoffe, dass Sie unsere Entscheidung verstehen. Die Umstände haben uns zu diesem Schritt gezwungen.«
Seine Augen baten um mein Einverständnis.
Ich brauchte einige Minuten um zu begreifen, was das bedeutete. Aber vorerst machte mir diese Ankündigung noch nicht einmal so sehr Kopfzerbrechen, wusste ich doch selbst nicht, wie ich ausgesehen hatte. »Wer weiß, vielleicht sehe ich besser aus als vorher«, antwortete ich. Es sollte ein Scherz sein, klang aber irgendwie unnatürlich. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut.
»Heute Nachmittag wissen wir mehr«, sagte der Doktor und schlug sich mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. Seine Routine war zurückgekehrt. Er stand schwungvoll vom Stuhl auf und gab mir die Hand. »Bis später!«
Ich nickte ihm leicht zu und sah ihm nach, wie er schnellen Schritts den Raum verließ.
Ich war allein. Allein mit mir und meinen Gedanken.
Was würde ich wohl empfinden, wenn ich in den Spiegel sah? Entsetzen? Ekel? Angst vor etwas Fremdem?
Aber vielleicht hatten sie auch ganze Arbeit geleistet, ja vielleicht unterschied sich mein jetziges Gesicht nur unwesentlich von meinem alten. Und vielleicht erkannte ich mich mit ein klein wenig Glück wieder und fand zu meinen Erinnerungen.
Ich gestand mir ein, dass wenig Aussicht auf Erfolg bestand. Aber es war eine Möglichkeit, über die nachzudenken sich lohnte. Ja, es war ein Hoffnungsschimmer. Was wäre jedoch, wenn diese glückliche Wendung nicht einträte?
Was wäre, wenn ich mich nicht erkannte? Was würde sein, wenn mein Gesicht ein ganz anderes als das vorherige wäre? Ich würde dies zwar nicht beurteilen können, geschweige denn mit Sicherheit sagen. Aber rein hypothetisch gesehen: Was wäre dann?
Hatte ich bis dahin noch die Hoffnung, dass mich zumindest jemand wiedererkennen würde, so wäre diese dann erloschen. Ich konnte an meinem besten Freund oder an meiner Frau, wenn ich denn verheiratet war, vorbeimarschieren, ohne dass ich sie oder sie mich erkannten. Keine schöne Aussicht!
Niedergeschlagen schloss ich die Augen. Ein Gefühl tiefer Hoffnungslosigkeit überkam mich. Ich spürte, wie ein leises Schluchzen in mir aufstieg und lauter wurde.
Das Leuchten des üppigen Grüns ließ mich meine Augen zusammenkneifen. Ich war umgeben von unzähligen Weinstöcken, die ordentlich in Reihen standen. Ich roch den würzigen Geruch von reifen Trauben, die mit großer Gier die Sonnenstrahlen aufzusaugen schienen. Langsam schritt ich die Reihen entlang. Sie schienen unendlich zu sein.
Dann plötzlich sah ich ein Haus, verziert mit Erkern und Türmen. Majestätisch lag es auf einem Hügel, umgeben von riesigen Tannen.
Meine Füße führten mich zu ihm hin. Ich verspürte einen Drang in mir, nach Hause zu gehen. Spürte, wie ein Gefühl der Geborgenheit in mir emporstieg. Ich war voller Erwartung. Voller Sehnsucht. Doch plötzlich trübte sich das Bild vom wunderschönen Haus. Es verschwamm immer mehr vor meinen Augen. Ich streckte die Hand aus, als könnte ich es festhalten.
Sekunden später war ich wach. Das Bild des Hauses war nicht ganz verschwunden. Ich spürte noch die innere Bewegung, die der Traum hervorgerufen hatte. Diese Träume hatten etwas Geheimnisvolles an sich und trotzdem riefen sie auch etwas Vertrautes in mir wach. Ein wundervolles Gefühl aus Geborgenheit und Sehnsucht. Ich hatte große Lust noch mehr davon zu kosten.
Waren diese Träume nur Wunschvorstellungen oder gehörten sie zu meiner Vergangenheit? Waren es bloß Hirngespinste oder zeigten sie mir den Weg zu meinem eigentlichen Ich?
Langsam zog ich mich ein wenig nach oben und lehnte meinen verbundenen Kopf an die Rückwand des Bettes. Es war das erste Mal seit meinem Erwachen, dass ich mich aufsetzte.
Mein Kopf schmerzte nach dieser Bewegung ein wenig, beruhigte sich aber gleich wieder.
Dann wurde plötzlich die Tür geöffnet. Dr. Gajewski trat als Erster ein. Gefolgt von Schwester Judith, die einen Rollstuhl vor sich herschob.
Nun war es also soweit, dachte ich. Der aufregende Augenblick war gekommen. Endlich würde ich mich sehen oder das, was von mir übrig geblieben war. Verdammt, ich hatte einfach Angst.
»Nun, der Herr, sind Sie bereit?« Dr. Gajewski lächelte mich an, während er mit einer Handbewegung der Schwester anzeigte, wo sie den Rollstuhl hinstellen sollte.
»Von mir aus kann es losgehen«, antwortete ich ihm betont locker. Doch meine Stimme zitterte.
Sie entfernten die Schläuche der Magensonde und der Infusionsflaschen und halfen mir dann vorsichtig in den Rollstuhl. Die zwei Schritte bis zu meinem Gefährt fielen mir schwer. Ich spürte, wie meine Knie nach vier Monaten Ruhepause schmerzten und meine erschlafften Muskeln vergeblich versuchten das Gewicht meines Körpers zu halten.
Erschöpft sank ich in den Rollstuhl und ließ mich durch den Raum zur Waschecke chauffieren.
Dann nahm die Schwester den Spiegel von der Wand und stellte ihn hochkant auf das Waschbecken, damit ich mich im Sitzen sehen konnte.
Es war das erste Mal seit dem Erwachen, dass ich mich selbst sah.
Ein riesiger weißer Verband umhüllte meinen Kopf. Ich sah aus wie eine Mumie. Und ebenso geheimnisvoll, ja fast beängstigend starrten meine Augen in den Spiegel. Lauernd und durchdringend sahen sie mich an. Funkelnde, dunkelbraune Augen.
Mein Herz schlug schneller. Wovor hatte ich Angst? Es war lächerlich. Das war ich! Ich brauchte keine Angst zu haben!
Mein Blick glitt forschend über den Spiegel. Nun würde sich bald entscheiden, wie ich aussah. Würde sich ein von Narben zerfurchtes Monstergesicht oder das Bild einer Person zeigen, die sich womöglich wieder an sich selbst erinnerte? Vielleicht also die Antwort auf die Frage, wer ich war?
Dr. Gajewski begann den Verband zu lösen. Schicht für Schicht entfernte er von meinem Kopf. Gebannt starrte ich auf die Stellen, die der Verband freigab.
Schwarzes Haar kam zum Vorschein. Ich hatte also schwarzes Haar!
Es war kurz geschnitten und lag teils schweißverklebt am Kopf an, teils stand es ab, als Folge der Ablösung des Verbandes.
Dann fiel mir ein, dass ich mir diese Frage noch gar nicht gestellt hatte. Ich war wohl davon ausgegangen, dass die Haare beim Unfall verbrannt waren. Zum ersten Mal, seit ich vor dem Spiegel saß, brachte ich so etwas wie ein Lächeln zustande.
Der Doktor tat weiter seine Arbeit. Langsam aber stetig gab der abgelöste Verband immer mehr von meinem Gesicht frei.
Die Kinnpartie sah gut aus, als sie zum Vorschein kam. Es waren weder Narben, noch war eine Rötung zu sehen.
Ich hielt den Atem an, als die letzte Schicht, welche die Wangen bedeckte, abgenommen wurde.
Ja, ich hielt ihn sogar so lange an, bis der Doktor sich zu mir hinunterbeugte und mich im Spiegel ansah. Erst dann atmete ich aus.
»Nun?«, fragte er. Aber diese Frage war weit weg und schien aus einer ganz anderen Welt zu mir zu dringen.
Ich betrachtete mein Gesicht. Mein Gesicht? Ich erkannte es nicht, aber es war auch nicht entstellt, wie ich befürchtet hatte. Es sah ganz passabel aus. Der Chirurg hatte ganze Arbeit geleistet und in diesem Moment war ich glücklich.
Vorsichtig drehte ich meinen Kopf in die eine, dann in die andere Richtung. An beiden Kiefergelenken waren leichte Narben zu erkennen, jedoch standen sie in keinem Verhältnis zu den Schreckensbildern, die ich mir noch vor Minuten ausgemalt hatte.
Diese Narben würden sicher noch verblassen, so wie der Doktor es prophezeit hatte.
Eine schwere Last war von mir gefallen. Zumindest sah meine äußere Gestalt wieder menschlich aus.
»Wie fühlen Sie sich?«
Dieses Mal drang die Stimme des Doktors deutlicher an mein Ohr.
»Es ist in Ordnung«, stammelte ich und betrachtete weiter mein Gesicht.
Der Arzt klopfte mir auf die Schulter und begann zu lächeln. Mir entging jedoch nicht sein Aufatmen.
»Ich muss zum nächsten Patienten, Schwester Judith wird sich um Sie kümmern!«
Ich beachtete ihn nicht weiter.
»Soll ich Sie zurück ins Bett bringen?« Schwester Judith ergriff den Rollstuhl.
»Nein, ich würde gerne noch etwas hier bleiben und mich ansehen.«
Dann begann ich zu lächeln und fuhr fort: »Ich habe mich schließlich vier Monate nicht gesehen und Sie wissen wohl, dass es kein eitleres Geschöpf auf Erden gibt als den Mann.«
Sie begann zu lachen. »Ich werde in zehn Minuten noch einmal nach Ihnen sehen.« Dann verschwand sie.
Ich war froh, dass ich die Welt nun schon etwas positiver wahrnehmen konnte, und glücklich darüber, dass ich in ein Gesicht blickte, das nicht entstellt war.
Doch fiel ein Schatten auf dieses momentane Glück: Ich hatte mich nicht wiedererkannt, wusste immer noch nicht, wer ich war. Daran würde ich noch arbeiten müssen, wenn sich irgendwann die Erinnerung wieder einfinden sollte. Würde sie sich wieder einfinden? Der Zweifel nagte in meinem Herzen. Stärker aber war an diesem Tag die Hoffnung.