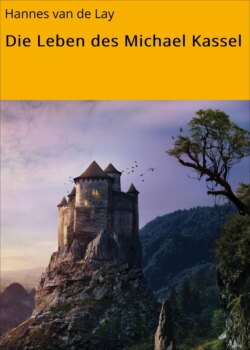Читать книгу Die Leben des Michael Kassel - Hannes van de Lay - Страница 4
2
ОглавлениеVier Wochen waren vergangen. Ich befand mich noch immer im Hospital.
Krankengymnastik stand auf dem Programm, denn meine erschlafften Muskeln benötigten Bewegung, um wieder voll funktionstüchtig zu werden.
Ich hatte keine Gewalt über meinen Körper. Jede kleinste Bewegung verlangte mir eine große Kraftanstrengung ab.
Es machte mir Angst, so hilflos zu sein.
Aber mit der Zeit gewannen meine Muskeln durch das Krafttraining und die Wassergymnastik, die zu dieser Bewegungstherapie gehörten, ihre frühere Leistungsfähigkeit zurück. Bald schon brauchte ich den Rollstuhl nicht mehr und konnte Krücken benutzen.
Es gab mir Mut, mich endlich fortbewegen zu können, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, obwohl ich die Anwesenheit von Schwester Judith, die sich hauptsächlich um mich kümmerte, als sehr angenehm empfand. Sie hatte ein natürliches Wesen, das fast immer Freude am Leben ausstrahlte. Ich glaube, letztendlich war das wohl die erfolgreichste Therapie, die ich erfuhr, auch wenn sie nicht bewusst verordnet worden war.
Die Krücken stellte ich schon bald in die Ecke. Ich tat mich zwar noch ein wenig schwer, so ganz ohne Stütze, und bei einem Hundert-Meter-Lauf würde ich die Nase wohl kaum vorne haben, aber ich konnte mich endlich wieder ohne Hilfsmittel bewegen. Das gab mir Zuversicht. Ich würde mein Schicksal in die Hand nehmen.
Die Gewalt über meinen Körper hatte ich also wiedererlangt. Anders sah das mit meinen Erinnerungen aus. Über meinem Gehirn lag noch immer eine Art Nebel. Ich konnte weder zu dem Unfall noch zu meinem Leben vor dem Unfall durchdringen .
Von Dr. Gajewski hatte ich erfahren, dass der Fahrer des Wagens, in dem ich mich befand, ein Handelsvertreter aus Kassel gewesen war. Er war noch an der Unfallstelle verstorben. Bei mir fand man keine Papiere, die mich ausweisen konnten. Die Polizei, die der Frau des Handelsvertreter dessen Tod mitteilte, befragte sie auch, ob sie denn wüsste, wer mit in dem Wagen gesessen habe. Sie war davon ausgegangen, dass ihr Mann wie immer alleine unterwegs war.
Hier kam ich ins Grübeln. Ich hatte in dem Wagen eines Mannes gesessen, der normalerweise allein unterwegs war. Was hatte ich in dem Auto zu suchen? Und was noch wichtiger war: Wohin war ich unterwegs gewesen? Aber es sollte noch mysteriöser werden.
Während der Zeit, in der ich im Koma lag, hatte die Polizei weiterhin zu ermitteln versucht, wer ich war, um eventuelle Angehörige zu benachrichtigen.
Sie hoffte darauf, dass man mich als vermisst gemeldet hatte, und gab meine Größe, Gewicht und das Alter, das sie zwischen dreißig und fünfunddreißig Jahren schätzte, in ihren Computer ein. Das Ergebnis war gleich null. Entweder vermisste mich niemand oder meinen Angehörigen war es egal, wo ich war.
Die Polizei hatte den Computer mit meinen Fingerabdrücken gefüttert, aber das Ergebnis war ebenfalls negativ. Das war ein kleiner Trost für mich, denn nun wusste ich, dass ich kein Krimineller war, zumindest keiner, den sie schon mal erwischt hatten.
Kurzum, es schien so, als hätte ich niemals existiert. Diese Angelegenheit war mir unheimlich. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Die amtlichen Möglichkeiten schienen erschöpft. Ich musste darauf hoffen, dass mein Gehirn irgendwann zu der Information, wer ich denn nun war, bereit sein würde. Doch im Moment fühlte ich eine große Leere und mir wurde flau im Magen
»Amnesie kommt bei Kopfverletzungen häufiger vor. Sie wird vorübergehen und Sie werden sich wieder erinnern«, hatte der Arzt gesagt. Hoffentlich behielt er Recht.
Um nicht ständig an die Aussichtslosigkeit meiner Situation denken zu müssen, suchte ich Zerstreuung auf den Korridoren und in den Sitzecken.
Ich bat Dr. Gajewski die Kleidung zu besorgen, die ich bei meiner Einlieferung trug, da ich momentan nur die aus dem Krankenhaus anhatte. Nicht nur, dass sie unbequem war, sie vermittelte mir auch das Gefühl von Anstaltskleidung. Ich kam mir wie ein Gefangener vor.
Auch um dieses Gefühl zu mildern, spazierte ich regelmäßig durch die endlos scheinenden Gänge des Krankenhauses. Der Geruch von Desinfektionsmittel lag schwer in der Luft. Überall schwirrten Schwestern durch die Flure. Zielstrebig und meist in großer Eile gingen sie ihrer Arbeit nach.
Es war der vierte Tag ohne Krücken, als mir auf einem meiner Spaziergänge ein Junge auffiel. Er saß teilnahmslos auf einem der vielen Stühle, die in den Fluren vor manchen Zimmern aufgestellt waren. Sein leerer Blick war auf den Fußboden gerichtet.
Er wirkte irgendwie verlassen. Vergessen. Auch er!
An seiner Kleidung erkannte ich, dass er wohl ein Patient war und kein Besucher. Doch etwas war ungewöhnlich an ihm. Eine rotweiße Baseballkappe saß auf seinem Kopf. Sie trug das Vereinswappen von Bayern München.
Ich weiß nicht mehr, was mich letztendlich dazu veranlasste ihn anzusprechen. War es sein trauriger Blick, seine Einsamkeit, die ich spürte? Oder war es einfach nur die Art, wie er die Kappe trug, die mich irritierte?
»Und, werden sie dieses Jahr Deutscher Meister?«
Der Junge sah vom Boden auf und mir in die Augen. Seine Miene blieb unverändert. Er starrte mich nur an. Ich hielt seinem Blick stand.
»Kann schon sein«, entgegnete er mir trocken und sein Kopf senkte sich wieder.
Hier hätte ich eigentlich aufhören können. Der Junge wollte sich nicht unterhalten. Aber irgendwie fühlte ich einen Drang in mir, noch einen Versuch zu starten. »Bist du hier in Behandlung?«
Abermals hob er den Kopf und sein Blick verriet mir, dass ich doch wohl Augen im Kopf hätte und sehen müsste, dass er hier nicht zum Vergnügen saß.
»Ja!«
»Wie heißt du?«, fragte ich ihn unbeholfen.
»Warum wollen Sie das wissen?« Diese Frage war berechtigt. Was tat ich hier eigentlich, fragte ich mich.
»Nun, es gibt Leute, die kennen ihren Namen nicht.«
»Ich kenne meinen!«
»Ich meinen nicht.« Ungewollt schwang in meiner Stimme eine gewisse Hilflosigkeit mit. Aber das war es wohl, was das Eis schmelzen ließ.
»Wie, Sie kennen Ihren Namen nicht?« Der Junge zeigte sichtlich Interesse.
»Ich habe ihn vergessen.«
»Sie wissen nicht, wer Sie sind?«
»Richtig!«
Seine Augen loderten vor Neugier.
»Wie alt bist du?«, fragte ich ihn.
»Neun.«
»Und verrätst du mir jetzt deinen Namen?«
»Axel Behr.«
Ich lächelte ihn an und strich ihm mit der Hand über den Kopf. Dabei verrutschte seine Baseballkappe und fiel zu Boden. Erschrocken starrte ich auf seinen kahlen Schädel, versuchte jedoch mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen.
Mit einem schnellen Griff hatte der Junge sich die Kopfbedeckung geschnappt und wieder aufgesetzt. Seine großen Augen sahen mich vorwurfsvoll an und ich fühlte mich schuldig. Doch bevor ich etwas sagen konnte, trat eine Schwester aus dem Behandlungszimmer und rief Axel herein.
Ich fühlte mich wie ein Trottel.
Langsam stand ich auf und starrte zur Tür, die sich hinter ihm schloss. Ich hatte diesen Jungen verletzt. Nur weil ich dachte, ich müsste ihm Selbstsicherheit vorgaukeln, ihm zeigen, wie toll ich mein Schicksal bewältigen konnte. Das hatte nun wirklich niemandem geholfen.
»Kann ich etwas für Sie tun?«
Es war Schwester Judith, die mich ansprach, aber mein Blick blieb auf die Tür gerichtet.
»Was hat der Junge?« Meine Stimme hörte sich rau an.
Sie legte ihre Hand auf meine Schulter und ich sah sie an.
»Leukämie!«
»Ich bin ein Idiot!«
»Nein, das ist nicht wahr!« Ihre Stimme klang sanft.
»Haben Sie es gesehen?«
»Ja.«
»Dann wissen Sie ja auch, wie dumm ich mich benommen habe.«
»Sie waren vielleicht ein wenig ungeschickt, aber...«
»Nichts aber, ich habe seine Augen gesehen. Er wird mir das nicht verzeihen.«
»Was haben Sie denn gesehen? Ich sah zwar, dass es ihm peinlich war, aber nicht mehr. Sie werden bestimmt noch genügend Gelegenheit haben, mit ihm darüber zu sprechen.«
»Ja«, antwortete ich ihr knapp und sie lächelte mir zu, bevor sie weiter ihrer Arbeit nachging. So stand ich denn da, mitten im Flur. Allein gelassen und mir einer Schuld bewusst, die ich tilgen wollte. Was war schon mein Schicksal gegenüber seinem. Was für ein Recht hatte ich, mich zu bemitleiden. Ich beschloss, ihn am nächsten Tag aufzusuchen und mit ihm zu sprechen.
Niedergeschlagen trottete ich den Flur entlang. Ich wollte nur noch in mein Zimmer. In mein Bett. Ich wollte versuchen ein paar Stunden Ruhe im Schlaf zu finden. Denn nicht nur, dass ich schon so genug Probleme hatte, jetzt schaffte ich sie mir auch noch selbst.
Erstaunt blickte ich vom Fußboden auf, als ich mich vor meinem Zimmer befand. Die Füße hatten von ganz allein den Weg gefunden. Nun, war es denn auch verwunderlich, nach all den Tagen, ja sogar Wochen, die ich jetzt schon durch die Flure streifte. Unausweichlich mit dem Ziel, wieder hier vor dieser Tür zu landen und die Klinke zu drücken.
Wie schon unzählige Male zuvor, so tat ich es auch heute.
Ich staunte nicht schlecht, als ich ins Zimmer trat und im Bett neben mir jemanden liegen sah. Der Mann, Mitte dreißig, hatte rotes Haar. Ein Grinsen lief über sein Gesicht, als er mich hereinkommen sah. Seine gelblichen Zähne passten, wie ich fand, vorzüglich zu seinem Teint. Der Ausdruck seiner himmelblauen Augen dagegen stimmte irgendwie nicht mit seinem Erscheinungsbild überein. Sie wirkten zu brav für sein Aussehen.
Erst dann fiel mir sein nackter Oberkörper auf, der von riesigen Brandnarben verunstaltet war. In langen und breiten Bahnen zogen sie sich über seinen Brustkorb hinweg bis zum Bauchnabel. Unwillkürlich musste ich an die zerfurchte Landschaft des Grand Canyon denken. Eine Sekunde später schämte ich mich für diesen Gedanken. Ich konnte froh sein, dass mir solche Narben erspart geblieben waren.
»Fett!«, sagte er zu mir. Er hatte eine kräftige Stimme.
Sein Anblick verwirrte mich und sein Ausspruch noch mehr. Ich setzte ich ein schiefes, verlegenes Lächeln auf. Die Situation war mir unangenehm. »Wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden«, entgegnete ich.
»Heißes Fett! Sie haben sich doch bestimmt gefragt, woher die Narben sind?« Er grinste immer noch.
Irritiert durch seine Direktheit und durch sein Grinsen, das mir irgendwie unangenehm war, setzte ich mich erst einmal auf mein Bett, bevor ich ihm antwortete. »Um ehrlich zu sein, an so etwas Ähnliches habe ich gedacht.« Ich räusperte mich verlegen.
»Das macht nichts«, erwiderte er lachend und seine Augen musterten mich aufmerksam. »Soll ich Ihnen die Geschichte erzählen?«
Ich weiß nicht, was mich auf diesen Gedanken brachte: Vielleicht war es sein Verhalten, vielleicht auch seine Stimmlage, die mich glauben machen sollte, die Geschich- te wäre amüsant.
»Tun Sie sich keinen Zwang an«, brachte ich heraus und fragte mich insgeheim, was dieser Kerl überhaupt in meinem Zimmer zu suchen hatte.
»Vor ein paar Wochen«, begann er und untermalte seine Worte mit einer großartigen Geste, »da hatten ein paar Kumpels und ich eine Grillparty organisiert. War echt `ne tolle Party, bis halt zu dem Missgeschick.«
›Vorurteile sind die Hemmschwelle zur Toleranz‹, hatte ich irgendwo einmal gelesen. Aber ich konnte nicht anders, dieser Kerl war mir einfach unsympathisch und es wurde nicht besser dadurch, dass er so großspurig sein ›Missgeschick‹ schilderte.
»Nun, Sie wissen ja sicher, wie das auf solchen Partys abläuft. Man wirft den Grill an, legt Fleisch und Würstchen auf und wartet, bis sie gar werden. Natürlich muss man sich die Wartezeit vertreiben und dazu gehört auch ein schön gekühltes Bier. Was soll ich lang drum herum reden. Die Wartezeit war lang und so hatte ich ganz schön einen intus, als ich die Friteuse umwarf. Unglücklicherweise fiel ich mit ihr zu Boden und das heiße Fett und die Pommes platschten auf mich drauf.«
Was war mit diesem Kerl bloß los? Zweifellos hatte er einen schrecklichen Unfall hinter sich, aber wie er diesen Unfall schilderte, das klang so, als sei er auch noch stolz darauf. Na ja, vielleicht war es seine Art, damit fertig zu werden!
»Und soll ich Ihnen noch etwas sagen?« Er stemmte sich langsam im Bett hoch, setzte sich auf die Bettkante und kniff seine Augen zusammen. »Nicht dass sich das Fett in mein Fleisch einbrannte, war das Schlimmste.« Er machte eine Pause und sah mich durchdringend an. »Wissen Sie was?«
Ich zuckte mit den Schultern, da ich keine Lust hatte auf seine Frage zu antworten.
»Das Schlimmste war der Gestank des verbrannten Fleisches.« Er lachte laut auf und warf seinen Kopf dabei in den Nacken. Dann starrte er mich wieder an. »Können Sie das verstehen?«
Ich nickte ihm leicht zu.
Plötzlich stand er auf und reichte mir die Hand. »Wie unhöflich von mir, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Gerhard Schneider.«
Verwirrt schüttelte ich ihm die Hand. Dieser Mann hatte sein Verhalten von einem zum anderen Augenblick vollkommen geändert. Das Grinsen in seinem Gesicht war verschwunden. Es war einem freundlichen Lächeln gewichen.
»Es tut mir Leid, aber ich kenne meinen Namen nicht. Ich habe Amnesie.«
Er sah mich verständnisvoll an und erhöhte für einen kurzen Augenblick den Händedruck, bevor er meine Hand losließ.
»Macht nichts, was sind schon Namen«, sagte er und lockerte damit die gespannte Atmosphäre ein wenig.
»Erlauben Sie mir die Frage«, begann ich zögernd, »aber was machen Sie hier? Warum sind Sie hier in diesem Zimmer?«
»Nun, die Hoteldirektion hat mich vom vierten Stock hierher verlegt.« Mit gesenkter Stimme ergänzte er: »Ich habe mir sagen lassen, das Essen soll hier besser sein.«
Ich taute ein wenig auf und begann ebenfalls zu lächeln. Was für ein komischer Kauz, dachte ich bei mir. Vielleicht war das seine Art. Er sah eben in allem das Positive, und wenn er nun mal Lust hatte, alles eine Nummer größer weiterzugeben, dann sollte er das auch tun dürfen. Ich befand insgeheim, ich könnte ruhig ein wenig toleranter sein.
Dann ging die Tür auf und das Essen wurde serviert. »Aha, der erste Gang«, frohlockte mein Bettnachbar und ich schüttelte flüchtig lächelnd den Kopf.
Später am Abend, die Sonne hatte sich schon hinter dem Horizont verkrochen und der Mond strahlte sein kaltes Licht zum Fenster herein, gingen meine Gedanken erneut auf Wanderschaft. Sie suchten wieder einmal nach meinem Ich, das irgendwo dort draußen seine Spuren hinterlassen haben musste, die nur darauf warteten, von mir gefunden zu werden. Irgendwo gab es vielleicht - nein, bestimmt sogar - einige Menschen, die mich vermissten. Dieser Gedanke bedrückte mich und beschwor ein Gefühl der Hilflosigkeit in mir herauf. Gewiss war die Antwort irgendwo in meinem Kopf verborgen, doch im Moment half alles Forschen nichts. Hingegen wurden im Schlaf immer wieder bruchstückhaft Bilder in mir hochgespült, die ich nicht deuten konnte. Besonders eines war mir noch gegenwärtig.
Die Trommeln klangen beunruhigend und ich spürte ein Beben durch meinen Körper ziehen. Das Wiehern von Pferden und das Schlagen von Hufen mischte sich dem Trommeln bei. Jemand zerrte an mir. Schleifte mich irgendwohin. Panik überkam mich. Was würde geschehen? Was nur würde geschehen ...
Die Bilder verschwammen immer wieder und jeglicher Versuch, sie weiter zu verfolgen, schlug fehl. Welche Wurzeln hatte dieser Angstraum?
Oder war es eine Erinnerung? Was würde noch nach und nach erwachen? Würde ich das Leben vor meinem Unfall je wieder fortführen können oder es überhaupt wollen?
Ein leises Stöhnen riss mich aus meinen Gedanken. Mein Bettnachbar wälzte sich unruhig im Schlaf hin und her. Das fahle Mondlicht verlieh seinem Gesicht fast unheimliche Züge. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn.
Er tat mir Leid, wie er so dalag. Er musste auf seine Weise mit seinem Schicksal fertig werden. So wie ich und wie auch der Junge mit der Baseballmütze. Doch da hatte er sich schon wieder beruhigt. Sein Atem ging langsam und regelmäßig. Meiner auch.
Ich fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
»Hey! Aufwachen, Langschläfer. Die Sonne ist auch schon munter!«
Unwillig öffnete ich die Augen und blickte in das grinsende Gesicht meines Zimmergenossen. Murrend richtete ich mich auf und sah hinaus. Ich kniff die Augen zusammen, da das grelle Licht schmerzte.
»Und, haben Sie gut geschlafen?« Ich drehte mich langsam zu diesem grinsenden Gesicht hin und wollte ihm eigentlich sagen, dass ich gerne weitergeschlafen hätte und mir seine gute Laune ziemlich auf die Nerven ging, wenn nicht in diesem Augenblick die Schwester zur Tür hereingekommen wäre. Sie wünschte uns beiden einen guten Morgen und wandte sich dann der Nervensäge zu, so dass ich fürs Erste wieder meine Ruhe hatte.
Eine Stunde später war ich auf dem Weg zu dem Jungen. Ich hatte mir die Zimmernummer von der Schwester geben lassen.
Mir war ein wenig mulmig zu Mute. Wie würde er reagieren, wenn er mich sah? Egal, sagte ich mir. Lass es einfach auf dich zukommen und mach dich nicht verrückt. Aber das war leichter gesagt als getan und so spürte ich eine gewisse Nervosität, als ich leise an die Zimmertür klopfte.
Es war kein Laut zu vernehmen. Sachte drückte ich die Klinke hinunter und schob den Kopf ins Zimmer. Es war ein kleiner Raum, in dem sich nur ein Bett befand. Vor diesem stand ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Auf einem von ihnen saß der Junge, vor sich ein Schachspiel und ein Buch.
Ich trat ein, doch er schien mich nicht zu bemerken. Er war völlig in sein Spiel vertieft.
Ich schloss leise die Tür hinter mir.
»Axel?« Erschrocken sah der Junge zu mir auf. Sein Blick verriet mir, dass er mich wiedererkannte. Plötzlich wechselte sein Gesichtsausdruck von Erkennen zu Hoffnung.
»Spielen Sie Schach?« Seine Augen leuchteten.
Zweifellos überraschte mich seine Frage. Ich atmete auf, er hatte mir meine Ungeschicklichkeit bei unserer ersten Begegnung wohl nicht übel genommen.
Etwas überrumpelt suchte ich nach einer Antwort. »Ich glaube schon«, sagte ich forsch und setzte mich ihm gegenüber.
Ein breites Lächeln trat auf sein Gesicht und entschlossen schlug er das Buch zu, in dem er gelesen hatte.
»Was ist das?«, fragte ich ihn und deutete auf die Lektüre.
»Die berühmtesten Schachspiele der Großmeister«, erklärte er mir engagiert. »Ich war gerade dabei, ein Spiel zwischen Karpow und Kasparow nachzuspielen.«
Ich sah ihn überrascht an. Dieser Junge schien mir außergewöhnlich.
»Wollen wir ein Spiel machen?« Er sah mich erwartungs- voll an. »Bitte! Hier spielt keiner mit mir Schach und alleine macht es nicht so viel Spaß.«
Er sah mich flehend an und ich nickte ihm lächelnd zu.
»Von mir aus. Erwarte aber nicht zu viel von mir.«
Zügig stellte er die Figuren in die Ausgangspositionen und das Spiel konnte beginnen. Ich war mir im Klaren, dass ich diese Partie wohl verlieren würde, da ich kaum wusste, wie die einzelnen Figuren gezogen wurden, geschweige denn in die Geheimnisse verschiedener Strategien eingeweiht war.
Nach zwölf Zügen war ich schachmatt. Enttäuscht ließ ich mich in den Stuhl zurückfallen. Der Junge grinste.
Meine Niederlage ärgerte mich nicht wirklich, denn das Leuchten in seinen Augen gab mir mehr als jeder Sieg.
»Sie sollten sich das Buch einmal durchlesen!«, meinte er nachsichtig.
»Vielleicht sollte ich das wirklich.« Ich beschäftigte mich ernsthaft mit diesem Gedanken. Denn so eine Schlappe wollte ich nicht unbedingt noch einmal einstecken müssen. Doch eines interessierte mich. »Wo hast du so spielen gelernt?«
Seine Miene wurde ernster und mir schien, als schmerzte ihn die Erinnerung ein wenig. »Unser Heimleiter hat es mir beigebracht.«
Zögernd ging ich darauf ein: »Du wohnst in einem Heim?«
»Ich hab dort gewohnt, bis ich hierher kam.« Seine Augen starrten auf das Schachspiel und er begann mit dem schwarzen König einige Kreise auf dem Brett zu ziehen. Ich schwieg, denn er kämpfte offensichtlich damit, noch etwas sagen zu wollen. »Ich bin ein Waisenkind!« Er sah mich kurz an und führte den schwarzen König nachdenklich zwischen den restlichen Figuren hindurch. Das Ganze war ihm peinlich.
»Na und?«, sagte ich.
Er sah mich erstaunt an. Mein Blick war aufrichtig, meine Bemerkung ehrlich gemeint. Ich wusste in diesem Moment, dass auch er das erkannte.
»Sie finden das nicht schlimm?« Er klang verlegen.
»Was soll ich schlimm finden?«
»Dass ich keine Eltern mehr habe!«
»Natürlich ist das traurig, aber dafür brauchst du dich doch nicht zu schämen.« Ich ergriff seine Hand, die den König hielt, und drückte sie sanft.
»Die meisten Leute benehmen sich komisch!«
»Auf solche Leute brauchst du nicht zu achten. Was sie denken, ist nicht wichtig«
»Ja«, brachte er leise hervor und ich fand, dass es für den Augenblick genug mit dem Kummer sei, und schubste ihn aufmunternd an.
»Hey, wie sieht es aus, gibst du mir eine Revanche?«
Sein Gesicht begann sich wieder etwas aufzuhellen und er stellte den König zurück an seinen Platz.
Das Spiel dauerte zehn Züge. Schachmatt.
Noch ein Spiel. Vierzehn Züge. Welch ein Fortschritt!
Wir spielten den ganzen Morgen. Dann gab es Essen und wir machten eine Pause. Aber schon am frühen Nachmittag fand ich mich wieder bei ihm ein und wir spielten weiter. Es war eine willkommene Abwechslung für uns beide und ich war froh, dass ich mich nicht mit meinem Zimmergenossen zu befassen brauchte.
Ich verlor jedes Spiel, doch das trübte meinen Spaß an der Sache in keiner Weise. Es tat einfach gut, etwas anderes zu tun, als nur durch die Gänge zu schleichen oder im Bett zu liegen und an die Decke zu starren. Außerdem war es ein gutes Gehirntraining und vielleicht würde es dazu beitragen, dass ich mich schneller erinnerte.
Mit einer sicheren Bewegung setzte Axel den Springer auf A 6. »Schachmatt!«, rief er aus und ich musste es nicht kontrollieren, denn sein Urteil war unumstößlich. Allmählich müde geworden von der geistigen Anstrengung rieb ich mir die Augen. Draußen war es schon dunkel.
»Lass es für heute gut sein und uns morgen weiterspielen«, sagte ich zu ihm, hievte mich aus dem Stuhl und begann meine Glieder zu strecken, die vom langen Sitzen steif geworden waren.
»Ganz bestimmt?«
»Versprochen.«
Immer noch etwas steif schlich ich zur Tür. »Bis morgen, Axel!«
»Bis morgen, Herr...« Er stockte. »Entschuldigung!«
Ich sah ihn lächelnd an. »Wofür? Es gibt keinen Grund.«
Es war einen Moment still im Raum, dann verabschiedete ich mich noch einmal und verließ den Raum.
Gedankenversunken ging ich den Flur entlang, bis ich zu einem der Balkone kam, die einem zumindest ein wenig das Gefühl vermittelten, nicht völlig eingesperrt zu sein. Ich trat hinaus an die frische Luft. Begierig sog ich sie ein. Dann sah ich auf die Lichter der Stadt. Sie leuchteten so intensiv, als seien es herabgefallene Sterne. Ich sehnte mich nach dem pulsierenden Leben, das dort unten vor sich ging, sehnte mich danach zu wissen, wohin ich gehörte.
Ich stützte meine Arme auf das Geländer und verfiel in Melancholie. Irgendwo in der Ferne sah ich die Lichter eines Autos, die versuchten, eine einsame, dunkle Straße zu durchdringen. Der Fahrer in diesem Wagen wusste bestimmt, wohin er wollte. Er hatte ein klares Ziel. Viel- leicht war er gerade auf der Heimfahrt zu seiner Familie?
Traurig sah ich den Lichtern nach, bis sie irgendwo draußen in der Dunkelheit verschwanden. Ich muss hier raus, sagte ich mir. Ich würde morgen mit Doktor Gajewski sprechen, nahm ich mir vor.
Mit einem sehnsüchtigen Blick verabschiedete ich mich von den Lichtern der Stadt und trat wieder ein in das allabendliche Schweigen des St. Michael Hospitals.
Mein Zimmergenosse war schon lange im Schlaf versunken und zersägte unzählige Bretter. Ich lag wach, wie so oft, und meine Gedanken kreisten um die Entlassung in das alltägliche Leben.
Ich brauchte einen Namen, zumindest vorläufig, bis mir mein richtiger Name wieder einfiel. Ich ging im Kopf unzählige Namen durch und hoffte, dass der eine oder andere mir irgendetwas sagen würde, aber dem war nicht so. So begann ich schließlich nach einem Namen zu suchen, der in irgendeiner Weise zu mir passte. Ich brauchte nicht lange. Ich kam auf die Idee, mich Michael zu taufen in Anlehnung an den Namen des Hospitals, in dem ich mein neues Leben begonnen hatte. Mit dem Nachnamen war es schon ein wenig schwieriger, aber mein Gefühl und Verstand einigten sich auf Kassel, die Stadt, in der ich mich zumindest seit meinem Unfall aufhielt.
Leise sprach ich meinen Namen aus: »Michael Kassel!« Es klang ganz plausibel und zum ersten Mal fühlte ich mich als eine wirkliche Person. Ich hätte nie geglaubt, dass zwei einfache Worte, ein alltäglicher Name, so viel Bedeutung haben könnten. Michael Kassel! Ich begann zu lächeln. Endlich war ich jemand. Auch wenn es nur ein fingierter Name war, so war es dennoch ein Fortschritt. Sollte mich nun jemand nach meinem Namen fragen, so konnte ich ihm zumindest antworten.
»Michael Kassel!«, erklang meine Stimme aufs Neue.
Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Ein Dialekt! Sprach ich einen Dialekt? Ich ärgerte mich, dass ich erst jetzt auf diese Idee kam. Sehr viele in diesem Krankenhaus sprachen hessisch. Sprach ich hessisch? Ich kramte weiter in meinem Gehirn. Was hatten wir noch anzubieten? Bayrisch, schwäbisch, sächsisch. Nein! Ich sprach keinen dieser Dialekte. Ich kam zu dem Schluss, dass ich ein reines Hochdeutsch sprach, was nicht unbedingt bedeuten musste, dass ich nicht doch aus einer dieser Gegenden kam. Es war ein Hoffnungsschimmer gewesen, aber leider war das Ergebnis nicht befriedigend.
Egal, sagte ich mir. Ich hatte jetzt einen Namen und das war schon was.
Ein Schrei zu meiner Linken ließ mich aufschrecken. Ich riss meinen Kopf zur Seite und schaltete das Licht an.
Mein Nachbar atmete stoßweise und kleine Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn. Seine Decke hatte er nach unten gestrampelt.
Seine Brust hob und senkte sich in einem unnatürlichen Rhythmus und seine Gesichtsmuskeln verkrampften sich regelmäßig. Trotz dieser Anstrengungen schien er zu schlafen.
Ich drückte den Klingelknopf um die Schwester herbeizuholen und schwang mich aus dem Bett. Behutsam legte ich meine rechte Hand auf seine Schulter um ihn zu beruhigen und beugte mich etwas über ihn. Plötzlich riss er die Augen auf und begann zu schreien. Zur gleichen Zeit griffen seine Hände nach meinem Hals. Seine knochigen Finger umfassten ihn und seine Daumen drückten sich in meine Kehle. »Du Bastard, du Bastard!«, brüllte er immer wieder und in seinen Augen leuchtete der Wahnsinn. Mit all meiner Kraft versuchte ich, seine Hände zu lösen. Aber die lange Zeit im Koma hatte an meinen Kräften gezehrt. Der Raum begann sich vor meinen Augen zu drehen. Ich versuchte zu schreien, doch nur ein leises Röcheln drang aus meiner schmerzenden Kehle.
Meine Knie knickten ein und ich sank zu Boden, doch mein Peiniger ließ nicht los, sondern er fiel – von meinem Sturz mitgezogen – halb auf mich und drückte in seinem Irrsinn weiter zu. Wo blieb die Schwester?! Ich fühlte panische Angst. Vielleicht war sie eingenickt. Vielleicht kam überhaupt niemand.
Mit letzter Kraft begann ich auf den Körper meines Gegners einzuschlagen, aber auch dies blieb ohne Wirkung. Er war wie von Sinnen, fühlte keinen Schmerz. Ich war verloren.
Plötzlich glaubte ich den Geruch von Alkohol in meiner Nase wahrzunehmen. Es war nur ein ganz flüchtiger Eindruck. Dann verschwommen das Bild von Soldaten und einer Salve von Schüssen. Ein weißer Blitz, das Dröhnen eines Zuges, der durch meinen Kopf ratterte.
Das also ist der Tod, schoss es mir durchs Gehirn, als plötzlich der Kopf meines Gegners zurückgerissen wurde und er von mir abließ. Die Schwester und ein Krankenpfleger zerrten den tobenden Wahnsinnigen von mir fort. Röchelnd stemmte ich mich in die Höhe. Keuchend und nur mit Anstrengung sog ich Luft in meine Lungen. Ich begann zu husten und zu würgen, mein Kehlkopf brannte wie Feuer. Instinktiv begann ich ihn vorsichtig zu massieren.
Nach einiger Zeit kümmerte man sich dann um mich. Meinen Peiniger sollte ich nie wieder sehen.
Am nächsten Morgen fühlte ich mich schon wieder besser. Der Schmerz in meinem Hals hatte nachgelassen, bis auf ein gelegentliches Ziehen und Pochen. Die Schwester erzählte mir, dass man meinen Nachbarn in die psychiatrische Abteilung verlegt hätte. Es käme häufiger vor, dass Patienten mit schweren Brandwunden psychologisch betreut werden müssten. Dies hier sei jedoch ein extremer Fall, sagte sie zu mir.
Psychologische Behandlung, dachte ich bei mir. Auch ich hatte Brandwunden erlitten. Hieß das, dass auch ich durchdrehen würde? Unsinn! Gerhard Schneider hatte sich während seines schon Wochen dauernden Aufenthaltes im Krankenhaus selbst etwas vorgemacht. Er dachte wohl, mit dieser gespielten Leichtigkeit sein Problem in den Griff zu bekommen. Doch auf Dauer kam er mit dieser Strategie nicht klar. Er war traumatisiert. Vielleicht verfiel er gar dem Wahnsinn.
Mich aber ließ der Augenblick des Todeskampfes nicht los. Meine Sinne hatten verrückt gespielt. Der Geruch von Alkohol und das Dröhnen einer Eisenbahn erschienen mir unsinnig und ohne jeden Zusammenhang. Auch für die Salve von Schüssen hatte ich keine Erklärung. Es war mir jedoch in dieser extremen Situation, als wäre sie gegen mich gerichtet gewesen.
Doch da war noch etwas anderes, diesmal keine Phantastereien, sondern Bilder, die ich wohl aus Erlebnissen schöpfte. Diese unscheinbaren und flüchtigen Impressionen von Häusern und Landschaften waren Erinnerungen, die in meiner Todesangst aus meinem tiefsten Innern aufgetaucht waren.
Doch was half diese Erkenntnis? Natürlich war es ein Fortschritt, sich zu erinnern. Aber bis jetzt waren es nur unbedeutende Dinge, die mir keinen wirklichen Aufschluss über meine Person gaben. Es war nichts, was meine Erinnerung wachrütteln konnte und mich mein Leben wieder in Zusammenhängen sehen ließ. Nach wie vor blieb ich mir selbst ein Fremder.
Ich hörte, wie die Klinke heruntergedrückt wurde. Doktor Gajewski trat ein.
»Guten Morgen, wie fühlen Sie sich?«
»Zerschlagen!« Meine Stimme klang ungewollt gereizt.
»Das kann ich verstehen«, sagte er verständnisvoll und nahm an meinem Bett Platz.
»Ich möchte entlassen werden«, verlangte ich.
Er nahm die Brille von der Nase und begann sie zu putzen. Zögernd antwortete er mir: »Sie sind ein freier Mensch und dies hier ist kein Gefängnis. Physisch gesehen habe ich auch keine Bedenken. Aber glauben Sie nicht, es wäre besser, in der Obhut einer Klinik zu versuchen, Ihr Gedächtnis wiederzuerlangen?«
Ich sah ihn ärgerlich an. »Höre ich da heraus, dass Sie mich für geistig zu labil halten, um auf die Welt dort draußen losgelassen zu werden?« Ich zeigte auf das offenstehende Fenster. Ganz leise war der Straßenlärm zu vernehmen.
»Nein, das möchte ich damit nicht sagen«, begann der Arzt abwehrend, »aber es kann durchaus sein, dass es Ihnen sehr schwer fallen wird, mit Ihren jetzigen Problemen ein relativ normales Leben zu führen.« Er sah mich mit seinen stahlblauen Augen durchdringend an und für einen kurzen Augenblick war ich geneigt nachzugeben, aber dann blieb ich doch meiner ursprünglichen Absicht treu.
»Das mag sein, aber es ändert nicht meinen Entschluss!«
»Ich kann Sie nicht zwingen hier zu bleiben, aber Sie müssen dann noch einige Formalitäten erledigen.«
Zufrieden mit seiner Antwort nickte ich ihm zu. »Ach, übrigens«, ergänzte er, »Ihre alten Kleider waren wohl in so unbrauchbarem Zustand, dass irgendein übereifriger Mitarbeiter sie entsorgt hatte, als die Polizei danach fragte. Er erinnert sich noch an einen verknitterten Reiseprospekt in einer Jackentasche, dem er natürlich auch keine Bedeutung beimaß. Ansonsten waren die Taschen leer.«
Das Geständnis war ihm offensichtlich unangenehm.
»Ich habe daher den Sozialen Dienst hier im Hause angewiesen, für Sie ein paar passende Kleidungsstücke zu besorgen. Die werden Sie in den nächsten Tagen erhalten.«
Er schüttelte mir kurz die Hand und verabschiedete sich.
Nach dieser Mitteilung war ich ziemlich verstimmt. Warum warfen die einfach meine Sachen in den Müll?! Vielleicht hätten mir die alten Klamotten einen Hinweis gegeben. Anderseits, wenn alles verkohlt und zerrissen war, dann … aber wenigstens den Prospekt hätten sie aufbewahren müssen. Ich ärgerte mich auch über mich selber, dass ich nicht früher nach meinen Kleidern gefragt hatte. Andererseits, wie die Dinge lagen, hätte auch das nichts genützt.
Die noch verbleibenden Tage im Krankenhaus nutzte ich, um mit Axel weiter Schach zu spielen. Er war sichtlich enttäuscht, als ich ihm sagte, dass ich nun bald entlassen würde. Zwischen ihm und mir hatte sich eine echte Freundschaft entwickelt. Ich versprach Axel, ihn weiterhin zu besuchen und mit ihm Schach zu spielen. Das tröstete ihn zumindest ein wenig.
Nach fast sechs Monaten Hospital war es endlich soweit. Vom Sozialen Dienst einigermaßen ordentlich eingekleidet und mit einer kleinen Reisetasche, in die man das Notwendigste hineingepackt hatte, schritt ich durch den Haupteingang hinaus in die Welt.
Draußen blieb ich stehen. Die klare Luft war eine erfrischende Wohltat. Doch die ungewohnte Freiheit wirkte auch beklemmend. Es war die Angst vor dem Unbekannten. Was würde auf mich zukommen? Ich schüttelte den Gedanken ab und zwang mich weiterzugehen. Nur weg von hier!
Da hörte ich, wie jemand gegen eine Scheibe klopfte. Meine Augen suchten die Fenster ab.
Axel sah zu mir herunter und hob die Hand. Ich ebenfalls. Er begann zu lächeln und ich erwiderte sein Lächeln.
»Ich komme wieder!«, sagte ich mehr zu mir selbst. »Ich komme wieder!«