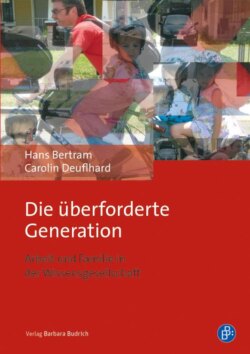Читать книгу Die überforderte Generation - Hans Bertram - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[21]2. Lebensläufe im Wandel
2.1 Demografische Paradoxien
In den letzten 150 Jahren haben sich die weiblichen Lebensverläufe radikal verändert, was der historische Demograf Arthur Imhof 1981 als die gewonnenen Jahre beschrieb.
Abbildung 1: Lebensläufe verheirateter Frauen; Deutschland und USA: 1900-2002
Eine um 1900 geborene Frau hat das 15. Lebensjahr ihres letztgeborenen Kindes noch um etwa 15 Jahre überlebt (vgl. Abb. 1); sie war dann im Durchschnitt 52 Jahre alt und [22]ihre Kinder waren in der Regel spätestens mit dem 15. Lebensjahr als Lehrlinge oder als ungelernte Arbeitskräfte in Haushalten und Betrieben tätig. Beim Vergleich mit den Lebensverläufen der Frauen heute ist zunächst festzuhalten, dass nach dem 15. Geburtstag des letztgeborenen Kindes, bei dem die Mutter heute im Durchschnitt 45 Jahre alt ist, noch etwa 35 Lebensjahre vor ihr liegen. Das ist nicht nur der seit 1900 um etwa 12 Jahre gestiegenen Lebenserwartung geschuldet, sondern hängt vor allem damit zusammen, dass heute zwischen der Geburt des ersten und des letzten Kindes meist nur zwei Jahre liegen; bei den Müttern um 1900 waren das im Schnitt rund 12 Jahre. Aus Abbildung 1 wird auch deutlich, dass sich das in jüngster Zeit gestiegene Heiratsalter und das gestiegene Erstgeburtsalter auf etwa 30 Jahre nicht so sehr von den entsprechenden Kennwerten der Mütter um 1900 unterscheidet, denn eine späte Erstheirat und die späte Geburt des ersten Kindes waren in Deutschland auch um 1900 üblich. Das sehr junge Heiratsalter nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es für Deutschland und die USA sowie für andere Länder typisch war (Ehmer/Ehrhardt/Kohli 2012), ist historisch eine Ausnahme gewesen.
1986 versuchten die beiden Demografen Ron Lesthaeghe und Dirk van de Kaa – (1986; Van de Kaa 1987) den Geburtenrückgang zwischen 1965 und 1975 in den westlichen Industrienationen zu erklären. In der Bundesrepublik Deutschland, wie auch in vielen anderen Industrieländern, war die Geburtenrate deutlich gesunken, nämlich in Deutschland von 2,1 Geburten pro Frau in 1968 auf etwa 1,5 Geburten pro Frau in 1975. Die Entwicklung in der DDR war bis Mitte der 1970er Jahre fast parallel verlaufen. Seit Mitte der 1970er Jahre bis heute stagniert die westdeutsche Geburtenrate bei 1,4 Kindern pro Frau. Dieser Zweite Demografische Übergang, wie Lesthaeghe und van de Kaa ihr Modell nannten, zeichnet sich durch einen deutlichen Rückgang der Periodenfertilität unter das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern pro Frau aus, mit der Konsequenz, dass jede nachwachsende Generation zahlenmäßig kleiner wird. Dieser Rückgang sei das Ergebnis des Hinausschiebens der ersten Geburt, was mit dem Rückgang der Heiratsneigung und dem Anstieg des Heiratsalters korrespondiere. Gleichzeitig seien in diesem Übergang ein Anstieg von Scheidungen, nichtehelichen Lebensgemeinschaften und nichtehelichen Geburten zu beobachten sowie die zunehmende Verbreitung moderner Verhütungsmittel (Van de Kaa 2001).
Nur sehr wenige demografische Modelle haben eine so weite und intensive Verbreitung gefunden wie dieses Modell des Zweiten Demografischen Übergangs. Dabei zeigt die Grafik von Imhof sehr deutlich, dass bereits bei dessen Formulierung empirische Daten gegen das Modell sprachen (vgl. Abb. 1). Denn nicht das gestiegene Erstheiratsalter und das gestiegene Erstgeburtsalter waren für die geringeren Geburtenzahlen ursächlich, sondern die geringere Anzahl der Jahre, die für die Reproduktion genutzt wurden. War eine Mutter um 1900 bei der Geburt des letzten Kindes im Durchschnitt 36 Jahre alt, so ist sie heute im Durchschnitt 31 Jahre alt. Erstaunlicherweise interpretierten Lesthaeghe und van de Kaa die demografische Entwicklung sehr gegenwartsbezogen, obwohl sie sich auf die Überlegungen des Historikers Philip Ariès (1980) stützen, der nicht nur die Geschichte der Kindheit zu rekonstruieren versucht hat, sondern auch die Entwicklung der Familie in der Gegenwart vor dem Hintergrund seiner Theorie aufzeichnete (Hutton 2001).
[23]Ariès erklärt den Ersten Demografischen Übergang, den Geburtenrückgang zwischen 1870 und 1920, damit, dass die Kinder im Laufe des 19. Jahrhunderts für ihre Eltern eine immer größere persönliche Bedeutung gewonnen hätten. Waren sie in der Agrargesellschaft vor allem ökonomisch wichtig, weil sie als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft eingesetzt werden konnten, verloren sie diesen ökonomischen Wert im 19. Jahrhundert zunehmend. Hingegen gewannen sie als Lebenssinn und Lebenserfüllung für ihre Eltern an Bedeutung, die sich zunehmend selbst für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder verantwortlich fühlten. Dieser Bedeutungsgewinn für die eigene Lebensperspektive führte nach Ariès dazu, dass man sich in der Zahl der Kinder beschränkte, um den wenigen Kindern das geben zu können, was aus der Sicht der Eltern für die kindliche Entwicklung erforderlich ist. Ariès nennt dies eine altruistische Begrenzung der Geburten, weil im Interesse der wenigen Kinder und ihrer Entwicklung auf mögliche spätere ökonomische Unterstützungsleistungen durch die Kinder verzichtet wird.
Folgt man Lesthaeghe und van de Kaa, verliert das Kind diese zentrale Bedeutung in der modernen Familie nach dem Zweiten Demografischen Übergang wieder. Denn im bürgerlichen Postmodernismus (Van de Kaa 2001) stehen das persönliche Selbst und die eigene Selbstverwirklichung im Vordergrund – die persönliche Freiheit, das persönliche Wohlbefinden sowie die eigenen Vorstellungen über den persönlichen Lebensentwurf. Autoritäten werden nicht mehr einfach akzeptiert, man ist tolerant gegenüber anderen Lebensformen, versucht sich selbstidentisch darzustellen und unterstützt emanzipatorische Ideen. Damit werden in diesem Modell Anlehnungen an das Konzept der postmateriellen Wertorientierung von Ronald Inglehart (1989) deutlich oder auch an das Konzept des expressiven Individualismus (Bellah et al. 1991), indem der Einzelne und seine subjektive Selbstverwirklichung zum Maß der persönlichen Bewertung von Lebensformen und der Beziehungen zu anderen werden.
Obwohl das Modell des Zweiten Demografischen Übergangs heute kritischer gesehen wird als vor fünf oder zehn Jahren, bildet es immer noch die konzeptionelle Leitlinie zur Analyse von demografischen Entwicklungen in den Industriegesellschaften (Billari/Kohler 2004; Sobotka 2004; Zakharov 2008). Vermutlich hängt das damit zusammen, dass andere Modelle, welche die demografische Entwicklung der letzten 100 Jahre als einen kontinuierlichen Prozess der Modernisierung beschreiben, richtigerweise darauf verweisen können, dass unter anderem die Umgestaltung von Lebensläufen, die Entscheidung für Kinder und die Entwicklungen der Säuglingssterblichkeit oder der ökonomischen Basis von Familie eher langfristige Prozesse sind (Ehmer/Erhardt/Kohli 2012). In der Regel eignen sie sich aber nicht, um erkennbare Umbrüche in zeithistorisch eher kurzen Zeiträumen kritisch zu erfassen. Das Absinken des Heiratsalters in den meisten hoch entwickelten Industriegesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wiederanstieg in den 1960er und 1970er Jahren ist kein lang laufender Prozess, sondern ein kurzfristiges Ereignis, das ganz offenkundig spezifische Konsequenzen gehabt hat. Auch der Rückgang der Säuglingssterblichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die damit einhergehende deutliche Verkürzung der Reproduktionszeit für die Mütter, die für die Geburt von drei Kindern bei einer sicheren Überlebenswahrscheinlichkeit der Kinder nur rund sechs Jahre benötigten, war unter einer historischen [24]Perspektive ein eher kurzer Prozess, der sich innerhalb von 20 bis 30 Jahren vollzogen hat.
Damit erklärt sich vermutlich auch das theoretische Paradox der familienwissenschaftlichen und familiendemografischen Forschung: Auf der einen Seite arbeitet sie mit historisch gut dokumentierten Analysen, die langfristige Entwicklungsprozesse und Kontinuitäten zeigen, wie etwa das europäische Heiratsmuster mit später Heirat, ökonomischer Selbstständigkeit und Neugründung des Haushaltes. Auf der anderen Seite gibt es jedoch deutliche Brüche in diesen Entwicklungen, wie beispielsweise das Absinken des Heiratsalters nach dem Zweiten Weltkrieg und dessen Wiederanstieg bei gleichzeitigem deutlichen Geburtenrückgang.
Allerdings können die Erklärungsmuster für die kurzfristigen Veränderungen verschiedener demografischer Entwicklungen, wie sie die Theorie des Zweiten Demografischen Übergangs anbietet, wenig überzeugen. Denn das Argument, die Veränderungen in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre ließen sich im Wesentlichen durch ein Muster nachbürgerlicher Moderne oder eines expressiven Individualismus erklären, der das eigene Selbst stärker betone und das eigene Wohlbefinden in der Partnerschaft als wichtiger einschätze als die Bedeutung von Kindern, hat ein theoretisches Problem. Dieses besteht darin, dass die empirischen Daten, welche den Wertwandel belegen sollen, zur gleichen Zeit erhoben wurden wie die der Veränderung der Geburtenraten. Dabei ergeben sich allenfalls Korrelationen, deren kausale Interpretation jedoch mit Zurückhaltung zu betrachten ist. Diese Vorsicht ist schon deswegen angezeigt, weil bei einzelnen Ländervergleichen deutlich wird, dass die Variationen des Postmaterialismus sich in den verglichenen Ländern nicht immer zu den jeweiligen Geburtenentwicklungen in Beziehung setzen lassen (Aassve/Sironi/Bassi 2011). Unter einer soziologischen Perspektive scheint es sinnvoller zu prüfen, welche sozialstrukturellen und sozialökonomischen Bedingungen in den einzelnen Gesellschaften dazu beitragen, dass die Entscheidung für Kinder unter den je spezifischen Bedingungen weniger häufig getroffen wird als unter anderen Bedingungen.
Ein solcher struktureller Zugang überwindet konzeptionell den Gegensatz zwischen kontinuierlich lang laufenden Prozessen, wie sie die historischen Demografen aufzeigen, und kurzfristigen, aber zeitlich eindeutig zu identifizierenden Umbrüchen in der demografischen und familiären Entwicklung in einzelnen Gesellschaften. Denn eine solche Perspektive hat den unbestreitbaren Vorteil prüfen zu können, ob manche Gruppen bereits vor den Umbrüchen ähnliche Entscheidungen getroffen haben wie heute. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Zusammensetzung der Gesellschaft heute anders ist und bestimmte Gruppen einfach häufiger vorkommen als vor 20 oder 40 Jahren. Wenn heute etwa berufstätige Mütter weniger Kinder haben als Hausfrauen, so ist die erste Frage, ob es diese heute zu beobachtende Relation auch schon vor dem Zweiten Demografischen Übergang gab. Als weitere Frage ist daraus abzuleiten, ob die Kinderzahl aufgrund von Veränderungen in der Zusammensetzung der Gesamtpopulation zurückgegangen ist, in der heute schlicht mehr Mütter erwerbstätig sind.
Weiterhin ist der Vorteil einer strukturellen Perspektive, dass sich die Umbrüche und Wandlungstendenzen, die sich in eher kurzen Zeiträumen von 30 bis 40 Jahren ereigneten, [25]empirisch sehr genau rekonstruieren lassen, weil für diese Zeiträume hinreichend Daten der amtlichen Statistik, zumindest für den Zweiten Demografischen Übergang, vorliegen. Die Differenzen in der strukturellen und ökonomischen Entwicklung sind in den hoch entwickelten Industriegesellschaften so ausgeprägt, dass der Vergleich vieler Gesellschaften oft dazu führt, dass spezifische Veränderungen von Traditionen innerhalb einzelner Gesellschaften übersehen werden. Daher wurde hier der Weg gewählt, die Entwicklung der familiären Lebensformen und der Reproduktion in der Bundesrepublik Deutschland systematisch mit der Entwicklung in den USA zu vergleichen. Dabei hilft die Tatsache, dass der familiäre Wandel in den USA, einschließlich der demografischen Entwicklung, durch die Arbeiten von Suzanne Bianchi (Casper/Bianchi 2002; Bianchi/Robinson/Milkie 2006; Bianchi/Milkie 2010) außerordentlich gut dokumentiert ist. Ebenso entsprechen die Indikatoren der amtlichen Statistik Amerikas in vielen Punkten denen der amtlichen Statistik Deutschlands, womit sie gut vergleichbar sind. Zudem werden in den Analysen von Casper und Bianchi viele Indikatoren verwendet, die auch bei Lesthaeghe und van de Kaa zur Beschreibung des Zweiten Demografischen Übergangs herangezogen werden.
Vor allem aber ermöglicht der Vergleich Deutschlands mit den USA, zwei sozialpolitisch unterschiedliche Systeme eines Wohlfahrtsstaates zu betrachten und die familiären Entwicklungen gegenüberzustellen. Die Bundesrepublik Deutschland wird in fast allen Analysen als ein konservativ-korporatistisches Modell des Wohlfahrtsstaates beschrieben (Esping-Andersen 1990; Huinink 2002; Vogel 2002). Aus verschiedenen Gründen wurde hier sehr lange an dem traditionellen Familienmodell, mit dem Mann als Haupternährer und der Frau als Hausfrau und Mutter, festgehalten. Indikatoren für ein solches traditionales System sind die Steuergesetzgebung, die Ehegesetzgebung und das Bildungssystem mit der Vormittagsschule. Hingegen werden die ökonomischen und strukturellen Veränderungsprozesse im Bereich von Ehe und Familie in den USA als einem liberalen Wohlfahrtsstaat weder durch die Steuergesetzgebung noch durch die Bildungssysteme oder andere Gesetzgebungen zu regulieren versucht. Durch einen solchen Vergleich ist es daher möglich zu prüfen, ob die Veränderungsprozesse in den jeweiligen Gesellschaften tatsächlich die Folge politischer Entscheidungen und gesetzlicher Regelungen sind oder eher die Folge bestimmter struktureller Entwicklungen, welche durch die Gesetzgebung und die politischen Rahmenbedingungen nur teilweise oder auch gar nicht beeinflusst werden können.
Die Faktoren, die als Indikatoren des Zweiten Demografischen Übergangs herangezogen werden, lassen sich sehr gut systematisch unter einer Lebenslaufperspektive ordnen. Denn Lesthaeghe und van de Kaa beschreiben mit ihrem Konzept letztlich den Wandel der Lebensphase der jungen Erwachsenen. Traditionellerweise sind die Heirat und die Geburt des ersten Kindes Lebensereignisse, welche die Jugendphase abschließen und den Übergang in das Erwachsenenalter charakterisieren. In dieser Hinsicht ist die Basisthese der beiden Autoren, dass sich die Jugendphase seit den 1970er Jahren deutlich verlängert hat und zugleich verschiedene Formen des nichtverheirateten Zusammenlebens in dieser längeren Jugendphase häufiger geworden sind. Außerdem wenden die jungen Erwachsenen moderne Methoden der Konzeptionsverhütung an und suchen aufgrund ihrer individualistischen Orientierung Lebensformen [26]und Gestaltungsmöglichkeiten, die ihnen selbst in der jeweiligen aktuellen Lebenssituation angemessen erscheinen, ohne damit langfristige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Folglich liegt eine zentrale Strukturveränderung des Zweiten Demografischen Übergangs in der neuen Organisation des Lebenslaufs der jungen Erwachsenen.
Dem liegt die These zu Grunde, dass die heutigen jungen Erwachsenen selbstbewusst versuchen, ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend ihrer eigenen Vorstellungen in der Gesellschaft zu realisieren. Jedoch können solche postindustriellen Orientierungen in der Arbeitsgesellschaft nur dann umgesetzt werden, wenn der Einzelne einen Platz in der Gesellschaft gefunden hat, der seinen Qualifikationen und Fähigkeiten entspricht. Nur dann ist die Möglichkeit der Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung in Bildung und Arbeit auch gegeben. Die These des Zweiten Demografischen Übergangs lässt sich demnach so übersetzen, dass das Wohlbefinden der jungen Männer und Frauen dieser Generation davon abhängt, dass sie selbst entscheiden können, wie sie ihre eigenen Lebensvorstellungen in der Arbeitswelt, der Familie und ihrer persönlichen Freizeit verwirklichen. Zur Prüfung dieser Thesen werden im folgenden Abschnitt die zeitlichen Strukturen und Entwicklungen für den Lebenslauf junger Erwachsener auf der Basis amtlicher Daten rekonstruiert und dadurch geprüft, ob sich die hier skizzierten Annahmen empirisch wiederfinden lassen.
2.2 Der Zweite Demografische Übergang
Beim Vergleich der Entwicklung der Lebensläufe verheirateter Frauen in Deutschland und den USA zwischen 1900 und 2000 fällt auf, dass das Erstheiratsalter in den USA auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit 22 Jahren relativ niedrig war (vgl. Abb. 1). Im Gegensatz dazu lag das Erstheiratsalter in Deutschland damals mit 26 bis 27 Jahren nur unwesentlich unter dem heutigen Heiratsalter von 29 bis 30 Jahren. Allerdings sank das Erstheiratsalter in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich, sodass sich die USA und Deutschland in den 1970er Jahren mit einem durchschnittlich niedrigen Heiratsalter von 21 und 22 Jahren einander angenähert haben.
Ein entscheidender Unterschied zeigt sich bezüglich des Alters von Frauen bei der Geburt des letzten Kindes. Während dieses in Deutschland von 36 bis 37 Jahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts heute auf 31 bis 32 Jahre abgesunken ist, war das niedrigere Alter bei der Geburt des letzten Kindes in den USA schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts typisch und ist bis heute so geblieben (vgl. Abb. 1). Da die jungen Amerikanerinnen früher heiraten als die deutschen jungen Frauen, bleibt ihnen bei sonst gleicher Lebensperspektive und fast gleicher Lebenserwartung ein längerer Zeitraum zur Entscheidung für Kinder. Diese längere Zeitspanne mag ein Grund sein, warum 2007 in den USA etwa 2 Kinder pro Frau geboren wurden, gegenüber knapp 1,4 Kindern pro Frau in Deutschland. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Geburtenrückgang in den USA viel deutlicher ausgefallen ist als in Deutschland. Wurden in [27]Deutschland um 1960 etwa 2,3 Kinder pro Frau geboren, waren es in den USA 3,65 Kinder pro Frau, sodass sich die Geburtenzahlen in den USA bis heute fast halbiert haben (vgl. Abb. 2).
Abbildung 2 zeigt, dass das Erstheiratsalter noch bis Mitte der 1970er Jahre sehr niedrig war. Da der Geburtenrückgang in Deutschland und den USA vor 1970 einsetzte, kann das steigende Heiratsalter nach 1970 für diesen Geburtenrückgang kaum ausschlaggebend gewesen sein. Vielmehr wird deutlich, dass der Geburtenrückgang und das durchschnittliche Heiratsalter, zumindest in Deutschland und den USA, in keinem systematischen Zusammenhang stehen. 1975 war das Heiratsalter in Deutschland auf weniger als 22 Jahre gesunken, dennoch lag die Geburtenrate zwischen 1975 und 1985 auf einem historisch einmalig niedrigen Niveau. Im Gegensatz dazu war die Geburtenrate in Deutschland zwischen 1960 und 1968 sehr hoch, obwohl das Erstheiratsalter mit 24 Jahren zwei Jahre über dem der Frauen lag, die später besonders wenige Kinder bekamen. Gleiches ist im Grundsatz für die USA zu beobachten: Seit 1950 stieg das Erstheiratsalter langsam von etwa 20 auf 22 Jahre an. Der Geburtengipfel wurde in den USA bei einem durchschnittlichen Heiratsalter von 21 Jahren erreicht, das Geburtental zwischen 1975 und 1980 bei einem Erstheiratsalter von 22 bis 23 Jahren, um sich danach völlig unabhängig vom Erstheiratsalter bei etwa zwei Kindern pro Frau einzupendeln.
Abbildung 2: Durchschnittliches Erstheiratsalter und Geburtenrate (TFR); alte Bundesländer und USA: 1950-2010
Um die Frage zu beantworten, ob es wirklich zu einem Bruch im Geburtenverhalten kam, wie das Absinken der Geburtenrate bis 1975 suggeriert, ist es zudem sinnvoll, die abgeschlossene Fruchtbarkeit nach der Kohorte beziehungsweise die Kohortenfertilität (CFR) der Frauen zu betrachten, denn diese entspricht der tatsächlichen Kinderzahl einer [28]Frau. Die totale Geburtenrate bezogen auf das Kalenderjahr (TFR) gibt hingegen die Zahl der Geburten pro Frau für eine künstliche Kohorte an, summiert also die Geburten nach Alter der Frau – 15 bis 49 Jahre – innerhalb eines Kalenderjahres auf. Indem Demografen wie van de Kaa und Lesthaeghe die TFR interpretierten, aber nicht schauten, wie viele Kinder die Frauen tatsächlich am Ende ihres Reproduktionszyklus mit 49 Jahren geboren hatten, kamen sie teilweise zu falschen Schlussfolgerungen. Denn aus einer Kohortensicht kann nicht von einem Bruch im Fertilitätsverhalten gesprochen werden. Stattdessen zeigt sich ein eher kontinuierlicher Rückgang, der bereits von der skeptischen Generation eingeleitet wurde. Bereits die 1942 geborenen Frauen bekamen im Durchschnitt weniger als zwei Kinder. Bis zur Kohorte der 1964 geborenen Frauen ist die Zahl relativ kontinuierlich auf 1,5 Kinder pro Frau abgesunken (vgl. Abb. 3).
Die TFR kann höher oder niedriger als die CFR sein, wenn das Alter bei der Geburt der Kinder schwankt. Schieben Frauen die Geburt ihrer Kinder auf, sind sie bei der Elternschaft also älter als vorherige Generationen, dann ist die TFR niedriger als die CFR. Dies ist seit 1975 der Fall, verursacht jedoch nur eine Differenz in der Geburtenrate von 0,1 Kindern pro Frau. Das junge Heiratsalter vor 1975 führte hingegen dazu, dass die Geburtenrate (TFR) in dieser Zeit mit 2,5 Kindern pro Frau deutlich höher lag als die tatsächliche Kinderzahl der Frauen (CFR).
Abbildung 3: Kinder pro Frau nach Geburtsjahr der Frau (CFR) und Kalenderjahr (TFR): Deutschland und USA
Insgesamt zeigt die Aufarbeitung der Daten, dass die sogenannten 68er, die von Ronald Inglehart (1977) als Träger der stillen Revolution bezeichnet wurden und eher postmaterielle Werte vertreten, kaum für den Zweiten Demografischen Übergang verantwortlich gemacht werden können. Denn diese Gruppe, geboren nach dem Zweiten Weltkrieg, war bei einem frühen Heiratsalter von 23 Jahren zwischen 1968 und 1975 [29]noch in den Zwanzigern und hatte ihren Reproduktionszyklus noch nicht annähernd abgeschlossen. Der Einbruch der Geburtenrate wurde vielmehr bereits von der Generation eingeleitet, die ihre Jugend in den 1950er Jahren erlebt hat und eher konservative Wertemuster vertrat, eben jene, die Helmut Schelsky (1957) als die skeptische Generation bezeichnete.
Für die Höhe der Geburtenrate ist außerdem die Varianz der Kinderzahl ausschlaggebend. Gibt es viele kinderlose Frauen und gleichzeitig nur einen geringen Anteil an Frauen mit mehr als zwei Kindern, dann ist die Geburtenrate niedrig. Abbildung 4 zeigt die Geburtenraten für drei verschiedene Kohorten, den Anteil der Frauen mit drei und mehr Kindern und den Anteil der kinderlosen Frauen. Der Rückgang der Kohortenfertilität zwischen den Geburtsjahrgängen von 1935 und 1950 korrespondiert mit einem deutlichen Rückgang der Mehrkinderfamilien. Auch der Geburtenrückgang Anfang der 1970er Jahre ist auf einen massiven Rückgang kinderreicher Familien zurückzuführen. Dies gilt nicht nur für Deutschland und die USA, sondern auch für andere Länder. Im Vergleich der Kohorten der 1950 und 1960 geborenen Frauen liegen die Geburtenrate und der Anteil an Frauen mit drei und mehr Kindern relativ stabil auf einem niedrigen Niveau. In den jüngeren Kohorten ist die Kinderlosigkeit deutlich angestiegen. Der Effekt auf die Geburtenrate ist jedoch marginal; sie sinkt kaum weiter ab. Im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich in Deutschland ein besonders niedriger Anteil von Mehrkinderfamilien. So sind zwar ähnliche Entwicklungen auch in den anderen europäischen Ländern zu beobachten, jedoch ist der Geburtenrückgang in Deutschland besonders ausgeprägt: Deutschland ist in Bezug auf die Höhe der Kinderlosigkeit Spitzenreiter. Gleichzeitig fehlen die Frauen mit drei und mehr Kindern, welche die Geburtenrate auf 2,1 Kinder pro Frau anheben könnten.
Aus der Analyse der Daten ist klar zu erkennen, dass für diese Entwicklung nicht die jüngere Generation, aufgrund eines Wertewandels, verantwortlich gemacht werden kann. Bereits die Frauen der skeptischen Generation nutzten die neuen Möglichkeiten der sicheren Verhütung und verzichteten auf dritte und weitere Kinder; im Durchschnitt bekamen sie etwa zwei Kinder pro Frau. Die Ungleichzeitigkeit zwischen der stillen Revolution des Postmaterialismus und dem Geburtenrückgang wird noch deutlicher, wenn die Entwicklung aus der Perspektive der Kinder betrachtet wird (vgl. Abb. 5). 1973 wuchsen noch fast 22 Prozent aller Kinder mit zwei Geschwistern auf und fast 18 Prozent mit drei Geschwistern. Schon 1982 hatten nur noch etwa 17 Prozent zwei Geschwister und 9 Prozent drei Geschwister. An diesen Werten hat sich bis heute kaum etwas geändert, denn seit 1973 kamen nur noch wenige dritte und vierte Kinder zur Welt, sodass die Familiengröße aus Sicht der Kinder seither stabil ist.
[30]Abbildung 4: Geburtenraten (CFR), Mehrkindfamilien und Kinderlosigkeit von 1935, 1950 und 1960 geborenen Frauen im internationalen Vergleich
[31]Abbildung 5: Kinder unter 18 Jahren nach Anzahl der Geschwisterkinder unter 18 Jahren im Haushalt; alte und neue Bundesländer: 1973-2004
Darüber hinaus ist der Anstieg der Scheidungszahlen, die als ein weiterer Indikator für die Neuinterpretation der individuellen Lebensperspektive infolge des Wertewandels herangezogen werden, im Wesentlichen der Generation jener Frauen zuzurechnen, die ihre Sozialisationserfahrungen im tiefsten Mangel der Nachkriegszeit gemacht haben. Der gut dokumentierte Anstieg der Scheidungsziffern legt zwar nahe von einem veränderten Verhalten auszugehen (Grünheid 2006), doch ähnlich wie die zusammengefassten Geburtenziffern (TFR) sind die zusammengefassten Scheidungsziffern Periodenzahlen. Die zusammengefasste Scheidungsziffer berechnet sich aus der Summe der ehedauerspezifischen Scheidungsziffern, welche die Zahl der geschiedenen Ehen eines Eheschließungsjahrgangs auf 10.000 geschlossene Ehen des gleichen Jahrgangs bezieht. Da zur Berechnung die Zahl der Ehescheidungen auf die Zahl der bestehenden Ehen bezogen wird, führt ein Rückgang der Eheschließungen auch bei gleich häufiger Scheidung zu steigenden Ziffern. Heute heiraten Paare nicht nur später, sondern es bleiben auch mehr Personen zeitlebens unverheiratet.
Aus Sicht der Kinder wird dieses Paradox deutlich. War die Zahl der jährlich von Scheidung betroffenen Kinder in Deutschland 1933 mit unter 40.000 noch recht niedrig, stieg sie in der Nachkriegszeit auf über 80.000 Kinder und sank bis 1960 wieder auf etwa 40.000 Kinder ab (vgl. Abb. 6). Seit diesem Zeitpunkt, also genau parallel zur Zeit des Babybooms zwischen 1965 und 1975, stieg die Zahl der von Scheidung betroffenen Kinder erneut an, und zwar auf über 100.000. Seit Mitte der 1990er Jahre schwankt sie um 120.000. Der Anstieg der Scheidungszahlen verlief zeitgleich zum Rückgang der Geburtenzahlen seit 1960. Da es in den ersten Ehejahren im Durchschnitt relativ geringe Scheidungszahlen gibt, ist der Anstieg der Scheidungszahlen ab 1965 im Wesentlichen auf die zwischen 1930 und 1940 geborenen Frauen zurückzuführen. Die Entwicklung in Deutschland unterscheidet sich nicht wesentlich von der in den Vereinigten Staaten und macht deutlich, dass es sich hier keinesfalls um eine neue Entwicklung handelt. Diese Verhaltensänderung zeigt sich im Gegenteil bereits bei der skeptischen Generation, die überwiegend konservative Familienwerte vertrat und lebte, mit weitreichenden Konsequenzen für das Aufwachsen der Kinder. Innerhalb der letzten dreißig Jahre, der Zeit des sogenannten Zweiten Demografischen Übergangs und des Wertewandels, scheinen hingegen kaum Veränderungen aufzutreten.
[32]Abbildung 6: Anzahl der von Scheidung betroffenen Kinder unter 18 Jahren; Deutsches Reich, alte und neue Bundesländer: 1933-2009
Unter einer methodischen Perspektive sind die Fehler von Lesthaeghe und van de Kaa in ihrer Theorie des Zweiten Demografischen Übergangs leicht zu erklären. Die als Indikator herangezogene Geburtenrate, berechnet als TFR, bezieht sich immer auf die durchschnittliche Zahl der Kinder aller Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren in einem Kalenderjahr (Hauser 1982; Preston/Heuveline/Guillot 2001). Eine solche Zahl ist für langfristige historische Vergleiche sicherlich ein guter Indikator und lässt sich auch sehr plausibel für Bevölkerungsprognosen nutzen (Statistisches Bundesamt 2009). Per Definition ist der Zweite Demografische Übergang aber keinesfalls ein langfristiger Prozess, sondern ein kurzfristiges historisches Ereignis. Wenn Lesthaeghe und van de Kaa einzelne Alterskohorten voneinander unterschieden hätten, wie andere Autoren in der Jugendforschung (u.a. Jennings/Niemi 1974, 1981) und wie auch wir hier in unseren Analysen, so wäre ihnen dieser Fehler nicht unterlaufen.
2.3 Von der landwirtschaftlichen Familie zur Familie der Dienstleistungsgesellschaft
Zu den erstaunlichen Ungereimtheiten in der demografischen Forschung zum Zweiten Demografischen Übergang gehört, dass die zahlreich vorliegende Forschungsliteratur zur Familienentwicklung und zum Familienleben von den 1950er Jahren bis Anfang der 1970er Jahre bis heute nicht zur Kenntnis genommen wird. Stattdessen wird mit der Hypothese des Wertewandels argumentiert, die Inglehart und seine Kollegen gerade nicht auf diese Altersgruppe bezogen haben, sondern mit der sie die Einstellungen der nach 1950 geborenen jungen Erwachsenen der 1970er Jahre erklären wollten. Diese [33]Argumentation ist für den Zweiten Demografischen Übergang deswegen so wenig überzeugend, weil Inglehart seine Konzeption auf dem Modell der Bedürfnishierarchie von Maslow (1943) aufbaut. Dieses geht davon aus, dass sich postmaterielle Werte erst nach der Befriedigung der elementaren Bedürfnisse, wie etwa der materiellen Sicherheit, entwickeln können. Gerade die Generation von jungen Frauen und Männern, die in den 1970er Jahren für den Geburtenrückgang verantwortlich waren, sind als Kinder und Jugendliche selbst in bitterer Armut aufgewachsen. Das gilt für die Bundesrepublik wie für die meisten europäischen Staaten und auch für viele Regionen der USA. Die von 1940 bis 1950 in der Bundesrepublik geborenen Kinder wuchsen in einem Land auf, in dem die Arbeitslosenquote noch 1953 mehr als 12 Prozent betrug und 1955 die Kinder und Jugendlichen nach damaligen Maßstäben noch Bedürftigkeitsquoten von über 18 Prozent aufwiesen (Schmucker et al. 1961). Somit war die Kindheit und Jugend dieser Generation mit Sicherheit nicht von Wohlstand und materiellem Auskommen gekennzeichnet.
Lesthaeghe und van de Kaa ziehen Philippe Ariès als Ideengeber heran, weil dieser den Geburtenrückgang im Wesentlichen mit der verstärkten Suche nach Selbstverwirklichung begründete. Ariès hat gemeinsam mit Georges Duby die Geschichte des privaten Lebens herausgegeben und in diesem Zusammenhang auch die 1950er Jahre für Frankreich und die USA beschrieben (Ariès et al. 1993). Für Frankreich zeigt sich eine relativ große Armut und Wohnungsnot, gerade für die Familien in den 1950er Jahren. Daraus wird deutlich, dass die Lebensbedingungen der 1950er und 1960er Jahre auch in Frankreich vor allem davon geprägt waren, die materiellen Existenzbedingungen zu verbessern. Die Beschreibung der Lebensbedingungen in den USA, auf der Basis der zeitgenössischen Literatur, zeichnet für die 1950er Jahre das Bild einer Familie, in der die Aufgaben in der Familie gemeinsam erledigt werden (May 1993). Nach diesen Quellen wird der neue Vater der Fünfziger Jahre so beschrieben, dass es geradezu ein Beruf sei, Vater zu sein. Auch andere historische Quellen, die durchaus große Verbreitung gefunden haben (Coontz 1992), bestätigen dieses Bild, ohne dass diese Diskussion einen Einfluss auf unser heutiges Bild der Familie der 1950er Jahre genommen hat.
Die Forschung und die Öffentlichkeit haben ihr Urteil über die Familie der 1950er Jahre längst gefällt. Übereinstimmend wird die Familie dieser Zeit als traditionelle Familie mit traditioneller, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung beschrieben, wissenschaftlich als neolokale Gattenfamilie bezeichnet. Dieses als universell angesehene Familienmodell gilt in den hoch entwickelten Industriestaaten zudem als ein zentrales Element gesellschaftlicher Modernisierung (Parsons/Bales 1953; Goode 1960, 1963). Denn dieser Familientypus, bei dem der Vater die ökonomische Basis der Familie sichert und sich die Familienbeziehungen im Wesentlichen auf die Eltern-Kind-Beziehung konzentrieren, ist für die Mobilitätserfordernisse der modernen Gesellschaften vorzüglich geeignet. Die familiären Beziehungen des Mannes können bei seiner beruflichen Mobilität ohne Schwierigkeit mitwandern, weil diese nur auf den Familienkern konzentriert sind und die ökonomische Basis der Familie nur von der Tätigkeit des Mannes abhängt. Auch in Zeitschriften, Büchern und Filmen aus der damaligen Zeit wird das Bild einer glücklichen Familie vermittelt, in der der Vater die ökonomische [34]Basis der Familie sichert und die Mutter für den häuslichen Bereich und die Entwicklung der Kinder zuständig ist.
Dieses Bild von Familie hat sich in den aktuellen Vorstellungen so verfestigt, dass nicht nur Demografen, sondern auch Familienforscher es als gegeben unterstellen. So beschreibt Andrew Cherlin (2002) die Familie der 1950er Jahre als ein Modell mit dem männlichen Haupternährer und der Mutter als Hausfrau, die sich in ihren unterschiedlichen Rollen um ihre Kinder kümmern, in einer Gemeinschaft leben und sich offensichtlich nicht vorstellen können, Sexualität auch außerhalb der Ehe zu erleben oder sich gar bei einem unerfüllten Eheleben scheiden zu lassen. Dieses glatte Bild blendet ebenso wie Parsons Beschreibung schlicht aus, dass diese idealisierte normale Familie in der empirischen Realität zu keinem Zeitpunkt – seit es amtliche Daten zu diesen Zusammenhängen gibt – von der Mehrheit der Kinder als normale Familie erfahren wurde. Diese Einsicht ist keinesfalls neu, sondern wird nur fortgesetzt ignoriert.
Abbildung 7: Familiäre Lebensformen aus Sicht der Kinder (0-17 Jahre); USA: 1790-1989
Der langjährige Leiter der Familienstatistik des amerikanischen Statistikbüros, Donald Hernandez (1993), hat die verschiedenen Familienmodelle für die USA seit Beginn der amerikanischen Statistik zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Basis des amerikanischen Zensus rekonstruiert. Aus Abbildung 7 geht deutlich hervor, welche dramatischen Veränderungen sich in der Familienentwicklung in den USA zwischen 1790 und 1990 vollzogen haben. Das Aufwachsen ohne Eltern stellte für amerikanische Kinder [35]die absolute Ausnahme dar. Es betraf nur drei bis fünf Prozent der Kinder, mit leicht fallender Tendenz. Die typische Lebensform für amerikanische Kinder bis zum 17. Lebensjahr war das Aufwachsen mit beiden Eltern; dabei dominierte zu Beginn des 19. Jahrhunderts die landwirtschaftliche Familie. Wenn man überhaupt von einer traditionellen familiären Lebensform für die USA sprechen will, ist es gerade diese Lebensform in der Landwirtschaft, die aber jene angeblich klassische Arbeitsteilung mit der Zuständigkeit des Mannes für den Beruf und die Zuständigkeit der Frau für den Haushalt nicht kannte. Natürlich gab es auch in den landwirtschaftlichen Familien klare Zuständigkeiten in der Arbeitsteilung, die sich jedoch funktional aus den anfallenden Arbeiten eines solchen Haushalts ergaben.
Um 1880 betraf das Modell der industriegesellschaftlichen Familie, mit dem Vater als außerhäuslich erwerbstätigem Angestellten und der Mutter als Hausfrau, etwa 40 Prozent aller amerikanischen Kinder. Der Höhepunkt dieser familiären Lebensform wurde aus der Sicht der Kinder 1960 erreicht, als rund 60 Prozent der Kinder in dieser Konstellation aufwuchsen. Zwischen 1960 und 1970 sank dieser Anteil bereits wieder auf 40 Prozent, weil nun die Zwei-Verdiener-Familie und die Familie der Alleinerziehenden zunehmend an Bedeutung gewannen. 1970 waren diese beiden familiären Lebensformen in den USA bereits stärker verbreitet als die Familie der Industriegesellschaft (vgl. Abb. 7).
Zunächst ist festzuhalten, dass die Autoren, die die Familie der 1950er Jahre insgesamt als traditionelle Familie mit der vorgeblich klassischen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bezeichnen, die 40 Prozent der Kinder ausblenden, die selbst 1960 – dem Höhepunkt dieses Modells – in anderen familiären Lebensformen aufwuchsen. In den Zeiten davor, also zwischen 1880 und 1950 bis 1960, wurden die Kinder, die in landwirtschaftlichen Familien aufwuchsen, ebenso ignoriert wie die Kinder, die in dieser Zeit bei Zwei-Verdiener-Familien oder bei Alleinerziehenden lebten.
Wenn überhaupt von Übergängen und Revolutionen in Bezug auf familiäre Lebensformen gesprochen werden kann, so lassen sich nach Skolnick und Skolnick (2014) für die USA zwei große Übergänge aufzeigen: Der Übergang von der landwirtschaftlich geprägten Familie zur Familie der Industriegesellschaft und dann der Übergang von dieser zur Familie der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Damit folgen die Autoren einer Argumentation, die in der historischen Familienforschung (Laslett 1997; Hareven 1997) seit Jahrzehnten Standard ist. Ökonomische Strukturbrüche und Übergänge haben erhebliche Auswirkungen auf die ökonomische Basis von Familien und damit auch auf die Familienbeziehungen, die damit untrennbar verbunden sind. Ob diese Strukturbrüche und Übergänge tatsächlich immer mit einem Wertewandel verbunden sind, spielt für die Lösungsbeschreibung zunächst überhaupt keine Rolle. Denn es ist nicht auszuschließen, dass der Wertewandel eine Folge des Strukturwandels ist.
Bei den Autoren des Zweiten Demografischen Übergangs wird dieses Argument ohne weitere Begründung umgedreht. Für die USA gilt, dass sowohl der Geburtenrückgang als auch der Übergang in die Familienform der Dienstleistungsgesellschaft in den 1960er Jahren von Gruppen getragen wurde, die ihre Sozialisationserfahrungen in der Mangelsituation der Nachkriegszeit gemacht haben. Denn auch in den USA setzten [36]Prosperität und ökonomisch positive Entwicklungen erst nach dem Koreakrieg (1950-1953) ein. Ebenso wichtig ist es festzuhalten, dass die Normalität der neolokalen Gattenfamilie mit dem berufstätigen Vater sowie der Hausfrau und Mutter zwischen 1930 und 1960 die Lebensform von 60 Prozent der amerikanischen Kinder gewesen ist. Nicht nur, dass 40 Prozent der Kinder in anderen Lebensformen lebten, sondern für die USA gilt auch, dass diese Lebensform vor allem in den 1930er und 1940er Jahren dominierte, also in Zeiten der Folgen der Weltwirtschaftskrise und im Zweiten Weltkrieg – ein Zeitraum, der durch ökonomische Not sowie politische und persönliche Unsicherheit geprägt war, was nicht einmal ansatzweise als ökonomisch sichere Zeit zu interpretieren ist, in der sich postindustrielle Werte hätten entwickeln können. Die Entwicklung in Deutschland, von der Gründung des Deutschen Reichs bis heute, zeigt eine ähnliche Veränderung der Lebensformen für die Kinder (vgl. Abb. 8).
Abbildung 8: Familiäre Lebensformen aus Sicht der Kinder (0-17 Jahre); Deutsches Reich und alte Bundesländer: 1882-2004
Um 1880 lebten etwa 55 Prozent aller Kinder mit ihren Eltern in der traditionellen Familie, nämlich mit dem Vater als Alleinverdiener und der Mutter als nicht erwerbstätiger Hausfrau. In landwirtschaftlichen Familien wuchsen zu jener Zeit etwa 20 Prozent aller Kinder auf. Diese Lebensform verringerte sich in den 1950er Jahren bis Anfang der 1970er Jahre von rund 18 Prozent auf etwa 5 Prozent. 20 Prozent aller Kinder hatten schon um 1880 Eltern, die beide berufstätig waren oder alleinerziehende Eltern. Dieser Anteil wuchs kontinuierlich, auch während des Dritten Reichs. Er lag 1950 bei etwa 35 Prozent und stieg bis 1960 auf mehr als 40 Prozent an. Daher war der Anteil [37]der Kinder ohne eine Hausfrau als Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits größer als der Anteil der Kinder, die mit beiden Eltern in der neolokalen Gattenfamilie aufwuchsen. Die Bedeutung dieser familiären Lebensform verminderte sich noch einmal bis in die 1970er Jahre und stieg dann bis 2004 wieder auf etwa 60 Prozent an (vgl. Abb. 8).
Nach diesen Daten der amtlichen Statistik gab es in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich nur eine sehr kurze Zeit zwischen 1970 und 1985, in der die traditionelle Familie die typische Lebensform war – und das auch nur für rund die Hälfte der Kinder. Die daneben neue Lebensform für Kinder, die aber mindestens ebenso alt ist wie die traditionelle Familie, nämlich das Zusammenleben mit zwei berufstätigen Eltern oder mit einem alleinerziehenden Elternteil, ist seit Mitte der 1980er Jahre mit wachsender Tendenz die Lebensform für die meisten Kinder.
Zunächst mag man sich fragen, warum nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 1960er ein beschleunigter Anstieg dieser Lebensform zu beobachten ist, der dann wieder abbricht, um Mitte der 1970er Jahre wieder anzusteigen. Im Unterschied zu den USA ist für Deutschland zu berücksichtigen, dass der Anteil der alleinerziehenden Eltern sich bis Mitte der 1960er Jahre kaum von deren Anteil heute unterscheidet, denn infolge des Krieges wuchsen viele Kinder bei Kriegerwitwen auf. Bis 1963/1964 waren aber auch noch die Kinder, die im Zweiten Weltkrieg bis Ende 1945 geboren wurden, keine 18 Jahre alt und gehen daher in diese Statistik mit ein. Der Anstieg der Familien mit zwei Verdienern führte in Kombination mit diesen Kindern von Alleinerziehenden zunächst zu einem deutlichen Anstieg und dann, nachdem der Anteil der Familien mit kriegsbedingt alleinerziehenden Müttern deutlich sank, zu dem in der Statistik erkennbaren Rückgang.
Abbildung 9 zeigt deutlich, dass die amtliche Statistik bis 1965 in den alten Bundesländern fast genauso viel Alleinerziehende mit Kindern zählte wie 2004. Bei diesen amtlichen Daten ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch volljährige Kinder in die Zählung eingehen. Wenn nur die Kinder unter 18 Jahren bei Alleinerziehenden berücksichtigt werden, sind die Zahlen auch heute noch erheblich niedriger und erreichen nicht einmal die Hälfte der Werte, die die amtliche Statistik ausweist.
Es ist natürlich zu fragen, ob es sinnvoll ist, die Lebensformen von Kindern mit zwei berufstätigen Eltern mit denen in alleinerziehenden Familien zusammenzufassen. Die Argumentation von Hernandez (1993), der wir hier folgen, läuft darauf hinaus, dass die Lebensform für Kinder in postindustriellen Gesellschaften im Wesentlichen durch das Zusammenleben mit Eltern geprägt ist, die beide berufstätig sind oder mit einem alleinerziehenden Elternteil. Diese Entwicklung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich die ökonomische Basis der Gesellschaften so gewandelt hat, dass Familien heute nicht mehr dominant in der Lebensform der industriegesellschaftlichen Familie leben können, weil ein Einkommen zur ökonomischen Sicherung der Familie in der Regel nicht ausreicht. Zum anderen hängt sie eng damit zusammen, dass das Leben in großstädtischen Agglomerationen an Bedeutung gewinnt – das trifft auf die hoch entwickelten Industrieländer ebenso wie für viele andere Regionen der Erde zu (Siebter Familienbericht 2006). Damit geht einher, dass es heute wesentlich mehr alleinerziehende Eltern gibt als in den 1950er und 1960er Jahren, wenn die Kriegerwitwen nicht berücksichtigt werden. Denn die großen Städte und ihr Umland kennen offenkundig andere soziale und familiäre Beziehungsmuster als die traditionellen mittelgroßen Städte und ländlichen Gemeinden.
[38]Abbildung 9: Anzahl Alleinerziehender; alte Bundesländer: 1957-2010
2.4 Das Szenario des neuen Lebenslaufs
Wenn die These richtig ist, dass die tiefgreifende Veränderung des weiblichen Reproduktionsverhaltens in den hoch entwickelten Industriegesellschaften, wie sie im Rahmen des Zweiten Demografischen Übergangs beschrieben wurde, im Wesentlichen durch Frauen eingeleitet wurde, die in ihrer eigenen Kindheit und Jugend häufig Armut, ökonomische Unsicherheit, politische Umbrüche und den Verlust nahestehender Personen erlebt haben, um später als junge Erwachsene und Erwachsene eher für materielle Sicherheit und politisch konservative Rahmenbedingungen einzustehen, dann stellt sich die Frage, welche Ereignisse oder Einsichten dazu beigetragen haben. Vermutlich handelt es sich nicht um ein einzelnes Ereignis, sondern um die Kombination mehrerer Ereignisse, die in ihrer gemeinsamen Wirkung zu diesen Veränderungen geführt haben. Max Weber hat in seiner Theorie der Entwicklung des Geistes des Kapitalismus immer wieder betont, dass soziale Umbrüche und die Entstehung neuen sozialen Handelns in der Regel dadurch hervorgerufen werden, dass bestimmte einzelne Elemente gesellschaftlicher Entwicklungen eine spezifische neue Konstellation bilden, die neues Handeln ermöglicht (Schluchter 1979).
Catherine Hakim (2000) hat dieses neue Szenario des weiblichen Lebenslaufs in seinen einzelnen Elementen beschrieben. Der medizinisch-technische Fortschritt, wie unter anderem die Erfindung und Weiterentwicklung von Antibiotika, hat das Leben von Müttern und Kindern sehr viel sicherer gemacht (Shorter 1975, 1982). Dadurch stellte nicht nur die Säuglingssterblichkeit in den hoch entwickelten Industrieländern ein immer geringeres Problem dar, sondern es entwickelte sich auch die Möglichkeit, immer länger zu leben, wie bereits beschrieben wurde (vgl. Abb. 1). Diese Erfahrungen und Prozesse konnte diese Generation von Frauen zum ersten Mal an ihren Müttern in [39]großem Umfang beobachten. Die gewonnenen Jahre, wie sie Imhof (1981) und Livi-Bacci (1979) beschreiben, wurden erst in dieser Generation von Frauen zu einem selbstverständlichen Teil ihrer Lebenswirklichkeit (Sullerot 1979). Die Entscheidungsgewalt, wer verhütet, und damit auch die Entscheidung darüber, wie viele Kinder tatsächlich geboren werden, verlagerte sich mit der Pille auf die Frau. Keine gesellschaftlichen Traditionen, nicht der Wille des Mannes oder sonstige äußere Einflüsse konnten mit der Einführung der Pille noch auf diese Entscheidung einwirken. Nach den Analysen von Jürgens und Pohl (1975) aus den 1960er Jahren, betrachtete schon damals die Mehrheit der Frauen durchschnittlich 2,1 Kinder als ideale Kinderzahl. Nun müssen diese Entwicklungen nicht automatisch dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten so plötzlich ändern, wie dies beim Zweiten Demografischen Übergang geschehen ist. Daher müssen weitere Begründungszusammenhänge diskutiert werden.
So ist nicht zu vergessen, dass Ende der 1950er Jahre in den USA ebenso wie in Deutschland nach dem Sputnik-Schock (1957) eine völlig neue Diskussion um Bildung als Bürgerrecht (Dahrendorf 1965) aufkam, die zu einer sozialen Neubewertung von Bildung führte. Noch 1965 konnte von Friedeburg in einer empirischen Untersuchung feststellen, dass Väter wie Mütter der Meinung waren, Bildung und Ausbildung seien vorwiegend für die Jungen von Bedeutung, nicht aber für die Mädchen, die eher eine Aussteuer bräuchten. Während 1965 nur knapp 7 bis 8 Prozent eines Jahrgangs in der Bundesrepublik das Abitur machten, waren es 1985 bereits 19 bis 20 Prozent. Diese Entscheidung für eine qualifizierte und längere Ausbildung mussten die Eltern aber spätestens 1975 bis 1976 für ihre zehnjährigen Kinder getroffen haben. Zunächst waren das Eltern aus den mittleren und oberen Schichten, die sich dafür entschieden, ihren Töchtern eine ebenso qualifizierte Ausbildung wie ihren Söhnen zu ermöglichen.
Bestimmte Präferenzen von Personen, etwa die Zahl der gewünschten Kinder oder auch die Vorstellungen für den eigenen Lebenslauf, werden in der Literatur häufig als dauerhafte und stabile Muster von Einstellungen interpretiert, die Einfluss auf die Lebensentscheidungen von Menschen nehmen. Eine solche Präferenz ist sicherlich die Vorstellung von Eltern, alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit ihre Kinder es einmal besser und leichter im Leben haben als sie es selbst hatten. Möglicherweise hat die Diskussion um die Bildung und mögliche Bildungsperspektiven im Zusammenhang mit der zunehmenden Einsicht, dass nach dem Ende der Mutterrolle noch ein langer und konstruktiv zu nutzender Lebensabschnitt liegt bei dieser Müttergeneration dazu geführt, die Lebensentscheidungen, die sie für sich selbst in den 1950er Jahren getroffen hatten, noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und auf keinen Fall mehr als angemessen für die eigenen Kinder, insbesondere die Töchter, einzuschätzen.
Für diese Hypothese spricht, dass Anfang der 1960er Jahre in den USA und etwas später auch in Deutschland eine Diskussion darüber entbrannte, ob denn der Lebenslauf, den die Mütter der Nachkriegsjahre gewählt hatten, auf Dauer für sie selbst befriedigend und ausfüllend wäre. Betty Friedans Buch The Feminine Mystique wurde 1963 auch deswegen ein Bestseller, weil es den Zeitgeist der damaligen Mütter getroffen hat. Friedan stellte darin die gleiche Frage wie sie schon René König 1946 hinsichtlich des Familienmodells, mit dem Mann als Alleinverdiener und der Frau als Hausfrau und Mutter, formuliert hat: „Kann das alles gewesen sein?“ (Friedan 1963: 1).
[40]René König hatte 1946 darauf hingewiesen, dass in einem solchen Familienmodell nur der Vater in die anderen Bereiche der Gesellschaft integriert ist, während die übrige Familie, nämlich die Mutter und die Kinder, in Bezug auf die Gesellschaft relativ desintegriert sind und das umso mehr, wenn die Familie aufgrund beruflicher Mobilitätserfordernisse des Vaters häufig umzieht. Für König war es keine Frage, dass ein solches Familienmodell auf Dauer zur Desorganisation der ganzen Familie und damit letztlich zum Zerbrechen der Familie führen würde. Diese These findet sich im Ersten Familienbericht (1968) der Bundesregierung wieder. Hier wird auch darauf verwiesen, dass der Rückzug der Frauen in die Familie – und gegenüber den 1920er Jahren war es ein Rückzug – nicht nur ein Verlust für die Gesellschaft sei, sondern möglicherweise auch die Stabilität der Familie selbst gefährde.
Die in den 1950er Jahren in den USA ebenso wie in Deutschland übliche sehr frühe Heirat, zusammen mit der von den Medien und der Politik, teilweise aber auch von der Wissenschaft propagierten Vorstellung, die Rolle der Frau und die Rolle der Mutter bildeten eine Einheit und die Mutter definiere sich im Wesentlichen über den Haushalt und die Familie, führte notwendigerweise dazu, dass sich eine 35- oder 40-jährige Frau mit zwei oder drei Kindern die Frage stellen musste, welche Lebensaufgaben und Zukunftsperspektiven ihr eigentlich blieben, wenn die allmählich aus der Familie herauswachsenden Kinder die Mutterrolle zu einer Schrumpfrolle machen.
Stephanie Coontz (2011) kritisiert Friedan dafür, dass sie in ihrem Buch den Eindruck erweckt, diese Konzentration auf den Haushalt und die Familie sei von den Frauen selbst gewählt worden. Coontz nennt in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von diskriminierenden Regeln, welche die Teilhabe von Frauen an anderen gesellschaftlichen Bereichen systematisch behinderten. Das ist in ähnlicher Weise auch für die Bundesrepublik Deutschland zu kritisieren, worauf im vierten Kapitel noch näher eingegangen wird (vgl. Kap. 4.2). So war etwa die eigenständige Berufsausübung für Frauen und damit die Teilhabe am Arbeitsmarkt erst nach 1957 ohne Zustimmung des Ehemanns möglich.
Daraus folgt eine neue Interpretation für die Initiation des vollzogenen Wandels, denn die Konsequenzen aus diesem neuen Szenario wurden nicht erst von den in den 1950er Jahren geborenen jungen Erwachsenen umgesetzt. Sie wurden genau von jenen Frauen in die Lebenswirklichkeit übertragen, die sich ihrerseits wegen ihrer frühen Heirat in der Nachkriegszeit und ihren teilweise hohen Kinderzahlen in den dreißiger Jahren ihres Lebens die Frage stellten, ob ein solcher Lebensentwurf der Hausfrau und Mutter in der Familie tatsächlich ein ganzes Leben sinnvoll, im Sinne der Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung, prägen kann.
Es sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden, dass die technischen Entwicklungen in den 1950er und 1960er Jahren die Haushaltstätigkeiten zunehmend erleichterten, sich jedoch zugleich immer mehr auf die Hausfrau und Mutter fokussierten (Bianchi/Robinson/Milkie 2006). Denn die Vorratsbewirtschaftung, das Waschen, das Beheizen der Wohnung und selbst das Kochen waren lange Zeit Tätigkeiten, die eine Unterstützung durch mehrere Personen erforderlich machten. Demgegenüber ermöglichte die Technik zunehmend, all diese Tätigkeiten auf die Hausfrau und Mutter zu konzentrieren. Caplow et al. (1982) replizierten Ende der 1970er Jahre die berühmte [41]Middletown-Studie aus den 1920er Jahren (Lynd/Lynd 1929). Sie beschreiben sehr eindrücklich, dass sich in den 1970er Jahren insbesondere die Frauen aus der Mittelschicht gegenüber den Frauen der 1920er Jahre eher weniger zufrieden fühlten, weil sie nun für die ganze Haushaltsführung allein zuständig waren, während die Frauen in den 1920er Jahren viel mehr Unterstützung hatten.
Viele der diskriminierenden Regeln, die Frauen an der gesellschaftlichen Teilhabe hinderten, existierten allerdings lange vorher. Zudem hatten Wissenschaftler wie etwa René König schon früh (1946) erkannt, dass dieses Familienmodell nicht nur zur gesellschaftlichen Desintegration der Frau führt, sondern auch zur Desorganisation von Familien selbst beitragen kann. Und natürlich waren die medizinische Entwicklung und die gesundheitliche Fürsorge schon in den Mittel- und Oberschichten der 1930er und 1940er Jahre weit vorangeschritten. Ebenso gab es Diskussionen über die Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft, was unter anderem von prominenten Frauen, wie etwa Eleanor Roosevelt, gestützt und in den öffentlichen Diskurs gebracht wurde. Aber es bedurfte zusätzlich der Einsicht der betroffenen Frauen selbst, dass dieses Lebensmodell, angesichts der sich abzeichnenden gesellschaftlichen Entwicklung und der eigenen Stellung innerhalb dieser sich entwickelnden Gesellschaft, den eigenen Wünschen und Vorstellungen nicht mehr entsprach.
Ohne diese Frage hier endgültig entscheiden zu können, ist es doch relativ plausibel davon auszugehen, dass die Lebensmuster der 1950er Jahre nicht allein aufgrund eines Wertewandels infrage gestellt wurden, sondern als Folge des Zusammentretens unterschiedlicher Elemente, die es in den einzelnen Gesellschaften schon seit langem gegeben hatte (vgl. Kap. 4.2). Möglicherweise sind all die Folgen dieser Entwicklung, mit denen wir uns heute noch auseinandersetzen, Ausdruck der Tatsache, dass die unterschiedlichen Elemente der Mutterrolle, der Vaterrolle und der Berufsrolle, aber auch des zivilgesellschaftlichen Engagements und einer ausgefüllten Altersrolle in der modernen Gesellschaft von heute noch nicht in eine neue Konzeption eines in sich erfüllten Lebenslaufs übertragen sind.
2.5 Die Neuorganisation von Lebensereignissen im jungen Erwachsenenalter
2.5.1 Das sich entwickelnde Erwachsenenalter
Wie oben dargestellt ist mit Schelskys Bezeichnung der zwischen 1930/1932 und 1943 Geborenen als skeptische Generation (1957) die These verbunden, dass diese Generation als Jugendliche und junge Erwachsene als Reaktion auf eine extrem unsichere Kindheit und Jugend eine Vorstellung von Autonomie entwickelte, die eng mit dem Streben nach beruflicher und privater Sicherheit verbunden war. Die Lebensläufe dieser Generation zeigen, dass sie als junge Erwachsene hinsichtlich der Familienplanung, und wie später gezeigt wird auch bei ihrer Berufseinmündung, gegenüber allen anderen Generationen des 20. Jahrhunderts atypisch waren. Sie heirateten sehr früh und bekamen sehr früh [42]Kinder, sodass im Gegensatz zu früheren Generationen schon bei den 30-Jährigen im Durchschnitt alle Kinder geboren waren (Livi-Bacci 1979; vgl. Abb. 1). Sie hatten erstmals Zugang zu sicherer Verhütung und machten davon Gebrauch, sobald sie ihre gewünschte Kinderzahl geboren hatten. Die Lebenserfahrung der skeptischen Generation zeichnete sich insofern dadurch aus, dass sie die Unabhängigkeit vom eigenen Elternhaus durch Berufseinstieg und Familiengründung in einer relativ frühen Phase im Lebensverlauf realisiert hatte. Die von Schelsky beschriebenen kulturellen Leitvorstellungen dieser Generation stießen damit auf einen ökonomischen und gesellschaftspolitischen Kontext, in dem sie diese auch verwirklichen konnten. Das trifft in ähnlicher Weise auch für die USA zu, denn die Nachkriegsepoche war, wie bereits beschrieben, in allen westlichen Ländern durch die Entwicklung ökonomischen Wohlstands gekennzeichnet.
Im Vergleich zu 1970 hat sich der Lebenslauf der Frauen im Jahr 2000 radikal verändert (vgl. Abb. 1). Aus den 10 Jahren zwischen der Geschlechtsreife und der Geburt des ersten Kindes zu Beginn des Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre sind im Jahr 2000 fast 20 Jahre geworden. Verhütung wird nicht mehr erst dann angewendet, wenn die gewünschte Kinderzahl realisiert ist, sondern schon bevor mit der Familiengründung begonnen wird. Damit sind in der Phase des jungen Erwachsenenalters heute Zeiträume entstanden, die nicht durch Eheschließung, Familiengründung und Berufseinstieg geprägt sind, sondern offenkundig durch andere Elemente (Arnett 2004; Münchmeier 2001, Schröer/Böhnisch 2006). Der amerikanische Sozialpsychologe Arnett (2004) bezeichnet diese Lebensphase als emerging adulthood – das sich entwickelnde Erwachsenenalter. In mehr als 300 Tiefeninterviews in Columbia, San Francisco, Los Angeles und New Orleans hat er junge Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren mit den verschiedensten sozialen und ethnischen Hintergründen befragt, um herauszufinden durch welche Merkmale diese neue Lebensphase gekennzeichnet ist.
Vergleicht man die kulturelle Orientierung der jungen Generation, die Arnett beschreibt, mit Schelskys Beschreibung der skeptischen Generation, so zeigen sich deutliche Verschiebungen in der Autonomievorstellung. Denn während die frühe Festlegung auf Beruf und Familie und die damit verbundene frühe ökonomische Sicherheit und private Unabhängigkeit die Leitvorstellung für ein gelingendes Leben für die skeptische Generation war, artikulieren junge Menschen heute, dass der Entwurf einer Vorstellung davon, wie man leben will, zunächst einmal Zeit braucht (Arnett 2004). Diese Zeit des Dazwischen-Seins, in welcher die Kontrolle des Elternhauses geringer, die Selbstverantwortung größer und die Entscheidungen im Vergleich zur Jugend eigenständiger und bewusster werden, ist eine Zeit der individuellen Identitätserkundung und durchaus auch der Instabilität. Die neue Freiheit, die diese Generation im Gegensatz zur skeptischen Generation erlebt, ist im Wesentlichen die Freiheit, einen Zeitraum im Lebensverlauf zur Erprobung vielfältiger Optionen in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen zu nutzen, bevor sie sich auf langfristige Entscheidungen festlegt. Das gilt für die Erkundung möglicher beruflicher Perspektiven genauso wie für die sexuelle Orientierung oder die Suche nach der eigenen, individuellen Weltanschauung (ebd.).
Der Vergleich von Schelskys und Arnetts Beschreibung der sozialen Vorstellungen der beiden Generationen macht auch deutlich, dass sich das Verhältnis junger Menschen zur Arbeit verändert hat. Denn während die Männer der skeptischen Generation, [43]mit dem Ziel der ökonomischen Unabhängigkeit und der Perspektive auf die Gründung und Versorgung einer eigenen Familie, sehr früh einen möglichst sicheren und gut bezahlten Beruf suchten und die Frauen den frühen beruflichen Einstieg häufig noch nutzten, um sich die Aussteuer zu verdienen (Friedeburg 1965), sind die jungen Menschen heute je individuell auf der Suche nach einem Beruf, mit dem sie sich identifizieren können (Arnett 2004: 119 ff.). Folgt man Arnett streben junge Menschen zwar nach wie vor eine gute Bezahlung an, primär geht es ihnen aber darum einen Beruf zu finden, der zu ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten passt. Solch eine Vorstellung überhaupt zu entwickeln setzt in einer ausdifferenzierten Berufswelt unterschiedliche Arbeitserfahrungen voraus (ebd.). Ähnlich deutlich hat sich die Vorstellung von Liebe und Ehe verändert. Denn während das Zusammenziehen mit dem Partner oder der Partnerin in der sozialen Vorstellung der skeptischen Generation mit der Eheschließung verbunden war, möchten junge Menschen heute verschiedene Beziehungserfahrungen sammeln, bevor sie mit einem Partner zusammenziehen, und auch das Zusammenleben mit dem Partner erst einmal einige Jahre erproben, bevor sie sich möglicherweise für ein Kind und/oder eine Ehe entscheiden (Arnett 2004: 73 ff.).
Insgesamt erscheinen die eigenen Ziele und Möglichkeiten im Selbstverständnis der jungen Generation nicht bereits vordefiniert zu sein; vielmehr werden sie im Kontext von Erfahrungen hergestellt und sind in diesem Prozess auch offen für Neudefinitionen. Statusübergänge in Beruf und Familie sind damit nicht mehr – wie in der skeptischen Generation – die Bedingung von Autonomie, sondern die Konsequenz eines Entwicklungsprozesses, der sich aus einer Vielzahl vorangegangener Erfahrungen zusammensetzt und an dessen Ende die jungen Menschen erst die Möglichkeit sehen, langfristige Entscheidungen auf der Basis eigener Überzeugungen treffen zu können.
Stellt man die Lebensformen 18- bis 24-jähriger Frauen und Männer in Deutschland und den USA für den Zeitraum von 1973 bis 2004 gegenüber, so lassen sich die veränderten kulturellen Orientierungsmuster in Bezug auf die Ehe relativ gut nachvollziehen (vgl. Abb. 10). Trotz der unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Zuordnung der beiden Länder haben sich die Lebensformen außerordentlich ähnlich entwickelt. 1973 lebten in den alten Bundesländern etwa 62 Prozent der 18- bis 24-jährigen Männer bei ihren Eltern; 2004 lag dieser Anteil bei 66 Prozent. Die jungen Frauen lebten 1973 zu 44 Prozent bei ihren Eltern und 2004 zu 51 Prozent. Entsprechend des steigenden Heiratsalters nahm die Zahl der verheirateten jungen Männer von 17 auf etwa 3,6 Prozent und der verheirateten jungen Frauen von 43,9 auf 9,7 Prozent ab. Diese jungen Menschen bleiben aber nicht bei ihren Eltern wohnen, sondern entscheiden sich entweder für das Alleinleben oder für andere Lebensformen wie Wohngemeinschaften oder nichteheliche Lebensgemeinschaften. Für die jungen Frauen ist im jungen Lebensalter ganz eindeutig an die Stelle der Ehe das Alleinleben oder das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft getreten. Diese Lebensformen machen heute bei den jungen Frauen etwa 40 Prozent aus, gegenüber 12 Prozent in 1973. Bei den jungen Männern ist diese Entwicklung nicht ganz so ausgeprägt, aber auch von diesen leben etwa 30 Prozent in solchen Lebensformen, gegenüber 20 Prozent in 1973. In den USA lebten 1998 nach den Angaben von Bianchi 47 Prozent der Frauen und 58 Prozent der Männer zwischen 18 und 24 Jahren bei ihren Eltern. [44]Und auch in den USA sind alternative Lebensformen gegenüber dem Alleinleben noch deutlicher an die Stelle der Ehe getreten.
Abbildung 10: Lebensformen 18- bis 24-jähriger Männer und Frauen; alte Bundesländer 1973-2004 und USA 1970-1998
Daten der amtlichen Statistik, die für die bisherigen Darstellungen genutzt wurden, liefern zwar repräsentative Querschnittsdaten, weshalb sie sich sehr gut für Zeitreihen und internationale Vergleiche eignen, jedoch kann damit nicht analysiert werden, wie sich die Abfolge und Relation zwischen Berufseinstieg, Partnerschaft, Ehe und Kindern in den individuellen Lebensläufen der jungen Erwachsenen verändert haben. Marina Hennig (2005) hat in einer Reanalyse des Familiensurveys die dort vorliegenden Daten über die Lebensläufe der Befragten so neu ausgewertet, dass der Wandel der Organisation der Lebensereignisse im Lebenslauf sichtbar wird.
Abbildung 11 zeigt auf Basis ihrer Analyse das Alter bei Beginn der ersten Partnerschaft, bei der Erstheirat und bei der Geburt des ersten Kindes für verschiedene Geburtskohorten von Frauen. Es wird deutlich, dass sich die klassische Abfolge von Partnerschaft-Heirat-Geburt des Kindes bei den 1933 bis 1937 geborenen Frauen der skeptischen Generation in einem sehr engen zeitlichen Abschnitt vollzog: 80 Prozent der Frauen hatten spätestens mit dem 24. Lebensjahr einen festen Partner, mit dem 27. bis [45]28. Lebensjahr waren 80 Prozent verheiratet und mit dem 29. Lebensjahr hatten 80 Prozent ein Kind. Schon bei den 1958 bis 1962 geborenen Frauen ergeben sich deutliche Unterschiede in diesem Muster. Die Partnerschaftserfahrungen setzten früher ein, da zwischen dem 19. und dem 21. Lebensjahr 70 bis 80 Prozent der jungen Frauen bereits einen Partner und auch intime Beziehungen hatten. Mit dem 30. Lebensjahr waren sie aber erst zu knapp 60 Prozent verheiratet und die beiden Kurven für die Heirat und für das erste Kind verlaufen fast parallel.
Bei der Altersgruppe der 1973 bis 1977 geborenen Frauen verändern sich die Lebensmuster noch einmal: Die festen Partnerschaftsbeziehungen setzten ähnlich früh ein wie in der vorhergehenden Alterskohorte. Mit dem 27. Lebensjahr hatten etwa 50 Prozent der jungen Frauen ein Kind, doch geheiratet wurde in der Regel erst nach der Geburt des Kindes. Das erklärt auch den seit den 1990er Jahren zu beobachtenden deutlichen Anstieg der Zahl der Kinder, die außerhalb der Ehe geboren wurden. Damit wird das klassische Muster umgedreht, dass erst geheiratet wird und dann die Kinder kommen, sodass heute immer mehr Kinder die Hochzeit ihrer Eltern erleben. Ausführlich ist dieser Zusammenhang für Deutschland erstmals von Bernhard Nauck (1991) Anfang der 1990er Jahre beschrieben worden. Es lässt sich jedoch nichts darüber aussagen, ob diese Entwicklung dazu führen wird, dass Paare, die sich für Kinder entscheiden, zunehmend auf die Heirat verzichten oder sie nur das Muster der Abfolge der Lebensereignisse verändern, wie in den hier untersuchten Kohorten. Bei den Männern sind die Veränderungen in der Tendenz ähnlich, teilweise aber noch ausgeprägter als bei den Frauen.
Insgesamt zeigen die bisher zusammengetragenen Daten zum jungen Erwachsenenalter, dass sich die heutige Generation bis zum 25. Lebensjahr in Bezug auf die Lösung vom Elternhaus nicht signifikant von ihrer Elterngeneration unterscheidet. Der eher geringe Anstieg des Zusammenlebens mit den Eltern, sowohl in den USA als auch in Deutschland, zeigt demgegenüber deutlich, dass die Vorstellung vom Hotel Mama (Hammerl 2007), mit dem das späte Auszugsverhalten aus dem Elternhaus insbesondere von jungen Männern bezeichnet wird, und das inzwischen in den Medien und der Öffentlichkeit zu einem festen Element bei der Beschreibung der heutigen Lebensläufe von jungen Erwachsenen geworden ist, keinerlei empirische Grundlage hat. Denn angesichts dieser Zahlen hätte davon auch schon 1973 oder 1970 gesprochen werden müssen. Dies umso mehr, als die jungen Frauen ebenso wie die jungen Männer in den USA nach den Daten von Settersten, Furstenberg und Rumbaut (2005) sowie Settersten und Ray (2010) bis 1940 noch deutlich häufiger bis zum 25. Lebensjahr bei ihren Eltern lebten als in den 1970er Jahren.
[46]Abbildung 11: Alter von Frauen bei Beginn der ersten Partnerschaft, bei der ersten Heirat und bei der Geburt des ersten Kindes; alte Bundesländer: Geburtskohorten 1913/17 bis 1973/77
Trotzdem unterscheiden sich die jungen Erwachsenen heute in ihren Entscheidungen deutlich von ihrer Elterngeneration. Denn die Alternative zum Leben mit den Eltern ist heute nicht der Übergang in eine feste Partnerschaft und Ehe, sondern das Alleinleben [47]oder das Leben in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Die skeptische Generation war die letzte, die dem Muster des Erwachsenwerdens als Statusübergang von der Herkunftsfamilie zur Ehegemeinschaft im neolokalen Haushalt und der darauffolgenden Gründung einer Familie noch folgte. Später geborene Generationen sammelten Partnerschaftserfahrungen über einen deutlich längeren Zeitraum. Heute ist die klassische Abfolge von Partnerschaft, Heirat und Geburt des ersten Kindes weitgehend aufgebrochen.
2.5.2 Ökonomische Selbstständigkeit und die Entscheidung für Kinder
In den Lebensläufen der skeptischen Generation war der Übergang ins Erwachsenenalter nicht nur klar definiert, sondern auch für alle deutlich erkennbar. In der heutigen Debatte entsteht der Eindruck, dass die Wissenschaft ebenso wie die jungen Erwachsenen zwar sehen, dass heute eine neue Lebensphase zwischen Jugend und Erwachsenenalter entstanden ist, die eigenständig gestaltet werden kann. Die konkreten Herausforderungen junger Menschen beim Übergang von dieser Lebensphase ins Erwachsenenalter werden jedoch kaum thematisiert. Folgt man Arnett (2004: 212), so definieren 20- bis 30-Jährige das Erwachsensein als Fähigkeit, Verantwortung für die Konsequenzen des eigenen Handelns zu übernehmen und Entscheidungen unabhängig auf Basis eigener Überzeugungen treffen zu können. Nach wie vor ist aber auch die ökonomische Selbstständigkeit wesentlich. Das Erwachsenwerden setzt damit voraus, dass die strukturellen Rahmenbedingungen die ökonomische Teilhabe junger Menschen auch ermöglichen. Dieser Aspekt wird in der Diskussion um das Hotel Mama ebenso wie in der Theorie des Zweiten Demografischen Übergangs völlig ausgeblendet. Denn die Theorie des Zweiten Demografischen Übergangs geht implizit davon aus, dass die Sicherheit der materiellen Bedingungen in der postindustriellen Gesellschaft gegeben ist.
Die ökonomische Selbstständigkeit hat sich allerdings allein schon durch die verlängerte Ausbildungsphase deutlich nach hinten verschoben. Abbildung 12 zeigt die Verteilung der Bildungsabschlüsse für alle Altersjahrgänge eines Erhebungsjahres auf der Basis des Mikrozensus für die alten Bundesländer für 1976 und 2004, wodurch die Folgen der Bildungsreform der 1970er und 1980er Jahre deutlich sichtbar werden. Hatten von den 20- bis 25-Jährigen damals 35 Prozent einen Realschulabschluss oder das Abitur, aber der überwiegende Teil von etwa 65 Prozent als höchsten Schulabschluss einen Hauptschulabschluss, so haben 2004 weniger als 30 Prozent einen Hauptschulabschluss und damit mehr als 70 Prozent einen qualifizierteren Schulabschluss. Inzwischen haben von den 20- bis 25-jährigen jungen Frauen 40 Prozent das Abitur.
Am Verlauf der Kurven ist deutlich zu sehen, dass diese Entwicklung nicht kontinuierlich und linear gewesen ist. Von den um 1940 Geborenen, also den heute etwa 70-Jährigen, hatten nur rund 20 Prozent einen Realschulabschluss oder ein Abitur. Zwischen den Kohorten der heute etwa 65-Jährigen und den heute etwa 40-Jährigen, das heißt innerhalb von nur rund 25 Jahren, hat sich der doch eher geringe Anteil qualifizierter Schulabschlüsse auf fast 70 Prozent erhöht. Ähnlich stark ist die Zunahme bei den jungen Erwachsenen verlaufen, die das Abitur erreichen.
[48]Abbildung 12: Frauen nach Schulbildungs- und Berufsabschluss und Alter; alte Bundesländer: 1976 und 2004
Diese erheblichen Veränderungen in sehr kurzer Zeit haben auch Spuren bei der Partizipation der jungen Frauen am Arbeitsmarkt hinterlassen (vgl. Abb. 13). Auf der Basis der Daten des Mikrozensus ist sehr gut zu sehen, dass die jungen Frauen 1976 zwischen dem 15. und dem 25. bis 30. Lebensjahr zu fast 70 Prozent am Arbeitsmarkt partizipierten. Die meisten von ihnen arbeiteten als gelernte oder auch ungelernte Arbeiterin und dies in der Regel, um sich die Aussteuer zu verdienen (Friedeburg 1965). Nach der Heirat sank die Erwerbsquote auf etwa 50 Prozent. Daraus wird noch einmal deutlich, was schon bei der Kritik zu Parsons Modell der industriegesellschaftlichen Familie formuliert wurde, dass nämlich auch zu den Hochzeiten dieses Modells die Hälfte der Frauen etwa bis zum 60. bis 63. Lebensjahr erwerbstätig war. Dabei ist auch festzuhalten, dass fast alle Frauen vollzeitbeschäftigt waren, was damals eine 42-Stunden-Woche bedeutete.
Dieses Bild hat sich 2004 vollständig gewandelt. Die Arbeitsmarktpartizipation der jungen Frauen hat bis zum 30. Lebensjahr erheblich abgenommen und steigt dann auf 70 Prozent deutlich an. 2004 bricht die Partizipation am Arbeitsmarkt nicht mehr wie [49]bei den Frauen 1976 ab dem 25. Lebensjahr ein, da sich die Frauen heute in diesem Alter nicht mehr in dem Maße für Kinder entscheiden und ihre Erwerbstätigkeit aufgeben. Deutlich wird aber auch, dass heute die Teilzeitbeschäftigung bei den Frauen jenseits des 30. Lebensjahrs deutlich zunimmt; zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr, also in der aktiven Familienphase, gilt das mit gut 40 Prozent für mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen (vgl. Abb. 13).
Ohne hier die verschiedenen Zwischenschritte im Einzelnen darzustellen, die diesen Prozess in den letzten 40 Jahren kennzeichnen, folgt die unterschiedliche Arbeitsmarktpartizipation der jungen Frauen und der Frauen zwischen 35 und 55 Jahren in Teilzeittätigkeit einerseits dem geänderten Bildungsniveau der jungen Frauen und andererseits den geänderten Lebensentscheidungen. Diese Trias aus viel höherer Qualifikation, späterer Entscheidung für Kinder und dem Versuch, die späte Entscheidung für Kinder durch Teilzeittätigkeit mit den Erfordernissen des Arbeitsmarktes zu verknüpfen, stellt vermutlich die signifikante Veränderung im Lebenslauf von Frauen dar.
Abbildung 13: Frauen nach Erwerbstätigkeit und Alter; alte Bundesländer: 1976 und 2004
Trotz der längeren Ausbildungsphase und der höheren Qualifizierung der heutigen jungen Generation, gibt es den Übergang in die ökonomische Eigenständigkeit mittels eines sicheren beruflichen Einstiegs, wie er für die skeptische Generation in der sich entwickelnden ökonomischen Struktur der Industriegesellschaft gegeben war, für die heutige nachwachsende Generation von jungen Erwachsenen nicht mehr. Denn seitdem hat es einen tiefen Bruch in der ökonomischen Entwicklung gegeben. Dies wird deutlich, wenn man der Analyse von Marina Hennig weiter folgt und die Anzahl der Berufswechsel im jungen Erwachsenenalter für einzelne Geburtskohorten betrachtet (vgl. Abb. 14).
Beim Vergleich der dort erfassten Geburtskohorten von 1913 bis 1958/62 ist zunächst gut zu erkennen, dass die ältesten befragten Männer im Vergleich zu allen späteren Kohorten bis zum 30. Lebensjahr bereits drei- bis viermal eine neue Arbeitsstelle [50]hatten annehmen müssen. Die Ursache für diese hohe Fluktuation sind sicherlich die sozialen Umbrüche durch Wirtschaftskrise, Krieg und Nachkriegszeit, die eine kontinuierliche Entwicklung der eigenen Berufskarriere schwierig machten. Bei den ältesten untersuchten Frauen waren die Berufswechsel bis zum 30. Lebensjahr in Bezug auf die gesamte Untersuchungsgruppe eher unterdurchschnittlich. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass sie vorwiegend noch in den praktischen Tätigkeiten wie zum Beispiel als Hausangestellte beschäftigt waren, von denen Theodor Geiger Ende der 1930er Jahre mehr als vier Millionen zählte (Geiger 1932).
Die Geburtskohorten der skeptischen Generation, die zwischen 1933 und 1942 Geborenen, weisen eine unterdurchschnittliche Zahl von Berufswechseln auf, und zwar sowohl die Männer als auch die Frauen. Das ist relativ gut nachzuvollziehen, weil der Wirtschaftsboom in der Bundesrepublik nach dem Koreakrieg, wie weiter oben ausgeführt, bis in die späten 1960er Jahre zu einem sehr stabilen Arbeitsmarkt führte. Für die zwischen 1950 bis 1960 geborenen jungen Männer und Frauen änderte sich die Situation beim Berufseintritt jedoch erneut grundlegend: Nun haben die Frauen ebenso wie die Männer bis zum 30. Lebensjahr viel häufiger den Arbeitsplatz gewechselt als die Generation zuvor. Die Ölkrise, der Rückgang der Industriebeschäftigten und eine damit verbundene relativ hohe Arbeitslosigkeit in den 1970er Jahren waren Zeichen eines ökonomischen Umbruchs, den die jungen Erwachsenen nur dadurch bewältigen konnten, dass sie flexibel auf unterschiedliche Arbeitsplatzangebote reagierten.
Abbildung 14: Abweichungen der mittleren Anzahl von Berufsepisoden im jungen Erwachsenenalter nach Geschlecht: Geburtskohorten 1913/17 bis 1958/62
[51]Abbildung 15: Alter von Frauen beim Zusammenziehen, bei Berufsbeginn und bei der Geburt des ersten Kindes; alte Bundesländer: Geburtskohorten 1913/17 bis 1973/77
Wenn nun verglichen wird, wie viel Zeit zwischen dem ersten Berufseintritt und der Entscheidung für das erste Kind vergeht, so ergibt sich das paradoxe Ergebnis, dass die 1933 bis 1937 geborenen westdeutschen Frauen mit 21 Jahren zu 80 Prozent erwerbstätig waren, aber mit 24 bis 25 Jahren erst 50 Prozent von ihnen ihr erstes Kind hatten (vgl. Abb. 15). [52]Von den 1973 bis 1977 geborenen jungen Frauen waren mit 26 Jahren überhaupt erst 75 bis 80 Prozent berufstätig, aber knapp 50 Prozent hatten schon ein Kind. Daraus ist abzuleiten, dass sich die Zahl der Frauen, die durch ihre Berufstätigkeit über eigenes Geld verfügen und noch keine Kinder haben, heute nur unwesentlich von der Generation unterscheidet, die sich sehr früh für Kinder entschied und viele Kinder hatte. Ohne hier die Daten im Einzelnen wiederzugeben, ist diese Tendenz bei den Männern ganz ähnlich, sodass die hier getroffenen Aussagen für die verschiedenen Kohorten auch für die Männer gelten (Hennig 2005: 57). Dies zeigt, dass die sich seit den 1970er Jahren entwickelnde Dienstleistungsgesellschaft, die sich zudem im globalen Wettbewerb behaupten muss, nicht mehr so klare Berufspfade aufweist wie die sich entwickelnde Industriegesellschaft. Diese Entwicklung wird später noch genauer untersucht (vgl. Kap. 4.5 und 4.6).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die höhere Qualifikation und die damit verbundene längere Ausbildung nicht dazu geführt hat, dass junge Frauen ihr Leben heute länger unabhängig und selbstständig ohne Verantwortung für Kinder gestalten können als die Frauengeneration, die viele Kinder hatte. Denn der Geburtenaufschub auf ein späteres Lebensalter wird, jedenfalls bei der hier untersuchten Gruppe, wesentlich durch die spätere berufliche Unabhängigkeit kompensiert. Zum einen bedeutet dies eine längere ökonomische Abhängigkeit von den Eltern (Furstenberg 2010), selbst wenn man nicht bei ihnen wohnt, oder auch von staatlichen Transferleistungen. Zum anderen bringt allein schon die verlängerte Ausbildungsphase eine größere Unsicherheit im Hinblick auf die eigenen Möglichkeiten mit sich, anschließend in angemessener Weise am Arbeitsmarkt partizipieren zu können. Bedenkt man zudem die größere Unsicherheit beim Berufseinstieg, so ist festzuhalten, dass die jüngere Generation zwar höher qualifiziert ist als frühere Generationen, gleichzeitig aber die Erwartungen an ihre Flexibilität und die Akzeptanz von Unsicherheit größer geworden sind. Die Gewissheit, ob ökonomische Ressourcen zum Unterhalt einer Familie verfügbar sein werden, ist für die meisten jungen Menschen nicht gegeben.
Allerdings zeigt der Vergleich der altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern westdeutscher und amerikanischer Frauen für die Zeit des Zweiten Demografischen Übergangs von 1965 bis 1975, dass die Einschränkung der Kinderzahl vor dem 30. Lebensjahr in den USA nicht gleichermaßen stattgefunden hat (vgl. Abb. 16). Auch noch 1975, nach dem Ende des Babybooms, haben die unter 30-Jährigen in den USA mehr als 1,4 Kinder pro Frau geboren, während in der Bundesrepublik 1975 bis zum 30. Lebensjahr der Frauen etwa 1,0 Kinder pro Frau geboren wurden. Dieser Unterschied zwischen westdeutschen und amerikanischen Frauen bei der Entscheidung vor dem 30. Lebensjahr Kinder zu bekommen, ist heute noch sehr viel ausgeprägter als 1975: 2007 wurde in den USA immer noch der größte Teil der Kinder, nämlich etwa 1,3 Kinder pro Frau, vor dem 30. Lebensjahr der Mutter geboren und danach noch einmal 0,8 Kinder pro Frau. Die deutschen Frauen hingegen bekommen heute bis 30 nur knapp 0,6 Kinder pro Frau und kommen am Ende ihres Reproduktionszyklus nur auf 1,4 Kinder pro Frau. Sie kriegen damit insgesamt so viele Kinder wie die Amerikanerinnen im Durchschnitt fast schon bis zum 30. Lebensjahr geboren haben.
In Abbildung 17 und 18 sind die Fruchtbarkeitsziffern für die Jahre 1996 bis 2007 für die alten Bundesländer, die neuen Bundesländer sowie Frankreich, Schweden und [53]die USA wiedergegeben. Hier wird der Vergleich ausdrücklich um zwei europäische Länder erweitert, um die Bedeutung institutioneller Unterschiede zwischen den Staaten für die Entscheidung für Kinder berücksichtigen zu können.
Abbildung 16: Kumulierte altersspezifische Fruchtbarkeitsziffern (ASFR) und Geburtenrate (TFR); alte Bundesländer und USA: 1965-1975
Betrachtet man zunächst die altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern der unter 30-jährigen Frauen für 2007, so zeigt sich, dass in Deutschland in den alten Bundesländern mit etwa 0,6 Kindern pro Frau die wenigsten Kinder geboren werden, gefolgt von den neuen Bundesländern mit etwa 0,7 Kindern pro Frau. Die USA liegt mit 1,3 Kindern pro Frau bis zum 30. Lebensjahr an der Spitze, gefolgt von Frankreich mit etwa 1,0 Kindern pro Frau; in Schweden liegt die durchschnittliche Kinderzahl der unter 30-Jährigen mit etwa 0,8 Kindern pro Frau zwischen Deutschland und Frankreich. Die über 30-jährigen Frauen kriegen in Frankreich und Schweden noch einmal etwa 1,0 bzw. 1,1 Kinder pro Frau, während in den alten Bundesländern noch 0,8 Kinder und in den neuen Bundesländern noch 0,7 Kinder pro Frau geboren werden. In Schweden und Frankreich kam es seit 1996 zu einer Zunahme der altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern bei den über 30-Jährigen um etwa 0,3 Kinder, sodass die Geburtenraten in diesen Ländern heute insgesamt (TFR) nahe am Reproduktionslevel von 2,0 Kindern pro Frau liegen. Zwar kam es [54]auch in Deutschland, in den alten und neuen Bundesländern, seit 1996 zu einer Zunahme der altersspezifischen Geburtenraten der über 30-jährigen Frauen, allerdings können die sehr niedrigen Geburtenraten der unter 30-jährigen Frauen dadurch nicht ausgeglichen werden, sodass die Kinderzahl insgesamt (TFR) bei 1,4 Kindern pro Frau liegt.
Abbildung 17: Kumulierte altersspezifische Fruchtbarkeitsziffern (ASFR) und Geburtenrate (TFR); alte und neue Bundesländer: 1996-2009
Damit zeigt sich einerseits, dass die Muster der jungen Schwedinnen bei der Entscheidung für Kinder denen der Frauen in Deutschland im Vergleich dieser Länder am ähnlichsten sind. Gleichzeitig werden in Schweden zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr allerdings deutlich mehr Kinder geboren als in Deutschland. Unter einer demografischen Perspektive werden dort insgesamt so viele Kinder geboren, wie für die Bestanderhaltung der schwedischen Bevölkerung in etwa erforderlich ist. Offenbar sind die Rahmenbedingungen der Partizipation der jungen schwedischen Frauen an den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen der beruflichen Qualifikation, der beruflichen Karriere und der Organisation des Familienlebens so ausgestaltet, dass die Entscheidung für Kinder im höheren Lebensalter zwischen 30 und 40 Jahren auch subjektiv möglich erscheint. [55]Die Attraktivität des schwedischen Modells kann hier nicht auf ihre Ursachen hin untersucht werden, ob beispielsweise eher familienpolitische oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wirksam sind oder ob andere Berufe überwiegen, in denen die Entscheidung für Kinder und die Karriereentwicklung leichter aufeinander bezogen werden können.
Abbildung 18: Kumulierte altersspezifische Fruchtbarkeitsziffern (ASFR) und Geburtenrate (TFR); Frankreich, Schweden und USA: 1996-2007
[56]Andererseits zeigt der Vergleich der hier betrachteten europäischen Länder mit den USA, dass die USA bei den jungen Frauen ein völlig anderes Muster aufweisen. Denn dort werden auch heute noch bis zum 24. Lebensjahr der Frauen bereits 0,8 Kinder pro Frau geboren, während es in Deutschland, Schweden und Frankreich zwischen 0,2 und 0,4 Kinder pro Frau sind (vgl. Abb. 17 und 18). Damit zusammenhängend ist die USA das einzige der hier verglichenen Länder, in dem auch heute noch der weit überwiegende Teil der Kinder von den unter 30-jährigen Frauen geboren wird.
Daran zeigt sich einerseits im Kontrast zu Furstenbergs (2004) Vorschlag, dass die übliche wohlfahrtsstaatliche Typologie, welche die USA als liberalen, Frankreich und Deutschland als konservativen und Schweden als sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat klassifiziert, keine theoretische Aussage über die Entscheidung für Kinder vor dem 30. Lebensjahr zulässt. Denn in den USA, wo Pflegeleistungen privat organisiert werden müssen (Hochschild 2000, 2012), fallen die institutionellen Unterstützungsleistungen für Kinder im Vergleich zu Deutschland, insbesondere aber auch im Vergleich zu Frankreich und Schweden, deutlich geringer aus.
Ebenso wenig können Variationen in der Unsicherheit am Arbeitsmarkt für diese Unterschiede verantwortlich gemacht werden, denn die Frauen in Deutschland, Schweden und Frankreich haben ihre Kinderzahl vor dem 25. Lebensjahr überall deutlich eingeschränkt, obwohl das Risiko der Jugendarbeitslosigkeit sich in diesen Ländern deutlich unterscheidet. So ist die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland heute niedriger als in allen anderen europäischen Staaten (Statistisches Bundesamt 2012b) und auch in historischer Perspektive ist Deutschland von der Jugendarbeitslosigkeit viel weniger betroffen gewesen als etwa die nordeuropäischen Länder. In Schweden liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 20 bis 25 Prozent und wie in Finnland oder Frankreich gestaltet sich der Übergang ins Beschäftigungssystem für junge Erwachsene dort noch schwieriger als in Deutschland (Mischke 2009).
Somit unterstützen die Daten vielmehr die These, dass die einzelnen Frauen die Geburten auf der individuellen Ebene in Deutschland und etwas weniger ausgeprägt in Schweden zunehmend vor dem 30. Lebensjahr aufgeschoben haben (Sobotka 2004), während das für die USA nicht gilt. Diese frühere Entscheidung vieler amerikanischer Frauen für Kinder ist aus ihrer Lebensperspektive heraus durchaus nachvollziehbar. Denn im Vergleich zu Deutschland findet der Berufseinstieg in den USA durchschnittlich an einem sehr viel früheren Zeitpunkt im Lebensverlauf statt.
Nach den Daten der Luxembourg Income Study von 2007 wird deutlich, dass sich in Deutschland noch etwa 70 Prozent der 18- bis 24-Jährigen in der Ausbildungsphase befinden, während dies in den USA nur auf 43 Prozent der Männer und 48 Prozent der Frauen zutrifft (vgl. Abb. 19). Zwar sind in beiden Ländern etwa zwischen 60 und 65 Prozent der jungen Menschen erwerbstätig, allerdings sind das in Deutschland häufiger Nebenjobs während des Studiums, zur Ausbildung gehörende berufliche Tätigkeiten oder befristete Stellen. Das wird daran deutlich, dass in den USA fast die Hälfte der 18- bis 24-jährigen Männer und fast 40 Prozent der gleichaltrigen Frauen angaben, über das ganze letzte Jahr hinweg eine Vollzeitstelle ausgeübt zu haben. In einem solchen Normalarbeitsverhältnis standen demgegenüber nur etwa ein Fünftel der jungen Menschen in Deutschland. Entsprechend des früheren Berufseinstiegs und dem damit verbundenen [57]früheren Erreichen der ökonomischen Selbstständigkeit lässt sich gut nachvollziehen, dass sich in den USA deutlich mehr jüngere Menschen für Kinder entscheiden.
Abbildung 19: Ausgewählte Ausbildungs- und Berufscharakteristika 18- bis 24-Jähriger nach Geschlecht; Deutschland und USA: 2007
Neben der in den USA zu beobachtenden deutlich früheren ökonomischen Selbstständigkeit als Erklärung für die frühere Entscheidung für Kinder muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass in den USA schon zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr 0,2 Kinder pro Frau geboren werden. Das scheint angesichts der intensiven sozialpolitischen Diskussion und Maßnahmen um die Teenagerschwangerschaften nicht unproblematisch zu sein (Clinton 2013). Denn mit einer geringen Ausbildung und der Verantwortung für ein Kind sind die Möglichkeiten dieser sehr jungen Frauen zur beruflichen Qualifikation und zur Teilhabe am Arbeitsmarkt deutlich eingeschränkt.
2.5.3 Bildung und die Entscheidung für Kinder
Das in den USA zu beobachtende Muster des deutlich früheren Verlassens des Bildungssystems im Vergleich zu Deutschland hängt damit zusammen, dass die Bildungsexpansion in den USA weitgehend ausgeblieben ist. Denn obwohl auch dort der Zugang zum Bildungssystem mit dem Higher Education Act von 1965 durch die Einführung bedürftigkeitsorientierter finanzieller Unterstützungsleistungen für breite Gesellschaftsschichten geöffnet wurde und die Zahl der Studienanfänger sich seit 1965 um fast 300 Prozent erhöht hat, sind die Abschlussraten vierjähriger Collegestudiengänge seit 1970 unverändert geblieben (Brock 2010: 111ff.). Von den 75 Prozent eines Highschool-Jahrgangs, die sich am College immatrikulieren, bricht ein Viertel bereits nach einem Jahr ab und lediglich [58]einem Drittel gelingt der Collegeabschluss (Arnett 2004: 125; U.S. Census Bureau 2012). Die Gründe für diese hohen Abbruchquoten werden vornehmlich darin gesehen, dass das öffentliche Schulsystem unzureichend für das Leistungsniveau am College vorbereitet, der Betreuungsgrad unzureichend ist und in vielen Fällen Finanzierungsengpässe entstehen (Brock 2010; Arnett 2004). Denn nach der Öffnung des Bildungssystems Mitte der 1960er Jahre markierten die 1980er Jahre in den USA einen erneuten Wendepunkt in der institutionellen Gestaltung des Bildungssystems (Arnett 2004: 127ff.). Seitdem sind die Studiengebühren deutlich angestiegen und es werden weniger Stipendien vergeben.
Vergleicht man nun auf Basis amtlicher Daten den höchsten, erreichten Ausbildungsabschluss von Frauen und Männern im Alter von 30 bis 34 Jahren in den USA und in Deutschland, so wird deutlich, dass die junge Generation in Deutschland im Vergleich zu den USA insgesamt deutlich höhere Bildungsabschlüsse erreicht (vgl. Abb. 20). Denn in den USA haben etwa zwei Drittel der 30- bis 34-jährigen Männer und fast ebenso viele der gleichaltrigen Frauen als höchsten, qualifizierenden Abschluss einen Highschoolabschluss. Demgegenüber hat in Deutschland über 80 Prozent der Anfang 30-jährigen Frauen und Männer einen Berufsabschluss oder Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss, während ein Fachabitur oder Abitur ohne weitere Berufsqualifikationen in Deutschland äußerst selten ist. Der Anteil derjenigen mit Collegeabschluss liegt in den USA zwar deutlich höher als der Anteil der Hochschulabsolventen in Deutschland, allerdings hat der Großteil der Absolventen in den USA bis zum Bachelor studiert, während es sich in Deutschland überwiegend um höher qualifizierende Diplom-, Magister- und Masterabschlüsse handelt.
Abbildung 20: 30- bis 34-jährige Frauen und Männer nach dem höchsten Ausbildungsabschluss: USA 2012 und Deutschland 2008
Wie schon beschrieben, weisen die USA und Deutschland auch deutliche Unterschiede beim durchschnittlichen Erstheiratsalter auf. Während dieses für die Frauen in Deutschland [59]zwischen 1972 und 2010 von 23 auf 30 Jahre angestiegen ist, hat es sich in den USA im gleichen Zeitraum nur von 21 auf 26 Jahre erhöht. Betrachtet man die regionale Verteilung des durchschnittlichen Erstheiratsalters in den USA, so wird besonders spät in den Staaten geheiratet, in denen ein großer Anteil an hoch Gebildeten lebt. Beispielsweise liegt es in Massachusetts, wo 2009 fast 40 Prozent der über 25-Jährigen einen Collegeabschluss aufweisen (U.S. Census Bureau 2012: 153), für die Frauen bei 28 und für die Männer bei 29 Jahren (Simmons/Dye: 22). Im District of Columbia, in dem sogar fast 50 Prozent der über 25-Jährigen einen Collegeabschluss und mehr als die Hälfte davon einen Master- oder Doktorabschluss haben, liegt das Erstheiratsalter sowohl für Frauen als auch für Männer bei 30 Jahren. Demgegenüber weisen Staaten wie beispielsweise West Virginia, Arkansas oder Oklahoma, in denen nur knapp jeder fünfte einen Universitätsabschluss erreicht, ein junges durchschnittliches Erstheiratsalter von 22 bis 23 Jahren auf (U.S. Census Bureau 2012: 153; Simmons/Dye: 22).
Die regionalen Unterschiede machen deutlich, dass in den ländlich strukturierten Regionen mit geringerem Ausbildungsniveau weiterhin dem Muster des frühen beruflichen Einstiegs und der frühen Eheschließung gefolgt wird. So kommen auch Lesthaeghe und Neidert (2006: 683) 20 Jahre nach der Entwicklung der Theorie des Zweiten Demografischen Übergangs für die USA zu dem Schluss, dass sich dieser stärker in Regionen mit einem größeren Anteil an hoch Gebildeten sowie eher in reicheren Metropolregionen vollzog. Die späte Eheschließung und der Aufschub der ersten Geburt zeigen sich demgegenüber nicht unbedingt in Regionen mit einem geringeren Bildungsgrad und einer ländlich sowie sehr religiösen Prägung, was insbesondere auf den mittleren Westen und den Südosten der USA zutrifft (ebd.: 694).
Die Lebensphase des sich entwickelnden Erwachsenenalters, verbunden mit einer längeren individuellen Orientierungsphase, scheint sich damit nicht überall gleichermaßen entwickelt zu haben. Die deutlichen regionalen Unterschiede innerhalb der USA, die eng mit den strukturellen Differenzen in der Bildungspartizipation zusammenhängen, deuten vielmehr darauf hin, dass die Entscheidung für Kinder auch auf der individuellen Ebene in einem engen Zusammenhang mit dem Bildungsniveau der Frau steht.
Abbildung 21 zeigt für Deutschland, dass 1976 ebenso wie 2004 die Mütter mit dem geringsten Bildungsabschluss die meisten Kinder haben. Auch 1976 hatten Mütter mit Abitur und Fachhochschulreife nur 1,6 Kinder pro Frau, demgegenüber lebten 2,03 Kinder pro Frau bei Müttern mit Volksschulabschluss. Heute liegt die Relation bei 1,2 zu 1,6 Kindern pro Frau. In beiden Gruppen sind die Kinderzahlen deutlich zurückgegangen, aber die Relation der verschiedenen Kinderzahlen nach Bildungsabschluss ist keinesfalls eine neue Entwicklung in Deutschland. Bei den Männern sind die Differenzen zwischen den Bildungsabschlüssen nicht so stark ausgeprägt, jedoch hat die Kinderlosigkeit bei den Männern stärker zugenommen als bei den Frauen (vgl. Abb. 22). Waren 1976 nur 15 Prozent der Akademiker kinderlos, so leben heute 35 Prozent von ihnen im Alter zwischen 41 und 45 Jahren ohne Kinder. 1976 war zudem der Anteil der kinderlosen Männer, die keine berufliche Qualifikation hatten, mit 23 Prozent deutlich höher gegenüber dem der kinderlosen Akademiker, während die Differenz heute mit 35 Prozent Kinderlosigkeit unter den Akademikern gegenüber 37 Prozent unter denjenigen ohne eine berufliche Ausbildung relativ gering geworden ist. Damit ist festzuhalten, [60]dass bei Männern das Zusammenleben mit Kindern in keinem eindeutigen Zusammenhang mit ihrer Ausbildung steht, während das Ausbildungsniveau bei Frauen ein relativ guter Prädiktor für die Zahl der Kinder und die Kinderlosigkeit ist. 1976 lebten etwa 25 Prozent der 41- bis 45-jährigen Frauen mit einem (Fach-)Hochschulabschluss ohne Kinder. Bei den gleichaltrigen Frauen ohne Berufsabschluss waren es nur 11 Prozent. Die Kinderlosigkeit von Akademikerinnen, genauso wie ihre im Durchschnitt geringere Kinderzahl, ist damit kein neues Phänomen, sondern ein typisches Kennzeichen für akademisch qualifizierte Frauen. Beim Vergleich der Entwicklung zwischen 1976 und 2004 wird allerdings deutlich, dass die Kinderlosigkeit bei den Akademikerinnen um etwa 12 Prozent zugenommen hat und bei denjenigen ohne einen Abschluss von 11 auf 26 Prozent angestiegen ist, also um 15 Prozent. Kinderlosigkeit ist damit kein spezifisches Problem hoch qualifizierter Frauen, sondern betrifft in zunehmendem Ausmaß auch Frauen mit wie auch Frauen ohne Berufsausbildung.
Abbildung 21: Durchschnittliche Anzahl der Kinder nach dem höchsten Schulabschluss und Geschlecht; alte und neue Bundesländer: 1976, 1991 und 2004
[61]Abbildung 22: Kinderlosigkeit nach dem letzten beruflichen Ausbildungsabschluss und Geschlecht; alte und neue Bundesländer: 1976, 1991 und 2004
Somit zeigt sich, dass beim Zusammenhang von Ausbildungsniveau und Geburtenrate drei Prozesse klar zu unterscheiden sind. Erstens ermöglicht die zunehmende Qualifikation den jungen Frauen vermehrt berufliche und andere Lebensoptionen zu nutzen, welche ihrerseits offensichtlich weniger mit der Entscheidung für Kinder zusammenpassen (vgl. Kap. 4.6.2). Dies hat auch schon 1976 dazu geführt, dass damals ein Viertel der Frauen mit höherer Qualifikation ohne Kinder lebte. Dieser Zusammenhang wurde für die USA schon Mitte der 1990er Jahre vom amerikanischen Büro für Statistik aufgezeigt (Bachu 1995). Zweitens ist festzustellen, dass die Kinderlosigkeit insgesamt [62]von 1976 bis heute zugenommen hat und zwar auch bei den weniger qualifizierten Frauen und Männern. Das spricht dafür, dass in den Lebensoptionen und Lebensperspektiven dieser jungen Menschen andere Entscheidungen getroffen werden als noch 1976 – und dies über alle Bildungsgrade hinweg. Ob das als jener Wertewandel zu interpretieren ist, den van de Kaa und andere vermuten oder ob es strukturelle Faktoren für diese Veränderungen gibt, wird im weiteren Verlauf noch zu prüfen sein. Drittens ist festzuhalten, dass die Zunahme an akademisch ausgebildeten Frauen und die Abnahme von Frauen mit geringeren Qualifikationen zu einer höheren Kinderlosigkeit geführt hat.
Die deutlich höhere Qualifikation infolge der Bildungsexpansion hat auch weitreichende Konsequenzen für das Aufwachsen von Kindern. 1976 wurde noch mehr als die Hälfte aller Kinder von Müttern geboren, die keinen berufsqualifizierenden Abschluss hatten (vgl. Abb. 23); hingegen sind es 2008 noch knapp 20 Prozent und sogar fast 15 Prozent der Kinder leben bei Müttern mit einem akademischen Abschluss. Der Großteil der Kinder lebt heute bei berufsqualifizierten Müttern. Auch hier zeigt sich die bereits diskutierte Bildungsdiskrepanz zwischen Deutschland und den USA. Die deutschen Mütter weisen ein erheblich höheres Maß an Qualifikation auf als die amerikanischen Mütter. Darin spiegelt sich auch wieder, dass in den USA, wie bereits diskutiert, noch sehr viele Kinder von sehr jungen Müttern geboren werden und das teilweise in einem Alter, in dem noch kein allgemeiner Schulabschluss erreicht sein kann, geschweige denn ein Collegeabschluss.
Abbildung 23: Kinder nach dem höchsten Ausbildungsabschluss der Mutter; alte Bundesländer 1976, 1991, 2008 und USA 2008
[63]Die Möglichkeit von Familien, ihre Kinder in der kognitiven und emotionalen Entwicklung zu fördern, ist jedenfalls in Deutschland deutlich gestiegen, wenn man davon ausgeht, dass die Qualifikation der Mütter wie auch der Väter für die Entwicklung der Kinder einen positiven Effekt hat. In vielfältiger Weise wurde von der empirischen Bildungsforschung nachgewiesen, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Qualifikationsniveau der Mütter und dem erreichten Ausbildungsabschluss der Kinder besteht (Ehmke/Baumert 2007; Krüger et al. 2010).
Ohne wie Ariès oder Lesthaeghe und van de Kaa darüber zu spekulieren, ob die heutigen jungen Mütter stärker als ihre eigene Müttergeneration ihre persönliche Lebensperspektive und ihr eigenes Wohlbefinden betonen, lässt sich hier objektiv auf der Basis empirischer Zahlen festhalten, dass die heutige Kindergeneration in der Förderung ihrer Fähigkeiten auf eine qualifizierte Müttergeneration vertrauen kann, die es historisch in dieser Form in Deutschland noch nie gegeben hat. Auch die manchmal in der Gesellschaft geäußerten Befürchtungen, dass sich vor allem die weniger qualifizierten jungen Frauen für Kinder entscheiden, lassen sich im Vergleich zwischen 1976 und heute nur dahingehend zurückweisen, dass heute nur noch ein knappes Fünftel der Kinder eine Mutter ohne eine qualifizierte Berufsausbildung hat, während es zu den Zeiten der hohen Geburtenraten fast die Hälfte war. Dieser Qualifikationsschub der Mütter lässt sich für die USA nicht in gleicher Weise dokumentieren. Dort leben zwar auf der einen Seite 40 Prozent der Kinder bei Müttern mit einem Bachelor- oder Masterabschluss oder zumindest einigen Jahren Collegebesuch, aber auf der anderen Seite eben auch 60 Prozent bei Müttern, die nur einen Highschool- oder einen niedrigeren Schulabschluss haben.
2.5.4 Von der skeptischen zur überforderten Generation
Schaut man auf die bisherigen Ergebnisse zum Wandel der Lebensläufe, so lässt sich konstatieren, dass sich die klassische Reihenfolge der Lebensereignisse von Partnerschaft, Hochzeit und Geburt des ersten Kindes, welche so noch von der skeptischen Generation gelebt wurde, heute weitgehend aufgelöst hat. Diejenigen jungen Menschen, die das Elternhaus verlassen, entscheiden sich in einem Alter von unter 25 Jahren viel seltener für die Ehe und leben sowohl in Deutschland als auch in den USA stattdessen öfter alleine oder in Wohngemeinschaften. Das sich entwickelnde Erwachsenenalter, innerhalb dessen junge Menschen verschiedene Optionen abwägen und ausprobieren, entsteht als Lebensphase aus einer relativ neuartigen kulturellen Orientierung, die sich zusammen mit der längeren Ausbildungsphase und einer vielfältigeren, aber auch unsicheren Berufswelt entwickelt hat. Die längere Ausbildungsphase sowie die spätere ökonomische Selbstständigkeit, welche infolge der Bildungsexpansion in Deutschland sehr viel stärker ausgeprägt ist als in den USA, führt zur Verschiebung der Familiengründung auf einen deutlich späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf. Als Konsequenz dieses Aufschubs der Geburt des ersten Kindes und gleichzeitigem Anstieg der Geburten bei den Frauen jenseits des 30. Lebensjahres, ist eine erstaunliche Verdichtung der Entscheidung für Kinder festzustellen.
[64]Um dies zu visualisieren zeigt Abbildung 24 eine idealtypische Darstellung der Heiratsmuster und Fertilität in der Entwicklung von 1970 bis heute. Daraus geht hervor, dass Frauen 1970 einen relativ großen Zeitraum ihres Lebens der Phase der Reproduktion und Sozialisation ihrer Kinder gewidmet haben, mit der Geburt des ersten Kindes zwischen dem 23. und 24. Lebensjahr und der Geburt des letzten Kindes in einem Alter von 31 Jahren. Wird das Aufwachsen des letztgeborenen Kindes im Elternhaus mit weiteren 15 Jahren angenommen, umfasst diese Phase fast ein Drittel ihres Lebens, vom Ende ihrer Jugendzeit bis zum 46. Lebensjahr. Demgegenüber hat sich bei den Frauen 2009 der Zeitraum für die Phase der Reproduktion und Sozialisation der Kinder deutlich verkürzt. So wird das erste Kind mit dem 29. Lebensjahr geboren und das letzte Kind mit etwa 33 Jahren, also innerhalb von rund vier Jahren, gegenüber knapp acht Jahren um 1970. Hinzu kommt eine gestiegene Lebenserwartung von 75 auf 85 bis 90 Jahre, sodass Frauen heute weniger als ein Viertel ihres Lebens für die Phase der Reproduktion und Sozialisation ihrer Kinder aufwenden. Gleichzeitig, und das ist mindestens ebenso wichtig, gibt es eine zunehmend größere Gruppe von Frauen, die nicht heiratet und kinderlos bleibt.
Abbildung 24: Heiratsmuster und Fertilität von Frauen nach Alter; alte Bundesländer: 1970, 1990 und 2009
Bei einer eher kurzen Lebenserwartung und einer höheren Zahl von Geburten ist die Entscheidung für Kinder immer auch eine Entscheidung, das eigene Leben im Wesentlichen der Reproduktion und Sozialisation der Kinder zu widmen. Wenn aber diese nicht einmal mehr ein Viertel des gesamten Lebenslaufs ausfüllt und auch die gesellschaftlich als aktiv angesehene Lebenszeit bis zum 65. Lebensjahr davon allenfalls zu einem Drittel oder zur Hälfte bestimmt ist, wird dieser als natürlich gesehene Zusammenhang zwischen Mutter- und Frauenrolle aufgebrochen. Dies ist ein evolutionärer Prozess, der nicht zwingend auf einem Wertewandel, der Emanzipation oder auf einem gesellschaftlichen Strukturwandel durch ökonomische Veränderungen basieren muss. [65]Durch die zunehmende Lebenserwartung und die Verdichtung der Reproduktionsphase ist eine neue Situation entstanden, in der keine junge Frau mehr davon ausgehen kann, dass ihr ganzes Leben sinnvoll durch die Fürsorge und die Erziehung der Kinder ausgefüllt sein kann.
Diese evolutionäre Veränderung des Lebenslaufs von Frauen wird zusätzlich noch dadurch verstärkt, dass sich ein immer größerer Anteil an Frauen erst spät für Kinder entscheidet, sodass die Entscheidung zur Mutterschaft heute im Lebenslauf von Frauen eine völlig andere Bedeutung gewinnt. Um 1950 konnten die jungen Frauen noch hoffen, orientiert an den Lebensverläufen ihrer Mütter, dass die Entscheidung für viele Kinder ein sinnvolles und in der Partnerschaft mit dem Mann auch befriedigendes Leben ermöglichen würde. Die eigene Erwartung an das Leben nach den Kindern konnte noch gar nicht entwickelt sein, weil es einen solchen Lebensabschnitt vorher nicht gab. Heute kann keine junge Frau mehr für sich die Vorstellung haben, dass das eigene Leben mit der Entscheidung für Kinder und für eine Partnerschaft bis zum 80. oder 90. Lebensjahr wirklich ausgefüllt ist.
Der skeptischen Generation wurde durch die damalige soziale, politische und wirtschaftliche Entwicklung die Möglichkeit gegeben, ihre Sicherheits- und Autonomievorstellung als junge Erwachsene auch umzusetzen. Ein früher Berufseintritt und eine relativ große ökonomische Sicherheit ermöglichte dieser Generation die Familiengründung und -entwicklung. Zugleich verminderte der sich entwickelnde Sozialstaat die Lebens- und Krankheitsrisiken, denen noch die eigenen Eltern ausgesetzt waren. Die Lebensentwürfe der skeptischen Generation, die sich durch klar strukturierte berufliche Laufbahnen und eine darauf bezogene Familienplanung sowie durch eine geschlechtsspezifische Aufgabenteilung innerhalb der Familie auszeichneten, entwickelten sich allerdings innerhalb einer industriell organisierten Arbeitswelt.
Demgegenüber ist die heutige Generation der 20- bis 40-Jährigen in dieser großen Sicherheit aufgewachsen und hat viele Bildungschancen nutzen können. Insbesondere für Frauen ist die Möglichkeit entstanden, auf Basis der eigenen Qualifikation ihre gesellschaftliche Teilhabe im Berufsleben zu realisieren (Oppenheimer 1988). Diese Generation erfährt aber nun, dass die Lebenswege selbst bei einer hohen beruflichen Qualifizierung mit einem hohen Maß an struktureller Unsicherheit versehen sind, was die skeptische Generation so nicht erlebt hat. Denn die heutige wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft kennt keine klaren Übergänge mehr, dadurch muss die Planungsleistung in Bezug auf die Entwicklung des eigenen Lebenslaufs viel stärker von jedem einzelnen jungen Menschen selbst geleistet werden. Da die berufliche Perspektive durch die verlängerte Ausbildung und die ökonomische Unsicherheit für die meisten jungen Erwachsen aber noch gar nicht absehbar ist, bleibt für den Einzelnen lange unklar, inwiefern überhaupt eine Situation materieller Sicherheit erreicht werden wird. Denn es fehlt eine klare perspektivische Struktur, mit Hinblick auf die Organisation des Lebenslaufs und die Gewissheit, dass sich die eigenen Erwartungen auch umsetzen lassen.
Dazu kommt, dass die Phase des Übergangs in das Berufsleben und die berufliche Etablierung für einen Großteil der jungen Erwachsenen zeitlich mit der Entscheidung für Kinder kollidiert. Da durch die beruflichen Erwartungen die Zeit für den Aufbau privater Beziehungen knapp wird, sind auch im privaten Lebensbereich die Strukturen [66]zum Aufbau von dauerhaften und sicheren Beziehungen viel schwieriger geworden. Trotzdem muss in dieser mehr oder weniger kurzen Lebensphase über zwei Dinge grundsätzlich entschieden werden, die in dieser Situation leicht als sich ausschließende Alternativen erlebt werden. Diese Rushhour des Lebens (Bertram 2007) führt dazu, dass Lebensentscheidungen, die lange als ein Nacheinander im Lebenslauf erlebt wurden, nun simultan zu lösen sind, weil das organisatorische Muster von einst nicht mehr passt. Gleichzeitig sind die ökonomischen Existenzbedingungen – wie später noch vertieft wird – nicht ausreichend, um einen Teil dieser Gegensätze mit Hilfe ökonomischer Ressourcen auszugleichen. Bei relativ geringem Einkommen und einer mühsam erarbeiteten sicheren ökonomischen Lebensperspektive stellen die Entwicklung der Familienbeziehungen und die Fürsorge für Kinder sehr komplexe Herausforderungen an die nachwachsende Generation dar, denen sich die skeptische Generation nicht in dieser Weise gegenüber sah. Deswegen bezeichnen wir diese Generation als überforderte Generation.
Die Optionen der beruflichen Qualifizierung und der Entscheidung für Kinder stellen aber im Grundsatz keine Alternativen dar, wären die Lebensläufe so organisiert, dass diese Lebensentscheidungen nicht als ein entweder… oder… erscheinen müssten. Praktisch erleben die jungen Erwachsenen diese Überforderung heute aber, weil die Frage, wie ein neuer Lebenslauf aussehen kann, in dem sich die verschiedenen Präferenzen für Kinder und für andere Lebensbereiche, an denen man teilhaben will, so realisieren lassen, dass das eigene Leben subjektiv als sinnvoll erlebt werden kann, im politischen und öffentlichen Diskurs vollkommen ausgeblendet wird. Der politische Diskurs nimmt die neue Realität der Lebensentwürfe nicht ernst, sondern hält an denen fest, die vor fünfzig Jahren für die skeptische Generation angemessen waren.
Arlie Hochschild beschreibt den Aufbruch des institutionell und politisch gestützten Lebenslaufs auch als Vermarktlichung (Hochschild 1995, 2000, 2012). Denn für die heutige junge Generation ist die potentielle Chance auf Selbstverwirklichung innerhalb selbst gewählter Kontexte durch die je individuellen Verwirklichungschancen begrenzt, die der Markt dem Einzelnen bietet. Das impliziert auch die Ausgrenzung aus denjenigen Chancen, in denen das eigene Profil der Marktnachfrage widerspricht. Diese Situation der Verschließung bestimmter Optionen verstärkt sich, sobald ein junges Paar sich für ein Kind entscheidet. Denn die von der Arbeitswelt und der Politik geschätzten Charakteristika des immer erreichbaren, mobilen und flexiblen Menschen (Sennett 1998) stehen in einem grundsätzlichen Konflikt mit der Organisation von räumlich und zeitlich aufeinander bezogenen Liebes- und Familienbeziehungen.
Infolge des Strukturwandels der letzten 40 Jahre hat sich der Konflikt zwischen Markt- und Privatleben damit deutlich verschärft, wie Hochschild (2012) in ihrer neusten Analyse des privaten Lebens deutlich macht. Nach Hochschild gefährdet die zunehmend hegemoniale Stellung des Marktes das Gleichgewicht von Ökonomischem und Sozialem, weil immer größere Bereiche, die ehemals marktfern und privat organisiert waren, kommerzialisiert werden. Zwar stützen sich Hochschilds Thesen auf eine umfangreiche Feldforschung in den USA, dennoch zeichnet sich die von ihr beschriebene Vermarktlichung der Lebensführung auch in den europäischen Gesellschaften ab. Auch dort werden der ökonomische Erfolg und das ökonomische Wachstum der Gesellschaft [67]zum Maßstab des individuellen Handelns und der gesellschaftlichen Entwicklung herangezogen, sodass die Fürsorge für andere und der Aufbau intensiver personaler Beziehungen zu anderen diesem ökonomischen Primat nachgeordnet werden.
Die skeptische Generation hat noch über die innerfamiliale Arbeitsteilung versucht, die Fürsorge und die Beziehungen über eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu sichern. Hochschild nennt dieses Modell traditional-warm (1995) – traditional, weil die Zuständigkeiten klaren, gesellschaftlichen Vorgaben folgten, aber auch warm, weil es in diesem Modell überhaupt einen sozial definierten Raum für Fürsorge gab. Es ist jedoch festzuhalten, dass es nun keinen Weg zurück in dieses Lebensmodell gibt, denn die Entwicklung hochmoderner Industriegesellschaften mit ihren ausdifferenzierten Dienstleistungsanteilen war nur möglich, weil die zunehmende Qualifikation der jungen Frauen in den 1980er Jahren die Möglichkeit schuf, viele dieser neu entstandenen Aufgaben auch tatsächlich zu bewältigen.
Darüber hinaus sind die Konsequenzen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung heute hinreichend bekannt. Sie hat in der Neuzeit in allen Gesellschaften zu einer strukturellen Ungleichheit zwischen Mann und Frau geführt, denn das ökonomische Primat wurde nur vom Mann erfüllt. Der Theorie nach führte die Frau zwar gleichwertige Tätigkeiten im Haushalt aus, in der Praxis aber war die ganze Familie vom ökonomisch fürsorglichen Mann abhängig. Die Aufhebung dieser strukturellen Benachteiligung hat jedoch nicht dazu geführt, dass Männer und Frauen heute gleichberechtigt an der ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft teilhaben, wie in Kapitel 4 vertieft wird. Vielmehr ist zunächst nur zu konstatieren, dass vor allem diejenigen, die auch Fürsorge und Beziehungen als einen Teil der eigenen Lebensperspektive betrachten, in allen Lebensbereichen entsprechend mehr leisten müssen und doch permanent mit dem Gefühl kämpfen, in keinem Bereich so viel leisten zu können, wie man es eigentlich könnte und müsste. Hier ist Arlie Hochschild nur zuzustimmen, wenn sie viele Vereinbarkeitslösungen als kalt-modern (1995) bezeichnet, weil nicht die Frage im Mittelpunkt steht, wie Fürsorglichkeit und personale Beziehungen in der Gesellschaft entwickelt werden können, sondern vor allem, wie sich die Bedürfnisse nach Fürsorge und Beziehungen so outsourcen lassen, dass dem ökonomischen Primat hoch entwickelter Industriegesellschaften gefolgt werden kann (Hochschild 2012).