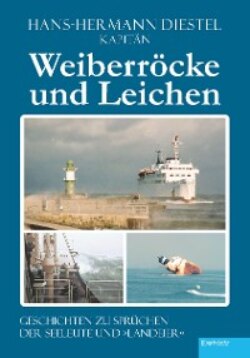Читать книгу Weiberröcke und Leichen - Hans-Hermann Diestel - Страница 8
AM ANFANG WAR DAS SCHIFF
ОглавлениеVor ein paar Jahren hatten wir, meine Frau und ich, im Alten Land ein Haus gemietet, damit ich vom Ufer aus die auf der Elbe verkehrenden Schiffe fotografieren konnte. Neben mir stand oft ein noch nicht einmal vierzehn Jahre alter Junge aus dem Ruhrgebiet, der dieses Hobby wie ein Profi betrieb. Schiffe ziehen die Menschen an, egal ob sie klein oder groß sind. Es heißt nicht umsonst: Ihre Zahl ist Legion.
Im Lexikon Seefahrt (1981) findet sich folgende nüchterne Definition zum Schiff: Wasserfahrzeug, das allgemein zum Transport von Personen oder Gütern auf dem Wasserwege vorgesehen ist. Mit dieser Definition wird kein Seemann, der sein „Brotschiff“ liebt, zufrieden sein. Andererseits habe ich oft Beschreibungen zu einem Schiff gelesen, die ich einfach für albern halte. Als nüchterner Mecklenburger habe ich mit den folgenden Worten Basil Lubbocks, die er in seinem Buch „The Log of the CUTTY SARK“ zu dem berühmten Tee- und Wollklipper schrieb, meine Probleme: Ihre Geschwindigkeit ist ihr Hauptanspruch für ihre Berühmtheit. Sie hatte viele andere Charakteristiken, die wir nicht negieren dürfen. Als Segelschiff hatte sie einen Charakter, der genauso komplex war wie der eines Menschen. Daraus entstehen eine spezielle Faszination und ein ewiges Interesse derjenigen, die sie führten. Sie hatte ihre Macken, ihre Tage sanfter Vernunft und sie hatte ihre Tage schlechten Temperaments und des Eingeschnapptseins. Es gab Dinge, die sie mochte, und es gab Dinge, die sie nicht mochte. Sie konnte auf jede Aktion eines Mannes reagieren und sie konnte, wie ein bockendes Pferd, dies nicht tun.
Da halte ich es doch viel eher mit Joseph Conrad, der in „Der Spiegel der See“ schrieb: Schiffe sind in Ordnung: Es sind die Männer in ihnen.
Zur grundsätzlichen Bedeutung des Schiffes hat Arved Fuchs in dem Buch zum Internationalen Maritimen Museum in Hamburg „Am Anfang war das Schiff“ die folgenden bemerkenswerten Worte geschrieben: Kein anderes Transportmittel hat die Geschichte der Menschheit so beeinflusst wie das Schiff. Es ist das älteste und geschichtsträchtigste Fahrzeug aller Zeiten. Mit ihm verbinden sich gleichermaßen Abenteuer, Handelsinteressen, Mythen, Tragödien und Poesie. Bezieht man die Seekriegsgeschichte mit ein, sind sie gewissermaßen auch ein Spiegelbild der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Es sind die mutigen Entdeckungsreisen eines Fernando Magellan oder eines James Cook, aber auch die kühnen Fahrten früher Handelsreisen wie der Hanse oder der Ostindienkompanie, die die Welt zu der gemacht haben, die sie heute ist. Ohne Schiffe wären keine fremden Kontinente entdeckt und keine neuen Handelswege erschlossen worden …
Der britische Teeklipper CUTTY SARK im Dock in Greenwich, bevor er die heutige Form als Museum erhielt
Arved Fuchs bestätigt damit den alten griechischen Spruch:
Manch einer meint die Reiter,
ein anderer die Pferde,
ich aber sage Euch,
die Schiffe sind der Menschen höchstes Gut.
Die Menschheit hat einen langen Weg vom Einbaum zum 19.000-TEU-Container-Schiff zurückgelegt. Die Seeleute hatten zuerst allen Grund, sich mit ihren Nussschalen an der Küste entlangzutasten und um Gottes willen nicht den Spruch
Oh Gott, der Ozean ist so groß,
und mein Schiff so klein
zu vergessen. Zwischen dem Einbaum und dem Containerschiff liegen neben anderen bemerkenswerten Typen die Dschunken der Chinesen.
Chinesische Dschunke 1977 im Hafen von Hong Kong
Sie haben mit ihnen außergewöhnliche Reisen vollbracht und sind auf diesen Reisen zu dem bemerkenswerten Schluss gekommen: Das Wasser, welches das Schiff trägt, ist dasselbe, das es verschlingt. Die Chinesen haben einen anderen Weg bei der Entwicklung ihrer Schiffe als die Europäer beschritten. Die Europäer, von denen sich gerne einige mit dem Titel „traditionelle Schifffahrtsländer“ schmücken, nahmen den Fisch als Vorbild für die Form ihrer Schiffe. Das ist ein logischer Gedanke. Die Chinesen wählten einen anderen, ebenso logischen Weg. Sie orientierten sich an den schwimmenden Wasservögeln, die mir ihrer Brust die Wellen brechen und mit ihren Füßen und dem Schwanz steuern. Hätten die Chinesen die Seefahrt am Anfang des 15. Jahrhunderts nach den Reisen Admiral Zheng Hes nicht abrupt aufgegeben, wären sie bei der Größe und Qualität ihrer Dschunken zweifellos die „traditionelle Seefahrernation“ geworden.
Die Größe der Schiffe entscheidet nicht allein über ihre Seetüchtigkeit. Das hat die Fischerei mit ihren Kuttern, Loggern und Trawlern, die am unteren Ende der Größenskala rangieren, immer wieder bewiesen. Max Moldenhauer, ein alter Wustrower Fischer, erzählte mir mit den folgenden Worten, wie er seine Schiffe gesehen hat: Wir fuhren immer ums Nordkap in die Barentssee, zehn Tage hin und zehn Tage zurück. Bei schlechtem Wetter dauerte das ja noch länger. Der Logger hatte ja nur eine Geschwindigkeit von 10 Knoten, der lief ja nichts. Außerdem hatten die Logger keine Back. Jedes bisschen Wasser kam an Deck, ganz besonders wenn die Logger nach dem Fischen abgeladen waren. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, auch weil wir bei Windstärke 10 und mehr nicht in die norwegischen Häfen einlaufen durften. Dann bist du da mit deinem Logger bei den Lofoten herumgehumpelt. In der Barentssee, wo wir auf Rotbarsch gefischt haben, musstest du zusehen, dass du mit deinem Schiff, genauso wie in der Nordsee, auf tiefes Wasser kamst. Auf tiefem Wasser sind die Wellen ja nicht so hoch und nicht so steil. Auf tiefem Wasser kann das Schiff das schwere Wetter besser abwettern. Im Skagerrak haben wir manchmal auf 18 Meter Wassertiefe gefischt. Wenn der Wind Bft. 8 oder 9 erreichte, musstest du zusehen, dass du mit deinem Kutter auf tieferes Wasser kamst. Dort hat uns Rasmus oft ordentlich einen eingeschenkt. Ich hatte insofern Glück, weil mein 26,5 Meter langer Kutter, mit dem ich später von Saßnitz aus gefahren bin, besser als ein Logger mit diesem Wetter klarkam. Die Logger fuhren immer in die See. Dann musste man wieder aufstoppen, damit das Wasser ablief. Später hat man die Logger in der Werft umgebaut und sie mit einer Back versehen. Mit den Loggern bist du oft genug zurückgetrieben. Du kamst wieder dahin, wo du hergekommen warst.
Bei der über Jahrhunderte verlaufenen Entwicklung der Schiffe ist es nicht verwunderlich, dass einige von ihnen sehr schnell als Missgeburt betrachtet wurden. Eine Idee, die die Natur ganz unzeremoniell zur Makulatur werden ließ, war die des unsinkbaren Schiffes. Das viktorianische Zeitalter näherte sich seinem Ende. Damals glaubten aber die herrschenden Eliten, ihren glorreichen Weg erfolgreich fortsetzen zu können. Ausdruck fand dies auch in immer schnelleren, größeren und luxuriöseren Schiffen, die unsinkbar sein sollten. Leise Zweifel kamen daran schon auf, als die REPUBLIC am 24. Januar 1909 vor der Insel Nantucket an der US-Ostküste nach einer Kollision mit dem italienischen Passagierschiff FLORIDA sank. Der White Star Liner war einmal das größte und schnellste Schiff auf dem Atlantik gewesen. Im Mai 1907 gab Edward John Smith, der spätere Führer der TITANIC, als Kapitän der ADRIATIC New Yorker Journalisten ein Interview. Währenddessen sagte er u. a.: … ein absolutes Desaster, das die Passagiere mit einbeziehen würde, ist unvorstellbar. Was auch immer passiert, es wird, bevor das Schiff sinkt, genug Zeit sein, um das Leben jeder einzelnen Person an Bord zu retten. Ich will noch etwas weiter gehen. Ich kann mir keine Umstände vorstellen, in denen das Schiff sinken könnte. Der moderne Schiffbau ist darüber hinaus. Es wird größere Schiffe geben. Im Moment scheint die Wassertiefe in den Häfen das größte Hindernis zu sein. Ich kann nicht sagen, wo die Grenze sein wird, aber größere Schiffe werden kommen …
Bei dem späteren Untergang der TITANIC handelte es sich nicht einfach um den Verlust des gerade größten Schiffes mit vielen Menschen. Es repräsentierte den Geist seiner Zeit, wie es nie wieder ein Schiff getan hat. Der Verlust dieses Schiffes traf die viktorianische Zeit ins Mark. Mit Smith und der TITANIC versank nicht nur die Idee des unsinkbaren Schiffes im Atlantik. Die schwedischen Seeleute prägten für Projekte dieser Größenordnung den Spruch: Kleine Boote schwimmen, während große Schiffe am Grunde sitzen bleiben.
In früheren Jahrhunderten unterschieden sich die Schiffe wie Tag und Nacht. Koggen, Dschunken und Dauen konnte man nicht verwechseln. Auch als die Dampfer und Motorschiffe ihren Siegeszug antraten, blieben zwischen den Schiffen enorme Unterschiede bestehen. Ein erfahrener Seemann konnte bei den meisten Schiffen erkennen, auf welcher Werft sie für welche Reederei gebaut worden waren. Die Schiffe von Reedereien wie Blue Funnel, British India, der DDG „Hansa“ („Felsdampfer“), Wilh. Wilhelmsen, KPM (Indonesien), Straits Steamships (Südostasien) oder die nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen und die in der DDR von der Warnowwerft in Warnemünde oder Neptun Werft Rostock gebauten Schiffe waren unverwechselbar. Diese Zeit ist vorbei. Ein großer Teil der Werften, die diese Schiffe bauten, existiert nicht mehr. Auch viele der früheren Auftraggeber sind von den sieben Weltmeeren verschwunden. Dazu zählen, bis auf Wilh. Wilhelmsen, alle von mir genannten Unternehmen. Ob das Schiff heute in China, Südkorea oder einer anderen Werft gebaut wurde, ist nicht mehr zu erkennen. Reeder waren in vielen Fällen auch Schiffsliebhaber. Sie waren stolz auf ihre Schiffe, so wie John Willis mit seiner CUTTY SARK oder die Reeder Laeisz mit ihren Schiffen. Heute könnten sie sich auch keine Extrawurst mehr braten. Heute gibt es nur noch Schiffe von der Stange.
Die Größe eines Schiffes spielte zu allen Zeiten eine große Rolle. Größe garantierte oft – nicht immer – eine verbesserte Wirtschaftlichkeit. Nicht alle Schiffe verursachten Begeisterungsstürme, weder bei den Auftraggebern noch bei den Seeleuten. Bei manchen ging es aufgrund besonderer Zeiten oder einer speziellen Situation nur darum, dass sie ihre Aufgabe möglichst gut erfüllten. Zu diesen Schiffen gehörten viele Typen, die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Das Urteil von Fachleuten über die in den USA gebauten Liberty-Schiffe und T-2-Tanker lautete: Schiffe gebaut nach der Meile und abgehackt von der Werft. Im Februar 1941 hatte Präsident Roosevelt das Notbauprogramm im Rundfunk verkündet, das den Bau von 200 Schiffen vorsah. Er bezeichnete diese Schiffe als furchtbar aussehende Objekte. Sie erfüllten ohne jeden Zweifel den Zweck, für den sie gebaut worden waren. Bei der Initiierung dieses Programms war nicht vorgesehen, dass sie nach dem Krieg noch jahrelang eingesetzt werden sollten. Das geschah aber und führte dazu, dass sie durchbrachen, im Sturm untergingen oder strandeten und viele Seeleute das Leben kostete. Einer der „Liberties“, die ARCHON GABRIEL, fand nach der Strandung auf der Greifswalder Oie am 8. Januar 1958 und der anschließenden Bergung durch Rostocker Schlepper seinen Weg als ERNST MORITZ ARNDT in die Flotte der Deutschen Seereederei Rostock. Die Kriegsbauten waren Ausnahmen in einer Zeit, in der Frachter, wie es der Schiffbauer Stig Bystedt im Seatrade Review (August 1996) sagte, wahrlich schön, ästhetisch schön selbst auf Kosten der wirtschaftlichen Funktionalität gebaut wurden. Das hat sich völlig geändert. Heute werden Back und Heck nach den Bedürfnissen des Containers und nicht für die Formschönheit oder Seetüchtigkeit eines Schiffes gebaut. Also dürfen sich die Seeleute mit Schiffen herumschlagen, die, wie die SVENDBORG MAERSK im Februar 2014 in der Biskaya, ganz schnell einmal 517 Container verlieren.
Das Liberty-Schiff ERNST MORITZ ARNDT (ex ARCHON GABRIEL) unter DSR-Farben
Solche Beispiele beweisen einmal mehr, dass die Briten mit dem folgenden Spruch recht haben: Lobe nicht ein Schiff, das noch auf dem Helgen liegt. Diesen Seemannsspruch kann man ohne Probleme auf die Schiffsform anwenden. Die Form von Bug und Heck hat einen entscheidenden Einfluss auf das Seegangsverhalten und die Manövrierfähigkeit des Schiffes. Nur sehr erfahrene Seeleute dürften in der Lage sein, Probleme in dem einen oder anderen Bereich während des Baus des Schiffes vorherzusehen. Wenn die Nachteile der Schiffsform im Alltag deutlich wurden, hatten die Seeleute sehr schnell diesen Umstand deutlich machende Begriffe und Namen für ihre schwimmenden Untersätze. Die Mecklenburger verwendeten Namen wie „Backtrog“, „Büffel“, „Brummküsel“ sowie „Dwars-“ und „Farkendriewer“. Gefährlich wurde schlechtes Manövrieren eines Seglers, wenn das Schiff schlecht steuerte. Das konnte vor allem beim Einlaufen dazu führen, dass der Segler auf Grund oder auf die Mole lief.
Einige Segler blieben durch derartige Seeunfälle, wie sie die Rostocker Bark SCHNELLE 1884 beim Einlaufen in Warnemünde hatte, lange in der Erinnerung der Seeleute. Sie strandete dadurch einmal vor der Mole und einmal hinter der Westmole. Die Brigg AUGUSTE lief aus dem Ruder und beschädigte am Ufer vertäute Boote. Jahre später kam sie als SLIWO wieder nach Rostock und lief beim Einlaufen, bevor sie die Molen passiert hatte, auf Grund.
Die Rostocker Segler sind ein Beispiel für die Richtigkeit der folgenden Worte von Rudyard Kipling: Niemand hat mir bis jetzt erzählt, dass das Meer aufgehört hat, das Meer zu sein. Die SVENDBORG MAERSK beweist, dass sie selbst auf die größten und modernsten Containerschiffe zutreffen.
In den Jahrzehnten meiner Seefahrt habe ich viele Schiffe gesehen, die heruntergewirtschaftet waren, die nicht nur äußerlich Rosteimer waren, sondern auf denen auch für die Sicherheit der Besatzung, des Schiffes und der Ladung lebenswichtige Anlagen nicht mehr funktionierten.
Wer, wenn nicht die französischen Seeleute, konnte den folgenden Spruch formulieren: An Schiff und Frau ist immer etwas auszubessern.
Die Franzosen gehen davon aus, dass man sich kümmert. Wenn Schiffe langsam, aber sicher „vergammelten“, tat es besonders weh, wenn man dies bei Schiffen beobachtete, auf denen man in ihren guten Zeiten gefahren war. Die ROSTOCK habe ich einmal von Stettin nach Rostock geführt, weil der sich an Bord befindende Springerkapitän Hannes Fünning dies nicht durfte. Nach ihrem Verkauf durch die DSR sah ich die ROSTOCK als PAULINE METZ auf der Reede von Larnaca wieder. Ich fotografierte sie, als wir im Frühjahr 1993 mit der THÜRINGEN auf dem Weg nach Fernost den zyprischen Hafen verließen. Die Aufbauten und die Außenhaut bestanden fast nur noch aus Rost. Die Reederei Metz war für den schlechten Zustand ihrer Schiffe, nicht nur äußerlich, im Mittelmeer bekannt. 1998, als ich schon bei Alpha Ship in Bremen war, lief ich mit der KOTA PERABU (ex TAURUS) in Hodeidah ein. Dort trafen wir auf die SHADWAN ISLAND (ex CHEMNITZ/KARL-MARX-STADT). Ich ging an Bord, um sie mir anzusehen. Lange hielt ich es bei den Ägyptern nicht aus. Auf der Brücke funktionierten die Radargeräte und andere für die sichere Führung des Schiffes nötigen Anlagen nicht mehr. Alle Räume waren dreckig. Der Salon des Kapitäns war davon nicht ausgenommen. Den mir von den Offizieren angebotenen Kaffee lehnte ich dankend ab.
Die SHADWAN ISLAND (ex CHEMNITZ, ex KARL-MARX-STADT) 1999 in Hodeidah, Jemen
Für die beiden ehemaligen Rostocker Frachter traf der Spruch Schön ist die Jugendzeit in vollem Umfang zu. Sie hatten bei der DSR eine Zeit erlebt, in der sich Reederei und Besatzung intensiv um sie kümmerten. Die Farben waren leider nicht immer die besten, aber die Besatzungen versuchten dies durch hohen Einsatz wettzumachen. Auch bei anderen Reedereien hatten die Neubauten in den ersten Jahren ihrer Existenz meistens ihre beste Zeit.
Die Geschwindigkeit eines Schiffes war für den ökonomischen Erfolg des Unternehmens und das Prestige des Kapitäns und des Reeders von enormer Bedeutung. Es ging aber auch anders. Fred Schmidt berichtete in seinem Buch „Schiffe und Schicksale“ über die folgende sehr amüsante Geschichte eines „Rennens“ zweier Schiffe, bei dem die Kapitäne Eile mit Weile walten ließen. Recht gemütlich entwickelte sich das „Wettsegeln“ zwischen den beiden Liverpooler Schiffen LORTON und COCKERTON, die die Mündung des Mersey zu einer Reise nach Portland in Oregon gemeinsam verließen. Sie lagen im Atlantik 40 Tage Seite an Seite. An einem Sonntag speiste der Kapitän der COCKERTON mit seiner Gattin auf freundliche Einladung des Kapitäns der LORTON an Bord des „Rivalen“. Und am folgenden Sonntag revanchierte er sich gebührend und bewirtete das „feindliche“ Kapitänspaar in seinem Salon. Innerhalb von 24 Stunden trafen sie am Bestimmungshafen ein. Einträglich verließen sie auch wieder Astoria Reede, und mit nur drei Tagen Vorsprung warf die LORTON in Le Havre Anker, ehe die COCKERTON in Dünkirchen ankam. Am gleichen Tag gingen sie aus ihren Löschhäfen ab, um Seite an Seite in den Mersey einzulaufen. 342 Tage waren sie über eine Strecke von mehr als 30 000 Seemeilen fast ohne Unterbrechung zusammen gesegelt.
Die Seefahrt hat bis in unsere Gegenwart viel mit Einsamkeit zu tun. Die beiden britischen Kapitäne und ihre Damen gingen sehr einfallsreich mit diesem Problem um. Wenn ihre Schiffe damals schon eine Maschine gehabt hätten, hätten sie das von den Briten so geliebte „socialize“, mit jemandem gesellschaftlich zu verkehren, nicht wahrnehmen können.
Etwas zu den Schiffen zu schreiben und die Maschine nicht zu erwähnen, geht gar nicht. Die Dampfmaschine und der Dieselmotor haben die Schifffahrt grundlegend verändert. Nicht immer gewährleistete das Vorhandensein einer Maschine, dass das Schiff den sicheren Hafen erreichte. Der 1893 gebaute Dampfschoner ROSINA von 182 BRT erlitt, ungeachtet seiner Dampfmaschine von 35 PS, Schiffbruch. Die HANSA berichtete 1903 in ihrer Nummer 3 über den Spruch des Seeamtes. Es kam zu der Auffassung, dass das Schiff 1902 auf der Reise von Frederiksstad nach Sunderland gesunken sei, weil es sehr rank war und dadurch kaum Segel führen konnte, weil die Ladung nicht gut verteilt war, weil die durch das Maschinenschott geführten Leitungen nicht wasserdicht gemacht worden waren, sodass Wasser aus dem Laderaum in den Maschinenraum strömte und die Pumpe aufhörte zu arbeiten, und weil die Antriebsmaschine für die Größe des Schiffes zu schwach war.
Die Viermastbark SEDOV (ex KOMMODORE JOHNSEN; ex MAGDALENE VINNEN) in der Warnowmündung
Ohne Schiffe würde es unsere heutige Welt nicht geben. Der kümmerliche Handel würde mit Kamelen über die Seidenstraße abgewickelt werden und die Welt deshalb um ein Vielfaches ärmer sein. Das letzte Wort zum Schiff soll Joseph Conrad haben. In seinen Werken werden immer wieder die tiefen Widersprüche, die Achtung, aber auch die Liebe zwischen dem Seemann und dem Schiff sowie dem Wetter deutlich. In „Spiegel der See“ schrieb er: Mit Menschen umzugehen ist eine ebenso große Kunst wie die, Schiffe zu führen. Beide, Menschen wie Schiffe, werden gleichermaßen von listenreichen und mächtigen Kräften bedrängt und wollen eher ihre Vorzüge verstanden als ihre Fehler erkannt wissen.