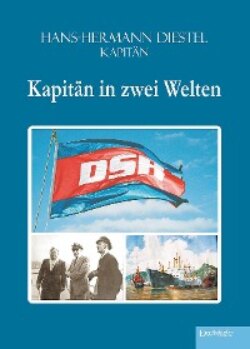Читать книгу Kapitän in zwei Welten - Hans-Hermann Diestel - Страница 9
Dienstausübung des Kapitäns aufgrund dieser Gesetze
ОглавлениеDie Rechtsgrundlagen für die Funktion des Kapitäns haben sich über Jahrhunderte evolutionär entwickelt. Es gab keine großen Sprünge. Dass aus dem Schiffer der Kapitän wurde, hat die Grundlagen seiner Arbeit nicht verändert. Das war eine Schönheitsoperation, mehr nicht. Es gab in der Entwicklung bis zum Zweiten Weltkrieg eine große Stetigkeit und eine solide Tradition in diesem Berufsstand. Wesentlicher Bestandteil für die Evolution in der Disziplinargewalt des Schiffsführers war, dass seine Möglichkeiten zu bestrafen immer weiter verringert wurden, bis ihm die Disziplinargewalt ganz entzogen wurde. Diese Entwicklung verlief bis heute unter den verschiedenen Flaggen nicht einheitlich. Während zum Beispiel ein deutscher Kapitän schon seit der ersten Seemannsordnung des Kaiserreiches keine Geldstrafe mehr aussprechen konnte, berichteten mir ausländische Besatzungsmitglieder, dass rumänische und kroatische Kapitäne dies durchaus noch im 21. Jahrhundert unter fremder Flagge taten. Im Seemannsgesetz der Bundesrepublik von 1957 konnte der Kapitän noch eine außerordentliche Kündigung aussprechen. Das lässt das Seearbeitsgesetz von 2013 nicht mehr zu. Eine außerordentliche Kündigung kann nur noch der Reeder veranlassen.
Die Seemannsordnung der DDR von 1953 gestattete dem Kapitän, in Abstimmung mit der Gewerkschaftsleitung eine Strafe in Höhe von 300 Mark zu erlassen. Als Kapitän des Typ-IV-Schiffes SCHWERIN habe ich 1974 meinem Ersten Offizier wegen maßlosen Alkoholmissbrauchs erst einen Verweis und dann einen strengen Verweis ausgesprochen. Kündigen konnte ich ihm nicht mehr, aber die Verweise waren die Voraussetzung dafür, dass seine Seefahrt beendet werden konnte.
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Kapitäns wurden von einer Generation mehr oder weniger entsprechend den erwähnten Gesetzen, Regelungen und der Überlieferung zur nächsten übergeben. Allerdings hatte die Schifffahrt große Mühe, den beachtenswerten Worten von Thomas Morus zu folgen, der gesagt hat: Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Das möchte ich mit einem Bogen, der von James Cook bis Franceso Schettino (COSTA CONCORDIA) reicht, verdeutlichen. Die Schifffahrt hat einzigartige Männer wie James Cook hervorgebracht. Ihm folgten Kapitäne wie Richard Woodget, Robert Hilgendorf und Gustav Schröder, die hervorragende Seeleute und exzellente Führer der ihnen anvertrauten Besatzungen in schwierigen Situationen waren.
Andere, wie William Bligh (BOUNTY), waren sehr gute Seeleute, versagten aber als Führer ihrer Besatzungen. Leider gab es aber auch solche, die weder gute Seeleute noch gute Führer ihrer Besatzungen waren. Zu ihnen möchte ich die Kapitäne Wallace und Bruce von der CUTTY SARK, James P. Barker von der BRITISH ISLES sowie Johannes Diebitsch von der PAMIR und Siegbert Rennecke von der BÖHLEN zählen. In diese Phalanx hat sich der italienische Kapitän Franceso Schettino nahtlos eingereiht. Darüber hinaus gab es zahlreiche Kapitäne, deren Rolle sehr umstritten ist. Zu ihnen gehört zweifellos Kapitän Edward J. Smith von der TITANIC. Mit einem Vergleich dieser Kapitäne in den Bereichen Seemannschaft und Führungstätigkeit möchte ich dem Leser aufzeigen, wo die Probleme und Schwierigkeiten für die Kapitäne lagen und wie leicht sie versagen konnten. In vielen Situationen benötigten sie exzellentes Wissen, lange und große Erfahrung sowie eine außergewöhnliche Entschlusskraft, um das Schiff oder zumindest die Menschen an Bord zu retten.
Für mich ist James Cook der Urvater des modernen Kapitäns. Er durchlief die harte Schule der Kohlesegler an der englischen Ostküste und wählte, als er Kapitän auf einem dieser Collier werden konnte, für seine weitere Laufbahn die Navy. Ein nur schwer nachzuvollziehender Gedanke, der von Mut, Entschlusskraft und Selbstbewusstsein zeugt. Ohne diesen Entschluss hätte es nie den Cook gegeben, den wir ohne die geringste Einschränkung bewundern dürfen. Bei der Navy nutzte er jede Chance, sich zu bilden, was ihm die Möglichkeit gab, die halbe Welt zu vermessen. Eine Haltung, die ich bei der Masse der heutigen Kapitäne vermisse. Selbst die sehr guten Bücher von Alan Villiers (Captain Cook The Seamen’s Seaman) und Bill Finnis (Captain James Cook Seaman and Scientist) beantworten nicht meine Frage, wie James Cook zu dem Kapitän wurde, der sich so außergewöhnlich um seine Seeleute kümmerte.
Kapitän, Entdecker und Wissenschaftler James Cook
Es ist sehr gut nachzuvollziehen, wie er der Seemann par excellence wurde und auch wie er, ungeachtet seiner rudimentären Schulbildung, ein Wissenschaftler wurde. Woher kam aber seine soziale Verantwortung in einer Zeit, in der das Leben eines Seemanns keinen Pfifferling wert war? Es traf Cook zutiefst, dass er auf seiner ersten Forschungsreise 38 Seeleute verlor. Er setzte sich damit auseinander, und von der zweiten Südseereise (1772 – 1775) kehrten nur vier Seeleute nicht mit ihm zurück. Im Gegensatz zu Cook verlor Commodore Anson 626 von 961 Mann. Cooks Bilanz ist einzigartig und hätte jeden Kapitän dazu bewegen müssen, sich mit dessen Arbeitsweise auseinanderzusetzen und ihm zu folgen. Das taten sie aber nicht. Über einhundert Jahre später hatte sich die Situation für die meisten Seeleute der Handelsmarine nicht grundsätzlich verbessert. Das beweist ein Vergleich der Reisen von Cook mit einer von Kapitän James P. Barker, der die BRITISH ISLES führte. Am 11. Juli 1905 verließ der 1884 als Vollschiff (2 287 Registertonnen) gebaute und mit 3 600 t walisischer Kohle beladene Segler Port Talbot. Am gleichen Tag verließ die deutsche SUSANNA den gleichen Hafen zu ihrer berühmten Reise. Beide waren für Chile bestimmt. Die Besatzung der BRITISH ISLES bestand aus Erstem und Zweitem Offizier, 1 Segelmacher, 1 Zimmermann, 1 Stewart, 1 Koch, 20 Matrosen und 4 Kadetten. Für ein gutes Segeln des Schiffes, vor allem hart am Wind, was bei Kap Horn von großer Bedeutung ist, wären bis zu 40 Matrosen nötig gewesen. Da die Segelschifffahrt schon einige Zeit ihren Höhepunkt überschritten hatte, waren die Besatzungen ohne Rücksicht auf die seemännischen Erfordernisse gnadenlos reduziert worden. Die Seeleute hatten in früheren Zeiten für die britischen Schiffe das Motto Hunger und Muße gewählt, denn auf ihnen gab es große Besatzungen, aber wenig zu essen. Das mit der Muße stimmte nicht mehr, der Hunger aber war geblieben. Noch schlimmer war jedoch, dass Kapitän Barker die Umrundung von Kap Horn mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste erzwingen wollte. Am 7. August hatte der Segler Staten Island nach 57 Tagen quer. Am Morgen des nächsten Tages passierte die BRITISH ISLES Kap Horn. Sie hatte bis dahin eine Dampferstrecke von 7 400 sm zurückgelegt, war aber zwischen 8 500 und 9 000 sm gesegelt. Am Abend musste sie unter Untermarssegeln und einem Stagsegel auf SSW-Kurs und Stb.-Hals beidrehen. Dadurch trieb sie jeden Tag 20 bis 50 sm zurück. Der 14. August war ein schwarzer Tag für die Seeleute, denn der Matrose Davidson fiel von der Rah über Bord, dem Matrosen West wurde der Schädel eingedrückt und dem Matrosen Witney ein Bein dreifach gebrochen. In den folgenden drei Wochen wurden von den verbliebenen Matrosen neun weitere durch Verletzungen und erfrorene Gliedmaßen dienstuntauglich. Das Schiff trieb in immer höhere Breiten und erreichte schließlich 65 Grad Süd. Es befand sich 550 sm in SSOlicher Richtung von Kap Horn. Barker konnte nicht wenden, weil die Besatzung zu schwach, und er konnte nicht halsen, weil der Sturm zu stark war. Das Schiff befand sich 32 Tage ununterbrochen im Sturm.
Am 11. September gelang es endlich, das Schiff auf den anderen Bug und damit auf NO-Kurs zu legen. Am darauf folgenden Tag brach die Großbramstenge, einem griechischen Matrosen wurde ein Bein zerschmettert, ein weiterer Matrose ging außenbords. Es blieben 6 Matrosen und 4 Offiziersanwärter dienstfähig. Der Kapitän gab auf und lief nach Lee ab, um bei Staten Island Schäden zu beseitigen. Dort wurde er mit ca. 20 anderen Seglern von einer Viermastbark von Laeisz passiert, die mit 34 Mann an Deck unbeirrt ihren Kurs verfolgen konnte.
Am 20. September begann, 45 Tage nach dem ersten Versuch, ein neuer Anlauf, um Kap Horn zu umrunden. Drei Tage später ging ein weiterer Mann über Bord, die BRITISH ISLES wurde erneut hinter Kap Horn zurückgetrieben. Am 29. September passierte der Segler das gefürchtete Kap zum dritten Mal im Vorwärtsgang. Der Oktober forderte einen hohen Blutzoll von der Besatzung. Der Kapitän sägte das zerschlagene Bein des griechischen Matrosen ab und am 9. starb der Matrose mit dem eingeschlagenen Schädel. Am 16. verließ das Schiff nach 71 Tagen das Kap-Horn-Revier und legte damit in dieser Zeit eine Strecke von 1 500 sm zurück. Am 28. Dezember erreichte es nach 139 Tagen Pisagua. Das Ergebnis der Reise war, dass drei Mann über Bord gingen, drei Matrosen ihren Verletzungen erlagen, zwei Matrosen Invaliden auf Lebenszeit wurden und drei über längere Zeit dienstunfähig waren. Eine vernichtende Bilanz für einen Schiffsführer, die vom Flaggenstaat eine gründliche Untersuchung dieser Vorfälle erfordert hätte. Kapitän Barker unternahm keinen Versuch, seine verletzten Seeleute in ärztliche Behandlung zu bringen. Das hätte er auf den nicht weit entfernten Falklandinseln tun können. Dort hätte er auch Proviant nachfassen können, um seine Seeleute wieder zu Kräften kommen zu lassen. Er war ein miserabler Kapitän, der seiner Verantwortung gegenüber den ihm anvertrauten Seeleuten nicht nachkam. Er war auch, ebenso wie sein Reeder, ein miserabler Ökonom. Mit einer fitten Besatzung hätte er schneller das gefürchtete Kap bezwungen. Die erwähnte Laeisz-Viermastbark bewies das. Kapitän Jürgens von der SUSANNA brauchte zwar 99 Tage, um das Kap zu bezwingen, aber er brachte alle ihm anvertrauten Seeleute heil und gesund durch diese eisige Hölle.
(Zeichnung Christine Diestel)
Cook verlor auf seiner zweiten Reise, die etwas über drei Jahre dauerte, wie bereits erwähnt, nur vier seiner Seeleute. Einen durch Tuberkulose, einer fiel in eine offene Luke und zwei ertranken. Was für eine Leistung!
Auch bei dem nächsten Paar von Kapitänen, das ich gegenüberstellen will, soll Cook wieder einer der beiden Protagonisten sein. Ich möchte seine Leitungs- und Führungstätigkeit mit der von William Bligh, seinem Navigator auf seiner dritten und letzten Entdeckungsreise, vergleichen. Bligh erreichte als Führer der BOUNTY eine zweifelhafte Berühmtheit. Der Grund dafür war nicht, dass er ein schlechter Seemann war. Das war er ganz und gar nicht. Seine Fahrt mit einem offenen Boot über eine Strecke von 3 600 sm nach Indonesien, ohne auch nur einen einzigen Mann zu verlieren, zeichnete ihn als außergewöhnlichen Seemann aus. Aber die Vorgänge auf der BOUNTY zeigten, dass er ein miserabler Leiter war. Cook bewies vom ersten Tag als Angehöriger der Marine seine Autorität bei der Arbeit an Deck und bei der Führung der Seeleute. Dies wurde von seinen Vorgesetzten und den ihm anvertrauten Seeleuten erkannt und anerkannt. Die Seeleute schätzten sein Wissen und seine Fähigkeiten. Deshalb folgten sie ihm. Dies war eine der wesentlichsten Voraussetzungen für seinen ungewöhnlichen Aufstieg in diesem von Adligen beherrschten Machtinstrument des Königs. Eine weitere Voraussetzung für seinen Erfolg war, dass sein Verstand, seine Denkweise so veranlagt waren, dass er die Dinge wissen und verstehen wollte. Wenn er sie verstand, wollte er sein Wissen auch anwenden. Ein exzellentes Beispiel für diese Haltung waren seine Erfolge bei der Vermessung eines erheblichen Teils der nordamerikanischen Küsten. Zwangsläufig fiel diese Haltung der Royal Society auf. Später lernte er sehr viel von Sir Joseph Banks und Dr. Daniel Carlsson Solander. Als Leiter der Südseeexpeditionen bewies er, dass er sehr überlegt und gekonnt die verschiedensten Mittel zur Stärkung seiner Autorität einsetzen konnte. Auf der ersten Reise ließ er in Funchal einen Seemann und einen Marinesoldaten auspeitschen, weil sie gegen die Bordverpflegung protestiert hatten. Obwohl Cook ein warmherziger Mensch war, griff er dessen ungeachtet zu solch drastischen Mitteln, um seine Ziele zu erreichen. Von Anfang an bereitete Cook eine Umstellung der Verpflegung vor. Er wollte, dass die Seeleute bereit waren, ungewohnte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kräuter usw. zu akzeptieren, damit das Auftreten von Skorbut verhindert wurde. Er selbst ging in der Offiziersmesse beim Verzehr von Sauerkraut mit gutem Beispiel voran.
Andere Kapitäne oder Führer von Expeditionen wie Louis Antoine de Bougainville, Jean François Marie de Surville und Tobias Furneaux konnten oder wollten Cook nicht folgen. Furneaux folgte nicht einmal Cooks Anweisungen.
Flying-P-Liner PEKING als Museumsschiff in Manhattan, New York
Surville wurde als das genaue Gegenteil von Cook angesehen. Die Besatzungen dieser Führer bezahlten die Ignoranz, Dummheit und Überheblichkeit ihrer Chefs mit einem hohen Blutzoll. Im Verhältnis zu den ihn begleitenden Wissenschaftlern, vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Aristokraten Banks, bewies Cook sowohl diplomatisches Geschick als auch Standhaftigkeit. Er versuchte den Wünschen der Forscher nachzukommen, aber nur so weit, wie es ihm sein seemännisches Wissen und seine Erfahrung gestatteten. Wenn er das Risiko für zu groß hielt, gab es keinen Kompromiss, kein Nachgeben. Immer stand für ihn die Sicherheit der ihm anvertrauten Seeleute und des Schiffes im Vordergrund. Nachdem Cook die Erkundung Neuseelands abgeschlossen hatte, konnte er nach seinen Instruktionen den Weg zurück wählen. Er berief aber einen Schiffsrat ein, um Argumente für die eine oder andere Route zu hören. Cook wäre gern über Kap Horn zurückgesegelt, um das noch unbekannte Gebiet zwischen 40 und 60 Grad Süd zu erforschen. Die Seeleute hießen dieses Vorhaben nicht gut, weil die Segel und andere Teile des Schiffes schon zu sehr gelitten hatten. Cook folgte ihrem Rat und hielt sich damit auch bei dieser Entscheidung an die Regeln guter Seemannschaft. Wahrscheinlich war es für Bligh ein enormer Nachteil, dass er Cook erst auf dessen dritter Reise begleitete. Auf dieser Reise war Cook nicht mehr der Alte. Er hätte sie nicht mehr unternehmen sollen. Er hatte sein Leben lang unter schwierigsten Bedingungen hart gearbeitet und hätte den Druckposten als Captain des Greenwich Hospital behalten sollen, aber Untätigkeit entsprach nicht seinem Naturell. Seine Wutausbrüche nahmen auf seiner letzten Reise zu, Entscheidungen kamen nicht zur rechten Zeit oder waren falsch. Seine auf den ersten beiden Reisen bewiesene einzigartige Führungstätigkeit brach im Wesentlichen zusammen. Der Tod Cooks, den Bligh miterlebte, war ein schwerer Schlag für Bligh. Cook hätte unter normalen Umständen mit väterlicher Sorge über diesen jungen Offizier gewacht. Das war in der Navy üblich. Niemand übernahm diese Rolle. Bligh wurde auch bei Beförderungen übergangen. Die Voraussetzungen, die William Bligh für eine Karriere in der Marine hatte, waren zweifellos besser als die von Cook, da sein Vater Leiter des Zollamtes in Plymouth war. Mit 21 Jahren wurde er Cooks Navigator auf der RESOLUTION. Bligh und der Adelige Fletcher Christian lernten sich auf HMS CAMBRIGE kennen. Auf der BOUNTY begleitete ihn Christian als Master’s Mate (Oberbootsmann/II. Offizier). Beide verband eine enge Freundschaft. Die zur Meuterei führenden Auseinandersetzungen an Bord hatten mehrere Ursachen. Bligh wurde von der Admiralität zwar als Führer des Schiffes eingesetzt, aber aus Kostengründen nicht zum Kapitän befördert. Blighs finanzielle Situation war damit alles andere als rosig. Er war auf dem Schiff sein eigener Zahlmeister, was, berechtigt oder unberechtigt, bei der Besatzung immer zu Spekulationen und ihm gegenüber zu Spannungen führte. Die von Banks im Interesse der zu transportierenden Ladung (Brotbaumsetzlinge und Pflanzen) veranlassten Umbauten des Seglers waren dem Status von Bligh nicht zuträglich. Anstatt des Großen Salons zum Leben und Arbeiten hatte er nun einen kleinen ungelüfteten, dunklen, zeitweilig als „Essraum“ genutzten Raum zur Verfügung. Weitere Probleme entstanden aus der unterschiedlichen Art, wie die Offiziere zu ihrer Position gekommen waren. Bligh war der Einzige, der ein durch die Krone ausgestelltes Offizierspatent besaß. Die anderen Offiziere dienten unter einem Royal Warrant. Diese Position verlieh ihrem Träger keine umfassende Befehlsgewalt. Bligh, der sehr hohe Ambitionen hatte und sich dafür im Selbststudium weiterbildete, war mit der Qualität dieser Offiziere (Segelmeister/Navigator, Arzt, Segelmacher, Bootsmann usw.) sehr unzufrieden. Über kurz oder lang hatte er sich mit allen überworfen. Es gelang ihm nicht, sie zu einer Verbesserung ihrer Leistungen zu motivieren. Aus Kostengründen wurden ihm auch keine Marinesoldaten mitgegeben, die unter bestimmten Umständen sowohl für die Aufrechterhaltung der Disziplin an Bord als auch für Absicherung des Schiffes auf den angelaufenen Inseln wichtig sein konnten. Die BOUNTY war durch all diese Probleme ein Schiff mit großer Ambivalenz und es hätte schon eines Cook auf dem Höhepunkt seiner Leitungstätigkeit bedurft, um die Reise zu einem glücklichen Ende zu führen.
Bligh war aber kein Cook. Sein Hauptproblem war seine Sprache, nicht, wie vordergründig und völlig unberechtigt immer wieder behauptet wird, die von ihm ausgeübte körperliche Gewalt. Greg Dening kam in seinem Buch Mr BLIGH’S Bad Language zu dem Ergebnis, dass auf den britischen Schiffen im zentralen Teil des Pazifiks zwischen 1767 und 1795 21,4 Prozent der Seeleute ausgepeitscht wurden.
Replik des von William Bligh geführten Langbootes der BOUNTY
Und das ungeachtet der Tatsache, dass bis auf die PANDORA die Schiffe mit Freiwilligen bemannt waren. Bei der Anwendung dieser Züchtigung waren die Unterschiede sehr groß. Auf Blighs PROVI-DENCE wurden nur 8,33 Prozent, hingegen auf Vancouvers DIS-COVERY 45,15 Prozent der Seeleute ausgepeitscht. Dabei waren diese brutalen Züchtigungen in aller Regel für die Aufrechterhaltung der Disziplin nicht nötig. Sie dienten fast immer der Stärkung der Autorität und des Status des Verantwortlichen. Für Bligh waren Züchtigungen und Skorbut völlig zu Recht Zeichen eines schlecht geführten Schiffes, deshalb war er auch kein brutaler Schiffsführer. Ich kenne andererseits keinen Schiffsführer, der die folgende Worte von Victor Klemperer aus dessen Buch LTI so außerordentlich eindrucksvoll bestätigt hat:
Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je unbewußter ich mich ihr überlasse. Und wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden ist? Worte können sein wie winzige Arsendosen: Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.
Das Königliche Hospital für Seeleute (heute: Old Royal Naval College) in Greenwich
Die Sprache der Seeleute war in ihrer Knapp- und Klarheit ein hervorragendes Werkzeug, um in den schwierigsten Situationen die Besatzung als einen einheitlichen Körper mit größter Effektivität zu führen. Wenn es um Blighs Sprache geht, dann muss man sie im Rahmen des damals Üblichen sehen, und dieser war alles andere als höflich, zurückhaltend oder das Besatzungsmitglied, einschließlich des Offiziers, achtend.
Der Kommandant der BOUNTY William Bligh
Bligh scheint die Bedeutung der Sprache für seine Führungstätigkeit nicht erkannt zu haben. Blighs Sprache wurde zu Recht als beleidigend und maßlos eingeschätzt, da er seine Offiziere, nicht die Mannschaft, als Schurken, verdammte Gauner, Hunde, Höllenhunde, ekelhafte Tiere, Schufte usw. mit unbeherrschter Wut selbst bei den einfachsten Manövern bezeichnete. Was brachte Bligh in diese miserable Lage, aus der er sich offensichtlich nicht selbst befreien konnte? Abgesehen von den vielen Unstimmigkeiten und Zweideutigkeiten der Reise waren es vor allem die fünf Monate, die die BOUNTY in der Matavai-Bucht von Tahiti lag. Er versuchte in dieser Zeit sein Schiff und seine Besatzung intakt zu halten, aber die Umstände waren gegen ihn. Für jeden Kapitän, der auf einen ambitionierten und deshalb straff organisierten Dienstbetrieb Wert legt, ist ein fünfmonatiger Aufenthalt auf einer tropischen Insel mit ihren bereitwillig sexuelle Bindungen eingehenden Frauen ein Albtraum. So wie Klempner es im Dritten Reich mit der Sprache der Nazis beobachtete, so ging es auch den Seeleuten der BOUNTY. Über die Sprache veränderten sich ihr Gefühl und ihre Auffassungen. Selbst am Morgen der Meuterei sprach der Adlige Christian eine Mischung aus Tahitisch und Englisch. Kapitän Edwards von der PANDORA, der die Meuterei einfangen sollte, erkannte diese von der Sprache ausgehende Gefahr viel klarer als Bligh.
Die mit auf Tahiti gefangenen Meuterern der BOUNTY sinkende HMS PANDORA. Zeichnung von Robert Batty (1789 – 1848), gemeinfrei
Er drohte den von ihm aufgegriffenen Meuterern, sie für den Fall, dass sie auch nur ein Wort Tahitisch sprechen würden, mit einer Mundsperre zu knebeln. Die Meuterei dokumentierte für alle Zeiten sowohl die Bedeutung der Sprache an Bord als auch die Unfähigkeit Blighs, die von seiner Sprache ausgehende Gefahr zu erkennen und mit einer angemessenen Sprache eine der Situation gerecht werdende Leitungstätigkeit zu entwickeln. Selbst nachdem er wieder in England eingetroffen war und Zeit zur Reflexion hatte, erkannte er dieses Problem nicht. Die Admiralität stellte ihn im März 1805 wegen seiner Sprache vor ein Kriegsgericht.
Die Bucht von Matavai auf Tahiti mit HMS RESOLUTION und HMS ADVENTURE. Gemälde von William Hodges, gemeinfrei
Mit dem nächsten Paar von Kapitänen möchte ich den Leser in die Gegenwart führen. Der eine oder andere wird schon eine oder mehrere Reisen als Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff gemacht haben. Diejenigen in meinem Bekanntenkreis, die dies bereits taten, hatten deshalb viele Fragen zur Rolle von Kapitän Francesco Schettino von der COSTA CONCORDIA. Er soll mit Kapitän Edward J. (Ted) Smith verglichen werden. Smith befand sich, als er die TITANIC vor ihrer Jungfernreise übernahm, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ich möchte die beiden Kapitäne nur in einer einzigen Frage vergleichen: „Was taten sie zur Rettung der ihnen anvertrauten Passagiere und Seeleute?“
Im Falle von Kapitän Smith ist das nicht ganz einfach, da er den Untergang seines Schiffes nicht überlebte. Es wird immer wieder geschrieben, dass die Führung auf dem Schiff zusammengebrochen sei, dass der Kapitän sich nicht an der Rettung der Passagiere beteiligte, dass er möglicherweise unter Schock stand usw. (siehe: Müller-Cyran, Schiff & Hafen, Oktober 2014).
Die RMS TITANIC verlässt am 10. April 1912 Southampton, Foto F.G.O. Stuart (1843 – 1923), gemeinfrei
Stützen möchte ich mich vor allem auf die Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss des US-Senats (SUBCOMMITTEE OF THE COMMITTEE ON COMMERCE, UNITED STATES SENATE: „TITANIC“ DISASTER, New York 1912). Folgende Fakten, zum Teil in beeideten Aussagen zusammengetragen, sind deshalb für die Beurteilung der Aktivitäten des Kapitäns besonders wichtig:
14. April
23.41: Zusammenstoß mit Eisberg, Kapitän kam sofort nach der Kollision auf die Brücke und fragte den Ersten Offizier nach der Ursache. Er gab die Anweisung, die Schotten zu schließen, was der EO aber schon veranlasst hatte. Der Kapitän legte den Maschinentelegraphen für einige Minuten auf „Voraus Halbe“ und befahl dann dem Vierten Offizier Boxhall, „eine schnelle Inspektion des Schiffes“ vorzunehmen. In Minutenschnelle war der zurück. Er hatte keine Schäden entdeckt. Danach befahl der Kapitän Boxhall, einen Zimmermann zu suchen, der Tanks und Räume peilen sollte. Auf der Treppe traf Boxhall schon einen Zimmermann, der Schäden melden wollte. Danach ließ der Kapitän Thomas Andrews, den Erbauer des Schiffes, rufen.
23.55: Der private Funkverkehr wurde unterbrochen.
15. April
00.00: Thomas Andrews inspizierte (nach G.J. Cooper in „Titanic
Captain“) zusammen mit Smith Bereiche des Schiffes.
00.05: Kapitän gab folgende Anweisungen:
- Rettungsboote klarmachen
- Passagiere vorbereiten
- Zuweisung der Passagiere zu den Booten vornehmen (sie waren vorher nicht einem speziellen Boot zugewiesen worden)
- weitere Offiziere wecken
00.15: Kapitän wies Funker an, Notruf zu senden (Phillips sendete zuerst CQD, dann auf Hinweis von Bride SOS). Smith hielt sich meistens auf der Brücke auf.
00.45: Erste Rakete abgefeuert und erstes Rettungsboot zu Wasser (Besatzung erledigte ihre Aufgaben ruhig und diszipliniert?) 01.40: letzte Rakete abgefeuert
02.05:
- Kapitän zum letzten Mal im Funkraum. Er stellte den Funkern frei, sich zu retten. Dann ging er auf das Bootsdeck, um mit Besatzungsmitgliedern zu sprechen.
- letztes Boot zu Wasser 02.20: Die TITANIC sank.
Senator William Alden Smith, der Leiter der Untersuchungskommission, kam zu dem Schluss, dass die Befehlskette beim Verlassen des Schiffes weitgehend zusammengebrochen sei und dass die Schiffsleitung gelähmt war. Diese Auffassung ist aufgrund des beim Fieren der Boote herrschenden Chaos verständlich. Trotzdem halte ich sie nicht für gerechtfertigt. Kapitän Smith hatte offensichtlich eine klare Strategie. Er wollte unter allen Umständen eine Panik verhindern, die, da nur für die Hälfte der sich an Bord befindenden Menschen Plätze in den Booten vorhanden waren, katastrophale Auswirkungen auf die Evakuierung des Schiffes haben musste. Dass sein Plan nicht aufging, hatte mehrere Gründe (Passagiere nicht auf die Boote aufgeteilt, zu wenig Seeleute für das Handhaben der Boote, Besatzung neu und nicht auf diese Aufgabe vorbereitet usw.). Wenn die Aktivitäten von Kapitän Smith zum Beispiel mit denen des Kapitäns der COSTA CONCORDIA oder auch mit denen des DSR-Kapitäns der BÖHLEN verglichen werden, dann hat Smith wichtige Entscheidungen zur Rettung der sich an Bord befindenden Menschen getroffen. Nachdem ihm Andrews mitgeteilt hatte, dass das Schiff verloren war, gab er sofort die notwendigen Anweisungen. Ob eine ungeschminkte Information der Besatzung und der Passagiere über die Lage des Schiffes mehr Menschen das Leben gerettet hätte, wage ich nicht zu beurteilen. Die Offiziere dürften ohnehin keine Illusionen über die Lage des Schiffes gehabt haben.
Wie stellt sich, im Vergleich mit dem Kapitän der TITANIC, die Situation für den Kapitän der COSTA CONCORDIA dar? Folgender zeitlicher Ablauf ergibt sich aus dem Untersuchungsbericht des italienischen Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr:
13. Januar 2012
- Um 21. 45. 05 Ortszeit lief die COSTA CONCORDIA bei günstigen hydrometeorologischen Bedingungen auf einen Felsen der Insel Giglio.
- Kapitän Schettino leitete die Untersuchung des Schiffes auf mögliche Schäden – nach 16 Minuten wurde der Kapitän über den Ernst der Lage des Schiffes unterrichtet.
- Der Kapitän informierte nicht die Rettungsbehörden (Küstenwache usw.). Diese wurden von einer Person, die von Land aus anrief, informiert. Obwohl die Behörden Kontakt mit dem Schiff aufnahmen, informierte er sie erst um 22. 26. 02 Ortszeit. Erst auf Forderung der Behörden in Livorno setzte er um 22.38 einen Notruf ab.
- Erst um 22. 54. 10 befahl Schettino, das Schiff zu verlassen, ohne dass das Signal für den Generalalarm ausgelöst wurde. Das hätte bei der Lage der COSTA CONCORDIA sehr viel Sinn gemacht. Viele Passagiere sagten aus, dass sie die mittels Sprache gegebene Anweisung nicht gehört hatten. Es gab auch keine direkten Anweisungen an die Offiziere auf den Bootsstationen! Die Geliebte des Kapitäns Domnica Cemortan verließ die Brücke, zog sich in der Kammer des Kapitäns wärmere Kleidung an und brachte Schettino eine blaue Jacke ohne Rangabzeichen. Seine Uniformjacke brachte sie in seine Kammer. Er war dadurch als Kapitän nicht erkennbar (Aussage Cemortan vor Gericht).
- Um 22.50 und 23.10 Uhr wurden die ersten Boote zu Wasser gelassen.
- Um 23.20 wurde die Brücke von der Besatzung, einschließlich Kapitän, verlassen.
- Um 24.00 Uhr erreichte die Schlagseite 40°.
14. Januar 2012
- Um 00.34 Uhr sprach der Kapitän mit den Behörden in Livorno und teilte ihnen mit, dass er im Rettungsboot sei. Das Gericht hörte ein aufgenommenes Telefongespräch, in dem der Beamte der Küstenwache Gregorio De Falco ihm wiederholt befahl, auf sein Schiff zurückzugehen. Schettino behauptete in dem Gespräch, dass nur noch 10 Personen an Bord wären. In Wirklichkeit befanden sich noch etwa 300 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord (Aussage De Falco vor Gericht).
- Um 06.17 Uhr wurde die erste Phase der Rettung der Passagiere und Seeleute beendet.
COSTA CONCORDIA vor Giglio, Foto Wikimedia/Rvongher
Francesco Schettino befand sich dadurch, dass das Wetter hervorragend war und das Schiff gegen die felsige Küste unmittelbar neben einen kleinen Hafen trieb, in einer idealen Lage, um die sich an Bord befindenden Personen zu retten. Schon nach 16 Minuten war ihm bekannt, dass sich sein Schiff in einer schwierigen Lage befand. Jetzt hätte er sofort den Generalalarm auslösen müssen. Stattdessen ließ er wertvolle Zeit verstreichen, in der sich die Probleme, vor allem durch die sich ständig verstärkende Schlagseite des Schiffes, unablässig vergrößerten. In dieser Situation gab es nichts mehr zu verbergen oder zu vertuschen. Die Chance, sich in einer schwierigen Situation als guter Seemann und als energischer und fähiger Schiffsführer zu zeigen, nutzte der Kapitän nicht. Im Gegenteil, er erwies sich als Feigling und Lügner. Ein solches Etikett kann niemand Edward J. Smith anhängen.
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass in der Schifffahrt bei den Personen in der wichtigsten Funktion große Extreme zu beobachten sind. Der Unterschied zu anderen Berufen ist, dass diese Extreme, weil sie auf großes öffentliches Interesse stoßen, in den Medien mit umfangreicher Berichterstattung bedacht werden. Hat der Kapitän eines von einem Seeunfall betroffenen Schiffes, wie Francesco Schettino, versagt, dann überschreitet die Berichterstattung schnell, bevor Seeämter oder Gerichte zu einem abschließenden Urteil gekommen sind, den gebotenen sachlichen Rahmen. Für richtig halte ich es, dass die Schifffahrtsliteratur sowohl den „Guten“ als auch den „Bösen“ ein Denkmal setzt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch an weitere Kapitäne erinnern, die sich entweder durch hervorragende Seemannschaft und exzellente Leitungstätigkeit oder durch das Versagen in einer von beiden Kategorien hervorgetan haben.
Beginnen möchte ich mit Robert Hilgendorf, der am 31. Juli 1852 in Schievelhorst bei Stepenitz am Ostufer des Stettiner Haffes geboren wurde und am 4. Februar 1937 in Hamburg starb. Bei dem Ruf, den Hilgendorf nicht nur in Deutschland als außergewöhnlicher Schiffsführer der größten Segelschiffe genoss, ist es erstaunlich, dass so wenig über ihn geschrieben wurde. Als harte Fakten stehen seine Reisen mit ihrer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit und ihrer Regelmäßigkeit, ungeachtet dessen, dass die meisten von ihnen um Kap Horn gingen. Ein weiterer harter Fakt ist, dass er von 1883 bis 1898 16 500 Wetterbeobachtungen zur Deutschen Seewarte in Hamburg schickte. Diese intensive Beschäftigung mit dem Wetter ermöglichte ihm, das Wetter „zu lesen“. Ich hätte gern gewusst, wie er navigierte, wie er die Besatzung führte usw.
Die Angaben dazu sind sehr dünn. Im November 1901 gab er im Alter von nur 49 Jahren die Seefahrt auf. Das Angebot, das Fünfmastvollschiff PREUSSEN als Kapitän zu führen, lehnte er ab. In diesem Punkt war er offensichtlich klüger als Cook.
Die von Robert Hilgendorf von 1895 bis 1901 geführte Fünfmastbark POTOSI an einer Pier. Fotograf unbekannt - State Library of Victoria, Malcolm Brodie shipping collection, gemeinfrei.
Er war zu der Auffassung gekommen, dass er für dieses Schiff schon zu alt sei. Eine weise Entscheidung. Zu den Kapitänen, die mir immer besonders imponiert haben, gehört Richard Woodget, der berühmteste aller Befehlshaber des Teeklippers CUTTY SARK. Basil Lubbock, der einige Reisen als Seemann auf Tiefwasserseglern machte, hat ihm in seinem Buch „The Log Of The CUTTY SARK“ ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt. Woodget führte sie von 1885 bis sie 1895, als sie an die Portugiesen verkauft wurde. Seine außergewöhnliche Seemannschaft wird durch seine Aussage, dass er sie nie in achterlicher See beidrehte, deutlich. Er lief mit ihr vor der hohen See, und das in den Roaring Forties (Brüllenden Vierzigern), auf den langen Reiseabschnitten von Europa nach Australien. Nach Lubbock wurde sie nur einmal von einer achterlichen See überlaufen. Abgesehen von einigen eingeschlagenen Schotten (Türen) kam sie ohne Verluste durch diese schwere Prüfung.
Kapitän Richard Woodget, der die CUTTY SARK von 1885 bis 1895 führte (Captain Richard Woodget, Master of Cutty Sark 1885 – 1895, National Maritime Museum, London)
Als Woodget die CUTTY SARK übernahm, überprüfte er ihre Takelage gründlich. Im Laufe der Zeit verbesserte er sie. Zu seinen Auffassungen gehörten strikte Disziplin und Gerechtigkeit an Bord. Er war vielseitig interessiert, und er war einer der ersten Kapitäne, die fotografierten. Er erkannte die Bedeutung eines Hobbys für die langen Seereisen und empfahl den Seeleuten, sich eines zuzulegen.
Cook, Hilgendorf und Woodget sind die Personifizierung eines Wortes von Einstein, der sagte: „Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.“ Dieses Zitat trifft auch auf einen Kapitän einer Zeit mit ganz anderen Anforderungen zu. Da die Natur Gustav Schröder nur mit einer schmächtigen Statur bedacht hatte, musste er hart kämpfen, um die für den Schulbesuch erforderliche Segelschifffahrtszeit zusammenzubekommen. Er bewies Willen und Durchsetzungskraft, die die fehlende physische Kraft mehr als ausgeglichen hat. Berühmt machen sollte ihn eine außergewöhnliche Reise mit dem Passagierschiff ST. LOUIS.
Kapitän Gustav Schröder, Foto United States Holocaust War Memorial, gemeinfrei
Da im Verlaufe der Nazidiktatur das Leben für die Juden in Deutschland immer schwieriger und gefährlicher geworden war, versuchten viele von ihnen auszuwandern. Das Auswandern war ihnen nicht verboten, aber leisten konnten es sich nur Reiche. Wenn sie dann endlich die Genehmigung hatten, waren sie arm. Die Nazis nahmen ihnen alles. Problematisch war auch, dass nur wenige Staaten diese Flüchtlinge aufnehmen wollten. Die Hapag bot der Europäischen Jüdischen Vereinigung in Paris Anfang 1939 die ST. LOUIS für eine Reise an. Die Hamburger Reederei verlangte für einen Passagier der Kajütsklasse 800 RM und in der Touristenklasse 600 RM. Außerdem musste jeder Passagier 230 RM für eine mögliche Rückreise einzahlen. Für die Einreisegenehmigung mussten die Passagiere selbst sorgen. Nur 16, die die Reise antraten, hatten im Pass ein kubanisches Einreisevisum. Die übrigen Passagiere besaßen eine Landeerlaubnis, die aus unbekannten Gründen am 4. Mai für ungültig erklärt wurde.
Das Hamburger Passagierschiff ST. LOUIS, Archiv Autor
Am 10. Mai traf aus Havanna die Nachricht ein, dass der Leiter der Einwanderungsbehörde sie doch schriftlich für gültig erklärt hatte. Am 13. Mai gingen 388 Passagiere der Kajütsklasse und 511 der Touristenklasse in Hamburg an Bord. In Cherbourg stiegen weitere 38 Passagiere auf das Schiff auf. Von den 937 Passagieren waren 409 Männer, 350 Frauen und 148 Kinder. 94 Prozent von ihnen waren Deutsche. Kapitän Schröder führte eine Besatzung von 373 Mann (Zahlen aus Heinz Burmeister: Aus dem Leben des Kapitäns Gustav Schröder). Der erfahrene Kapitän dürfte kaum Illusionen über die Probleme dieser Reise gehabt haben. Schon bevor das Schiff Havanna erreichte, kamen beunruhigende Telegramme aus Hamburg. In ihnen wurde die Situation in der kubanischen Hauptstadt als „unübersichtlich“ bezeichnet. Schröder behielt den Inhalt der Telegramme zuerst für sich, bewies aber von Anfang an eine sehr durchdachte Leitungstätigkeit. Er wählte aus den Passagieren fünf geeignete Persönlichkeiten aus, die ein „Bord-Komitee“ bildeten. Als das Schiff am Morgen des 27. Mai in Havanna ankerte, wurde den Passagieren ohne Einreisevisum die Landung verweigert. Auf der Reise nach Havanna hatte sich schon ein Selbstmord ereignet, an diesem Tag kam es zu zwei Selbstmordversuchen. Kapitän Schröder versuchte den kubanischen Präsidenten persönlich zu sprechen, was ihm nicht gelang. Der Präsident legte fest, dass das Schiff Havanna verlassen müsse. In dieser Zeit arbeitete Schröder eng mit dem Komitee zusammen, um die Lage unter Kontrolle zu halten. An die Bereichsleiter seines Schiffes schrieb er: Die ungeklärte Lage, in der sich unsere Passagiere befinden, bringt es mit sich, dass die Stimmung sehr gespannt ist. Es muss alles getan werden, sie zu beruhigen. Bisher ist es unserem Personal gelungen, die gute Form den Passagieren gegenüber zu wahren. Achten Sie bitte ständig darauf, dass alle Besatzungsmitglieder den Passagieren in ruhiger und höflicher Form begegnen. Auf Fragen nach dem nächsten Hafen ist stets mit einem Hinweis auf die ausgehängten Bekanntmachungen zu antworten. – Jedes Besatzungsmitglied muss über diese Instruktionen informiert werden.
Am 2. Juni verließ das Schiff mit 907 Passagieren Havanna. Der Versuch, die Passagiere in den USA zu landen, schlug fehl. Das Schiff musste sich wieder auf den Weg nach Deutschland machen. An Bord bildeten jüngere Passagiere ein „Sabotage-Komitee“. Passagieren, die das dem Kapitän berichteten, empfahl er die Bildung eines „Anti-Sabotage-Komitees“. Darüber hinaus sicherte er die Brücke und ließ das Schiff verstärkt kontrollieren. Passagiere, die bereits im KZ gewesen waren, teilten ihm mit, dass sie niemals nach Deutschland zurückkehren würden. Der Kapitän soll einen Plan entwickelt haben, das Schiff nach einer vorgetäuschten Notlage auf den Strand der englischen Südküste zu setzen. Er bezog den Leitenden Technischen Offizier und das „Bord-Komitee“ in diese Überlegungen ein. Dann kam es zur Aufruhr unter den Passagieren. Der Kapitän trat den verzweifelten Menschen gegenüber und erklärte ihnen seine Überlegungen. Er konnte sie beruhigen. Er informierte die Reederei darüber, und langsam begriff man dort, wie ernst die Situation auf der ST. LOUIS war. Der Generaldirektor des Unternehmens und ein Direktor der Passageabteilung unterstützten die Verhandlungen zum Ausschiffen der Passagiere. Dann erhielt der Kapitän die Order, Antwerpen anzulaufen. Dort sollten alle Passagiere, die von England, Belgien, den Niederlanden und Frankreich aufgenommen wurden, das Schiff verlassen. In dem Buch von Heinz Burmeister fehlt leider die Aufstellung, wie viele dieser Passagiere durch den Überfall Nazideutschlands auf diese Länder doch noch den Tod im Konzentrationslager fanden. Die Reise war ein Meisterstück der Führungs- und Leitungstätigkeit eines Kapitäns unter außerordentlich schwierigen Bedingungen.
Auch deutsche Kapitäne lieferten eindrucksvolle Beispiele unzureichender Leitungstätigkeit, die nicht wenige Besatzungsmitglieder mit dem Leben bezahlten. Beispiele dafür sind Kapitän Johannes Diebitsch von der PAMIR und Siegbert Rennecke von der BÖHLEN. Bei Diebitsch komme ich aufgrund des Spruches des Seeamtes Lübeck zu folgenden Aussagen:
1. Besatzung: Seine Erfahrung als Kapitän belief sich auf 1 Jahr (1926/27 auf zwei Dampfern), 2 Monate (1940) und auf seine Zeit auf der XARIFA (Yacht, Dreimastgaffelschoner). Ansonsten war er als Zweiter und Erster Offizier auf dem Segelschulschiff DEUTSCHLAND gefahren. Diesen Mangel an Erfahrung in der Ladung befördernden Segelschifffahrt und in der Führungs- und Leitungstätigkeit konnten andere Offiziere nicht ausgleichen. Der Erste Offizier hatte nach dem Krieg das Patent gemacht und war als Vierter und Dritter Offizier auf Dampfern und Motorschiffen gefahren. Am 14. Mai 1956 stieg er als II. NO auf die PAMIR auf. Nach etwas über einem Jahr wurde er als Erster Offizier angemustert.
Der Zweite Offizier war als Jungmann, Leichtmatrose und Vollmatrose auf der PAMIR und PASSAT gefahren. Nachdem er das Patent zum Steuermann auf Großer Fahrt (A5) erhalten hatte, kam er am 8. Oktober 1956 als III. NO auf die PAMIR. Seit dem 1. März 1957 war er als II. NO gemustert.
Kapitän Johannes Diebitsch
Als außerplanmäßiger Erster Offizier war der Seeschriftsteller Alfred Schmidt und als außerplanmäßiger II. NO Kapitänleutnant Buscher an Bord. Bei der Mannschaft sah es nicht besser aus. Der Bootsmann war fast 68 Jahre alt (Aussage Kraaz: „Half dem alten, sehr kranken Bootsmann, der schlecht laufen konnte, sich unter Deck etwas anzuziehen.“). Diese Aussage sprach er nach der Rettung auf Dimafon. In der Hauptverhandlung zog er die Aussage zurück. Das Ladung befördernde Segelschulschiff mit einer derartigen Besatzung zur Ausbildung von 30 Jungmännern und 22 Schiffsjungen sowie einigen Leichtmatrosen auf See zu schicken, war unverantwortlich. Entweder hätte der Kapitän oder zumindest der Erste ein ausgewiesener Fachmann für ein Ladung beförderndes Segelschiff sein müssen.
2. Umbauten: Unter neuseeländischer Flagge und in der Zeit, in der es sich im Besitz von Reeder Schliewen befand, wurden am Schiff zahlreiche Umbauten vorgenommen. Diese beeinträchtigten die Stabilität und die Seetüchtigkeit des Schiffes. Kapitän Diebitsch war offensichtlich nicht fähig, ihre Auswirkungen einzuschätzen.
Die Viermastbark PAMIR unter finnischer Flagge unter Vollzeug; John Oxley Library, State Library of Queensland, gemeinfrei
3. Reisevorbereitung und Kurs: Die Vorbereitung der Besatzung und des Schiffes auf das angekündigte schwere Wetter war katastrophal. Die Besatzung war nicht informiert und dadurch auch nicht auf die sich entwickelnde schwierige Situation eingestellt. Anstatt Essen wurden Zigaretten und Schnaps ausgegeben. Die Aussagen vor dem Seeamt lesen sich, als hätte sich das Schiff auf einer Kaffeefahrt befunden.
Das Schiff war ebenfalls nicht auf das sich ständig verschlechternde Wetter vorbereitet worden. Folgende Aussagen belegen dies eindrucksvoll. Wirth: Die Eisen-Schutz-Türen waren nicht eingesetzt; Kraaz: In der Matrosenmesse waren auf der Bb.-Seite die Bullaugen über Nacht offen und Wasser drang durch sie ein. Die eisernen Schutztüren waren nicht eingesetzt.
Der Kapitän ließ die Segel zu spät wegnehmen. Für die beim plötzlichen (?) Einsetzen des Sturmes auf der PAMIR gesetzte Segelfläche und bei Windstärke 10 ergab sich nach Aussage der Sachverständigen eine Neigung von 27 bis 29º. Wären die Segel weggenommen worden, hätte das Schiff bei Bft 10 noch eine Krängung von 12º gehabt. Wie es die angeführten Aussagen schon andeuteten, war der Verschlusszustand des Schiffes (Bullaugen gerieten im Kadettenraum bei 10º, Bullaugen Brücke bei 28º, Poopbullaugen bei 35º und Türsüll Brücke bei 35º unter Wasser) nicht hergestellt worden. Strecktaue wurden erst nach Eintritt der Schlagseite gespannt. Aussage Wirth: Die Räume waren bereits halb voll Wasser, als sie den Befehl bekamen, die eisernen Blenden vor die Bullaugen festzuschrauben. Kapitän Diebitsch hatte ausreichend Zeit, sich mit der Entwicklung des Hurrikans zu beschäftigen. Wenn Diebitsch, wie es immer wieder gesagt wurde, Schubarts Orkankunde „fast auswendig“ gekannt hat, dann ist es, zu dieser Auffassung kam das Seeamt, nicht unwahrscheinlich, dass das starre Durchhalten des Nordkurses, welches das immer schärfere Anbrassen der Rahen (und Dichtholen der Schoten) erforderte, auf den bei Schubart S. 120 gegebenen Ratschlag zurückzuführen. Sollte Kapitän Diebitsch diesen Ratschlag bei seinen Maßnahmen im Sinn gehabt haben, so hat er ihn missverstanden oder allzu schulmäßig befolgt.
Die Wahl seines Kurses ist nicht nachvollziehbar. 1992 befand ich mich mit der MEYENBURG auf der Reise von Brasilien nach Keelung. Südlich von Taiwan näherte sich uns ein Taifun. Nachdem die Technischen Offiziere die ausgefallene Hauptmaschine gerade wieder repariert hatten, setzte ich die Reise fort. Die Hauptmaschine konnte aber aufgrund des miserablen Bunkers jederzeit wieder ausfallen. Deshalb musste ich überlegen, ob ich unter diesen Umständen eine der wichtigsten Regeln guter Seemannschaft – wenn irgendwie möglich, einen tropischen Wirbelsturm zu vermeiden – bei dem nördlichen Kurs einhalten konnte.
MS MEYENBURG in Wismar
Ich kam nach einigen Stunden zu der Auffassung, dass das Risiko zu groß war. Das Schiff wurde auf Gegenkurs gebracht und wir warteten in einer Entfernung von 80 sm darauf, dass der Taifun vorbeizog. Als das geschehen war, wurde die Reise wieder aufgenommen. Die gleiche Möglichkeit hatte Diebitsch.
4. Wetter: Nach den Ermittlungen des Seeamtes erreichte der Wind als obere Grenze 70 kn. Die Aussage Fredrichs: „04.00 BZ Wind Bft 7 – 8, Wind und See stetig ohne Böen oder Richtungsänderungen quer von Stb“ belegt, dass das kein außergewöhnlich schweres Wetter war.
5. Segelführung: Dem sich systematisch und vorhersehbar ändernden Wetter entsprach nicht die Segelführung, das belegen die Aussagen von Fredrichs: „Um 04.00 BZ standen noch 12 Segel“ und von Haselbach: „Um 11 Uhr BZ flogen die Segel weg“.
6. Stabilität: Die Stabilität musste, wie das Vorbereiten der Besatzung und des Schiffes auf schweres Wetter, einer der Schwerpunkte des Kapitäns bei der Führung des Schiffes sein. Aus allen mir zur Verfügung stehenden Unterlagen geht nicht hervor, dass sich die Stabilität der PAMIR seiner besonderen Aufmerksamkeit erfreute. Die erwähnten Umbauten waren ein ganz wichtiger Punkt in dieser Frage. Umbauten sorgen fast immer dafür, dass die Beurteilung der Stabilität durch Kapitän und Offiziere erschwert wird. Hinzu kam, dass sie auf dem Schulschiff offensichtlich nicht berechnet werden konnte. Ihre Kontrolle erfolgte durch Rollversuche, deren Ergebnisse nach Erfahrung bewertet wurden.
Die PASSAT – das Schwesterschiff der PAMIR
Am 12. Dezember 1956 verließ die PAMIR mit 2 500 t Methylalkohol in 11 716 Fässern, die auch in den Tieftank gestaut worden waren, Antwerpen. Kapitän Eggers war sich wohl von Anfang an der Stabilitätsprobleme bewusst. Er hat nach Rollversuchen auf Terneuzen Reede die Reuelrahen, die an Deck gelegt worden waren, nicht wieder aufgebracht. Nach dem Passieren von Kap Lizard wurden die Segel gesetzt. Schon bei Windstärke 3 hatte der Segler eine Schlagseite von 11°. Am 21. Dezember beschloss Kapitän Eggers, ohne eine Entscheidung der Reederei abzuwarten, Falmouth als Nothafen anzulaufen. Dort wurden 1 256 im Tieftank gestaute Fässer gelöscht und der Tank mit Wasser gefüllt. Vor dieser Aktion hatte das Schiff eine Rollperiode von 24 Sekunden und danach von 16,5 Sekunden. Die vor dem Seeamt befragten Segelschiffskapitäne hatten 16 Sekunden als obere Grenze angesehen.
7. Ladung: Auf den fünf Reisen vor Diebitsch hat die PAMIR unter Eggers 3 x Weizen und 2 x Gerste befördert. Es gibt in den Unterlagen des Seeamtes keinen Hinweis darauf, dass bei Eggers die Gerste gesackt an Bord kam. Wahrscheinlich ist, dass sie bei Eggers, der über eine viel größere Erfahrung als Diebitsch verfügte, besser gestaut wurde. Es fällt mir sehr schwer, für den Umstand, dass die PASSAT auf ihrer letzten Reise nach dem Untergang der PAMIR, erneut lose Gerste beförderte!, angemessene Worte zu finden. Vor dem Seeamt und bei anderen Gelegenheiten hatten erfahrene Segelschiffskapitäne ausgesagt, dass sie Gerste nie lose akzeptiert hätten.
8. Führungs- und Leitungstätigkeit: Die in den verschiedenen Punkten aufgezeigten Mängel beruhen, bis auf die des Schiffes und in gewissem Umfang die der Beladung, auf einem Versagen der Leitungstätigkeit des Kapitäns. Weder die Vorbereitung des Schiffes und der Besatzung auf das von „Carrie“ ausgehende Wetter noch Kurs und Segelführung entsprachen den Regeln guter Seemannschaft in dieser Situation. Alle einschränkenden und damit die Gefahren für Schiff und Besatzung verstärkenden Faktoren wie die Stabilität des Schiffes, die von der Ladung und ihrer Stauung ausgehenden Gefahren sowie die Qualität der Besatzung hätten den Kapitän zu größtmöglicher Wachsamkeit und Vorsorge veranlassen müssen. Bei dieser großen Anzahl von Amateuren an Bord war eine straffe Schiffsführung gefragt. Der Kapitän war nicht in der Lage, diese zu etablieren. Da Diebitsch lange auf dem Schulschiff DEUTSCHLAND gefahren war, hätte er die Möglichkeit, aus dem Zusammentreffen von PAMIR und dem Hurrikan „Carrie“ ein Lehrstück machen zu können, erkennen müssen. Er tat es nicht, es blieb bei einer Kaffeefahrt mit Zigaretten und Schnaps.
Von der 86 Mann starken Besatzung wurden nur 6 gerettet.
Zwischen dem Untergang der PAMIR und dem des DSR-Motortankers BÖHLEN bestehen einige Parallelen. Zu ihnen gehören, dass kein Nautischer Offizier gerettet wurde, dass auf beiden Schiffen ein unverantwortlich laxer Schiffsbetrieb herrschte, dass die unmittelbare Gefahr für das jeweilige Schiff nicht erkannt wurde und dass das Verlassen des Schiffes eine einzige Katastrophe war, die unnötig viele Seeleute das Leben kostete. Auf die meisten Fragen im Zusammenhang mit dem Untergang des Tankers hat die Seekammer in Rostock überzeugende Antworten gegeben. Es gab keine Vertuschungen, auch wenn das nach 1990 von sich in billigem Populismus gefallenden Medien immer wieder behauptet wurde. Trotzdem beantwortete die Seekammer die folgenden Fragen nicht oder nicht ausreichend:
1. Einschätzung der Leitung des Schiffes durch Kapitän Siegbert Rennecke generell und nach der Grundberührung des Schiffes im Besonderen. Dazu gehört auch sein Alkoholkonsum.
2. Rolle des Chief mate Hans-Joachim Wabst, der zu meinem Lehrjahr (1957) gehörte und den ich als einen sehr sportlichen jungen Mann in Erinnerung habe.
3. Verhalten der Brückenwache vor und während der Grundberührung.
Als sehr informativ empfinde ich die vom Seeamt Lübeck im Spruch angeführten Zeugenaussagen der Überlebenden. Im Spruch der Seekammer fehlt vor allem eine Aussage des Funkers Schultze, des einzigen überlebenden Offiziers vom Vorschiff.
Der Motortanker BÖHLEN
Ein Gespräch mit Kapitän Rolf Permien, der als Verantwortlicher für die Seeunfalluntersuchung der DSR den Funker befragte, konnte die Fragen nicht völlig beantworten, aber zumindest die Situation ein wenig aufhellen.
Kapitän Rennecke war nicht betrunken, diese Aussage ist eindeutig. Davon bin ich bei meiner Einschätzung der Situation auch nie ausgegangen. Allerdings war er Alkoholiker. Dies berichtete mir der Politoffizier Rudi Gündel, der darüber den Flottenbereich Spezialschiffahrt informierte. Die medizinische Forschung hat schon seit Langem herausgefunden, dass Alkoholmissbrauch zu psychischen, sozialen oder körperlichen Schäden führt. Eine deutliche Leistungsminderung und Störungen in der Leistung von Gedächtnis, Konzentration, Antrieb und Aufmerksamkeit gehören zum Krankheitsbild. Welche Erklärung ist sonst für den Fakt vorstellbar, dass ein Kapitän über viele Stunden nichts zur Rettung seines Schiffes und seiner Besatzung unternimmt. Die leitenden Offiziere sollen angenommen haben, dass ein Tankschiff unsinkbar sei. Das ist ein Gedanke, der seit dem Untergang der TITANIC abenteuerlich ist. Von der Brücke war über Stunden zu beobachten, wie sich die Lage des Schiffes verschlimmerte. Warum hat Wabst nicht eingegriffen?
Hans-Joachim Wabst (1. von rechts) mit anderen Lehrlingen der THEODOR KÖRNER 1959 in Izmir
Diese Frage hat mich, seit einigermaßen verlässliche Aussagen zu dem Seeunfall vorliegen, beschäftigt. Vielleicht liegt die Antwort in den Beobachtungen des Technischen Inspektors Heinz-Jürgen „Atze“ Marnau, der die geretteten Besatzungsmitglieder der Maschine befragte. Er sagte in einem Gespräch zu mir: „Ich wurde beauftragt, die Überlebenden der technischen Besatzung zu befragen. Die Überlebenden haben aus falsch verstandener Kameradschaft und weil sie unberechtigt Angst hatten, dass die Versicherung für die auf See Gebliebenen nicht zahlen könnte, mit der Wahrheit hinterm Berg gehalten. Sie gaben mir verschiedene Informationen, erlaubten mir aber nicht, diese aufzuschreiben oder zu verwenden. Sie machten mir klar, dass sie diese Aussagen vor der Seekammer nicht machen würden. Aus diesen wurde deutlich, dass der Dienstbetrieb auf dem Schiff in allen Bereichen von großer Schlamperei gekennzeichnet war. Dafür war im Maschinenbereich der Chief verantwortlich.
Chief „Atze“ Marnau beim täglichen Kontrollgang im Maschinenraum
Da er seine Frau mit an Bord hatte, kümmerte er sich noch weniger als sonst um den Dienstbetrieb. Er ist auch vom Wachingenieur nach der Grundberührung nicht angemessen informiert worden. Es wurden nicht alle möglichen und notwendigen Kontrollen vorgenommen. Eines der Probleme auf dem Schiff war, dass dort in einem für die Sicherheit eines Tankers unverantwortlichen Maße getrunken wurde. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die Inspektion dies nicht gewusst hat.“
Es ist sehr gut vorstellbar, dass sich Wabst aus dieser verfahrenen Situation nicht lösen konnte. Die Aussagen der Seekammer zur Navigation des Schiffes unterstreichen die Beobachtungen von Marnau. Im Spruch der Seekammer heißt es: „Auf Grund mangelhafter Navigation, die in der unzureichenden Ausnutzung der an Bord befindlichen nautischen Geräte begründet war, kam MT ‚Böhlen‘ vom vorherbestimmten Kurs ab. Die Nichtberücksichtigung von Wind, Strom und der tatsächlichen Geschwindigkeit des Schiffes führte auf eine Entfernung von 1 100 Seemeilen zu einer Versetzung in Vorausrichtung um ca. 60 Seemeilen und nach Osten um ca. 30 Seemeilen. Der Kurs führte daher auf die Riffe der Inselgruppe Chaussee de Sein. Der wachhabende II. Nautische Offizier Hoppe sowie der Ausgucksmann führten während ihrer Wache Schreibarbeiten durch. Daher bemerkten sie nicht rechtzeitig die 15 bzw. 18 Seemeilen weit scheinenden Leuchtfeuer von Ar Men und Ile de Sein … Die Duldung der Missstände in der Durchführung der Navigation und der Wachen schufen die Voraussetzung der Grundberührung. Die Inkonsequenz in der weiteren Führung des Schiffes nach der Grundberührung führte schließlich zum Untergang des Schiffes und zum Tod einer so großen Anzahl von Besatzungsmitgliedern. Die Schuld am Untergang des Schiffes und am Tod einer so großen Anzahl von Besatzungsmitgliedern trägt der Kapitän.“
Einige Aussagen aus dem Nautischen Untersuchungsbericht der Section des Affaires Maritimes de Bretagne – Vendee a’ Nantes haben mich an der Feststellung der Seekammer, dass der II. NO Schreibarbeiten auf der Brücke durchführte, zweifeln lassen, denn das Geschwaderbegleitschiff DUPETIT THOUARS hatte, als es merkte, dass die BÖHLEN einen gefährlichen Kurs steuerte, versucht, die Aufmerksamkeit des Wachoffiziers des Tankers zu wecken. In dem Bericht heißt es: „Ab 03.37 h (GMT) versuchte der Kommandant des französischen Kriegsschiffes 10 Minuten lang die Aufmerksamkeit des Schiffes auf sich zu ziehen durch Aussenden von Lichtsignalen (wiederholter Buchstabe V) und gleichzeitigem Anruf über UKW Kanal 16 (unbekanntes Schiff – sehen Sie mein Licht – Sie laufen Gefahr – fahren Sie nach links).“ Das französische Kriegsschiff wiederholte die Signale, aber es erfolgte keine Reaktion. Eine Kontrolle des Generalplans der BÖHLEN ergab, dass der Kartenraum des Schiffes kein Fenster hatte und dadurch die Erkennung der Signale des französischen Schiffes erschwert war.
Autor als Kapitän der AQUITANIA mit philippinischen Seeleuten
„Schlamperei“ war das richtige Wort für den Dienstbetrieb auf der BÖHLEN. Dort, wo Schlamperei herrscht, gibt es entweder keine oder zumindest eine unzureichende Seemannschaft. Ungeachtet der generellen Schlamperei hätte ein guter Wachoffizier die Grundberührung verhindern können. Er war aber kein guter Wachoffizier. Abgesehen von seinen Schwächen und den unzureichenden Voraussetzungen für diese wichtige Aufgabe hatte er auch einen Kapitän, der unfähig war, aus ihm einen guten Wachoffizier zu machen.
Es ist sehr schwer, die Gefahren und Bedrohungen, die den Kapitänen durch gegen sie gerichtete Gewalt, durch unterschiedliche Krisen, durch Druck der Schifffahrtsunternehmen, durch eigene schlechte Leitungstätigkeit, durch kulturelle Unterschiede usw. entstehen, mit ihren Ursachen kurz und knapp zu beschreiben. Über Jahrhunderte ging, abgesehen von den Naturgewalten, die größte Gefahr für ihre persönliche Sicherheit von Meutereien aus. Von deutschen Schiffen sind relativ wenige bekannt geworden. Eine war die auf dem seit Wochen vor Iquique liegenden Vollschiff MELPOMENE3. Der Kapitän verweigerte den Seeleuten Landgang und Geld. Irgendwann musste das selbst dem friedlichsten Seemann den Verstand rauben. Zwei Mal warfen sie den Kapitän, die Offiziere und Polizisten über Bord. Beim dritten Mal waren die chilenischen Polizisten stärker. Die „Anführer“ wurden nach Brennecke3 mit einem Dampfer nach Deutschland zur Verurteilung geschickt. Der Kapitän kam ungeschoren davon. In allen mir zur Verfügung stehenden Unterlagen wird nur ein einziges Schiff aus Mecklenburg oder Pommern im Zusammenhang mit dem Begriff „Meuterei“ genannt. Es betrifft die Rostocker Bark ROSTOCK, die 1849 von Wilhelm Zeltz in ihrem Heimathafen gebaut worden war. Nach dem von Matthias Menke herausgegebenen „Kapitäne, Konsuln, Kolonisten/Beziehungen zwischen Mecklenburg und Übersee“ erreichte die Bark am 12. April 1850 von Newcastle kommend Rio de Janeiro. Drei Tage später ließ der Kapitän durch den Konsul erst zwei und am folgenden Tag noch einmal zwei Seeleute verhaften. Dieser Bericht lässt mich zu dem Schluss kommen, dass es einem schwachen Kapitän nicht gelang, zwei undisziplinierte Seeleute zur Räson zu bringen, und er sich dafür Hilfe beim Konsul holte. Eine Meuterei sieht anders aus. Ein Beispiel für die Ermordung eines Kapitäns von unserer Küste habe ich nicht gefunden. Ein Faktor dafür ist sehr wahrscheinlich, nämlich dass sich auf den Reisen in Nord- und Ostsee oder ins Mittelmeer, ihren bevorzugten Fahrtgebieten, weniger Spannungen aufbauen. Ein weiterer Faktor wird die Zusammensetzung der Besatzung, die vor allem aus Einheimischen und Skandinaviern bestand, gewesen sein. Im 18. und 19. Jahrhundert waren es vor allem die Unterschiede zwischen den Nord- und Südeuropäern (Dagos – rassistische Bezeichnung vor allem für Italiener, aber auch für Spanier, Portugiesen und Griechen), die zu Spannungen führten. An ihre Stelle traten in der Schifffahrt des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart die Seeleute von den Philippinen, aus Burma (Myanmar), von Sri Lanka, dem Südpazifik usw. Nach der Auflösung des sozialistischen Lagers kamen die Osteuropäer hinzu. Arroganz und Unverständnis auf der einen sowie gewaltbereite Kulturen auf der anderen Seite, vor allem bei den Ukrainern und Russen, führten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. 1975 erschlug ein indonesischer Matrose den Kapitän und drei Offiziere der MIMI und versenkte anschließend das Schiff. Auf der „Seeschlange“ BÄRBEL wurden der Kapitän und vier russische Besatzungsmitglieder getötet. Der verdächtige russische Seemann wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Die PRINZESSIN VICTORIA LUISE, Detroit Publishing Company
Im Dezember 1996 wurde der Kapitän der JANNA von zwei tatverdächtigen Polen getötet und über Bord geworfen. Nicht alle Kapitäne kamen mit den von allen Seiten auf sie einstürmenden Problemen klar. Kapitän Gallas nahm sich 1878, nachdem er in einer ausweglosen wirtschaftlichen Situation seinen in Rostock beheimateten Schoner OTTO&FRIEDA absichtlich versenkt hatte, in einem dänischen Gefängnis das Leben. Kapitän Brunswig von der PRINZESSIN VICTORIA LUISE erschoss sich 1906, nachdem das von ihm geführte Schiff auf einen Felsen der Insel Jamaika gelaufen war. Der letzte mir bekannt gewordene Fall betrifft den Kapitän der CMA CGM LAPEROUSE. Philippe Deruy glaubte nach einer Kollision 2010, das Vertrauen seiner Reederei verloren zu haben, und nahm sich das Leben.