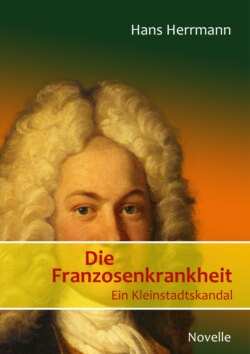Читать книгу Die Franzosenkrankheit - Hans Herrmann - Страница 3
1. Ein tüchtiger Arzt
ОглавлениеDie junge, zierliche Frau, deren dunkle Locken mit dem Hellblau ihres langen Rocks angenehm kontrastierten, klopfte an die Tür zum Ordinationszimmer. In der anderen Hand trug sie ein Körbchen. „Hallo, Johannes, ich bin’s, Katharina.“
„Nur herein, es ist gerade niemand bei mir“, rief eine voll tönende Männerstimme zurück.
Katharina öffnete die Tür und trat in den hellen Raum, dessen Fensterfront zum kleinen Park an der Rückseite des schmucken Herrenhauses hinausging. Durch die Scheiben schien ein sonniger Tag im Frühling des Jahres 1728.
Das Sprechzimmer des Arztes Johannes Kupferschmid präsentierte sich in zweckmässiger und ansprechender Ordnung. Für die Patienten standen ein bequemer Sessel und ein ebenso bequemes Sofa bereit. Auf hölzernen Regalen reihten sich sauber beschriftete, verkorkte Arzneiflaschen sowie kleine, mit runden Deckeln verschlossene Porzellantöpfe, und auf dem Tisch standen Tinte und Papier zum Festhalten der medizinischen Befunde bereit. Die chirurgischen Instrumente bewahrte der Mediziner in den Schubladen eines grossen Korpus auf; so blieben sie für ihren Einsatz sauber und für die ängstlichen Augen der Patienten unsichtbar. Zwei gute Landschaftsgemälde an den Wänden sorgten, soweit dies in einer Arztpraxis überhaupt möglich ist, für eine stubenartig behagliche Atmosphäre.
Der 37-jährige Arzt hatte ebenmässige Gesichtszüge; seine Augen blickten freundlich, und den hygienisch kahl geschorenen Schädel überzog bereits wieder ein Hauch von dicht nachwachsenden blonden Stoppeln. Die Allongeperücke, die er nur trug, wenn er sich in den Gassen zeigte oder an den Sitzungen des Kleinen Rats teilnahm, hing wie ein schlaffer, wattiger Beutel am Kleiderhaken neben der Tür.
Katharina stellte das Körbchen auf den Tisch und entnahm ihm ein kleines, in Wachspapier eingeschlagenes Paket, das sie ihrem Gatten überreichte.
„Hier, Johannes, hast du den Tabak. Es ist Ware aus Amerika, wie du verlangt hast, nicht Berner Eigengewächs.“
„Danke, Katharina. Und ja, ich lege Wert auf Tabak aus Amerika, er ist als Medizin viel wirkungsvoller als die kraftlosen Stauden, die die Gnädigen Herren von Bern neuerdings bei Murten anbauen lassen. Die wollen das Geschäft mit dem begehrten Rauchkraut halt lieber selber machen, als es den Kolonialwarenhändlern zu überlassen. Aber richtig gut gedeiht der Tabak nur auf amerikanischem Boden, davon bin ich felsenfest überzeugt.“
„Der Apotheker Lüdy auch, aber zuerst behauptete er, er hätte keinen Tabak aus Übersee“, erwiderte Katharina. „Dann bat er mich jedoch, einen Moment zu warten, vielleicht könne er mir trotzdem helfen. Als alle anderen Kunden bedient und wir allein waren, zog er aus einer versteckten Schublade dieses Päckchen mit amerikanischem Tabak hervor und gab es mir mit verschwörerischer Miene, als täte er etwas Verbotenes. Er sagte auch, er schenke mir den Inhalt. Er verkaufe mir nur die Verpackung, dafür zu einem teureren Preis, als sie wert sei. Seltsam, nicht?“
Kupferschmid lachte. „So seltsam nun auch wieder nicht. Er darf dir keinen Tabak aus Amerika verkaufen, weil unsere Regierung beschlossen hat, nur das eigene Kraut am Markt zuzulassen, diesen faden Murtenkabis. Deshalb hat er dir die verbotene Ware umsonst gegeben, den Preis aber über die Verpackung hereingeholt, der schlaue Fuchs.“
Nun lachte auch Katharina. Bald aber wurde sie wieder ernst. „Der Lüdy ist uns gut gesinnt, andere sind es weniger“, sagte sie.
Ihr Mann horchte auf. „Hast du dir wieder spitze Bemerkungen anhören müssen?“, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. „Das nun nicht gerade. Aber ein paar Kundinnen bei Lüdy haben mich schon sehr unterkühlt behandelt und mich kaum gegrüsst.“
„Diese vernagelten Sturköpfe hier in diesem dumpfen Kaff“, entfuhr es dem Arzt. Dazu schlug er kräftig auf den Tisch. Dann beruhigte er sich wieder, aber seiner Stimme war die Empörung noch immer anzuhören. „Wir leben hier wirklich nicht gerade unter besonders weltoffenen Leuten. Wenn wir aber Geduld haben, werden wir zu den Gewinnern gehören“, sagte er. „Ein neues Zeitalter bricht an, neue Gedanken und Vorstellungen breiten sich aus, damit haben viele unserer Mitbürger noch ihre liebe Mühe. Nach und nach werden sie sich aber damit anfreunden, denn die neuen Ideen bringen viel Licht ins Leben der Menschen. Gib uns hier noch zehn Jahre, dann wird man uns für unsere aufgeklärte Gesinnung nicht mehr ächten, sondern feiern.“
„Ach, wenn du doch nur recht hättest“, seufzte Katharina. „Mir ist es hier in diesem Städtchen einfach zu eng. In Bern oder Solothurn würde es mir viel besser gefallen, da sind die Leute dem Neuen schon heute zugetan.“
„Davonlaufen ist meine Sache nicht“, sagte ihr Mann. „Wir haben die Praxis und die Klinik hier aufgebaut, das wollen wir doch nicht einfach so aufgeben. Du wirst sehen, in ein paar Jahren werden die Leute schon ganz anders über uns und unsere Heilmethoden denken. Wer weiss – vielleicht werden wir sogar berühmt, und die Patienten kommen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Genf, Paris und Moskau nach Burgdorf, um sich von mir behandeln zu lassen!“
Katharina quittierte es mit einem Lächeln und strich ihrem Gatten leichter über die Schläfe. „Mein Johannes – standfest und unerschütterlich! So muss ein guter Arzt sein. Natürlich bleiben wir hier. Es wäre bloss etwas einfacher, wenn wir nicht immer auf diesen offenen oder versteckten Widerstand stossen würden. Aber wir sind ja bereits daran gewöhnt, also werden wir es auch noch eine Weile aushalten.“
Johannes Kupferschmid war der erste Arzt im kleinen, aber stolzen Berner Landstädtchen Burgdorf, der den akademischen Doktortitel trug. Bisher hatten sich stets Angehörige der niederen Heilerzunft, sogenannte Bader, um die Gesundheit der Burgdorferinnen und Burgdorfer gekümmert, hatten Splitter aus der Haut entfernt, Wunden gesäubert, Geschwüre geschnitten, zur Ader gelassen, Kräuterwickel aufgelegt, Fiebertee gemischt und im schlimmsten Fall brandige Glieder amputiert. Auch Johannes Kupferschmid hatte Erfahrung mit den handfesten Aspekten des Heilberufs; als Feldchirurgus im Zweiten Villmergerkrieg hatte er genügend Gelegenheit gehabt, sich mit klaffenden Wunden, Blut und zersplitterten Knochen zu beschäftigen. Daneben aber war er bestens geschult in Innerer Medizin, in der auskultatorischen, palpatorischen und perkussorischen Diagnose sowie dem Einsatz von iatrochemischen Arzneimitteln.
1715 erwarb er an der Universität Basel den Titel eines Doctor medicinae und ging zurück nach Burgdorf, um hier eine allgemeinmedizinische Praxis zu eröffnen. Er heiratete die Notarstochter Katharina Schläfli, die sich rasch und interessiert in die Aufgaben einer Praxisgehilfin einarbeitete. Kupferschmid war vom Wunsch beseelt, seine Heimatstadt an den Segnungen der wissenschaftlich betriebenen Heilkunst teilhaben zu lassen; allerdings setzten viele Bürgerinnen und Bürger nach wie vor lieber auf die brachialen Methoden der Bader und die geheimnisvollen Mixturen der Kräuterfrauen im emmentalischen Umland.
Dennoch gab es einige aufgeschlossene Geister in der Stadt, die die Praxis in der Villa am Kreuzgraben neugierig aufsuchten und bald entdeckten, dass das Vorgehen des Arztes meist schonender und wirkungsvoller war als jenes des Badstubenbetreibers und seiner Gesellen in der Unterstadt. Zu Kupferschmids treuesten Patienten gehörten der rebellische Buchbinder, Kunstmaler, Chronist und Stadttrompeter Hansrudolf Grimm, aber auch der angesehene Venner Hans Fankhauser, der mit den Gnädigen Herren von Bern gut stand und in jungen Jahren als Offizier in französischen Diensten die Luft der weiten Welt geatmet hatte.
Die wenigen Einheimischen, die Kupferschmid ihr Vertrauen schenkten, hätten aber kaum ausgereicht, ihm den Lebensunterhalt zu sichern. Der Grund, weshalb sich das bisher kinderlos gebliebene Ehepaar trotzdem eines gewissen Wohlstands erfreute, lag in der Privatklinik, die es in Räumen seiner Villa betrieb. Hier behandelte Johannes Kupferschmid Patienten männlichen und weiblichen Geschlechts, die an der Syphilis erkrankt waren. Diese Krankheit galt damals als unheilbar und war eine wahre Geissel der Menschheit, weil so viele davon betroffen waren.
Die Ansteckung erfolgt über sexuellen Kontakt; erstes Anzeichen einer Erkrankung ist ein Knoten am Geschlechtsteil oder an der Mundschleimhaut. Nach einiger Zeit verschwindet der Knoten. Es folgen Fieber, Unwohlsein und ein Hautausschlag, die ebenfalls wieder verschwinden, auch ohne Behandlung. Danach versteckt sich die tückische Krankheit oft jahrelang. Wähnt man sich längst geheilt, schlägt sie eines Tages erst recht zu, schädigt die inneren Organe, greift das Hirn an und führt allenfalls zu geistiger Umnachtung, zuweilen auch zum Tod.
Heute lässt sich die Syphilis gut heilen, früher kamen rabiate Arzneien zum Einsatz, die oft Quecksilber in grosser Dosierung enthielten und dem Patienten mehr schadeten als nützten. Weil die Übertragung durch das Liebesspiel erfolgt, benannte man das Leiden zu Kupferschmids Zeit auch als „Franzosenkrankheit“, denn die Franzosen standen schon damals im Ruf, der Galanterie besonders zugetan zu sein.
Tatsächlich fiel auf, dass vor allem Kranke aus Solothurn Kupferschmids diskrete Privatklinik bevölkerten, zudem solche aus Bern; Solothurn war der Stützpunkt der französischen Diplomaten in der Eidgenossenschaft, und auch Bern stand in regem Austausch mit Frankreich. Kupferschmid führte die Zusammensetzung seiner syphilitischen Klientel allerdings weniger auf den Einfluss französischer Lebensart zurück denn auf den Umstand, dass es sich um Leute aus der urbanen Elite handelte, die sich eine kostspielige Therapie ihres Leidens – das auf dem Land ebenso verbreitet war – überhaupt leisten konnten.
Und teuer war sie, die Kur in der kupferschmidschen Klinik, aber auch erfolgreich. Der Burgdorfer Arzt bekämpfte die Krankheit nicht mit dem zerstörerischen Quecksilber, sondern mit sanften Schwitzkuren und einem Rezept, dessen Hauptbestandteil das tropische Guajakholz war. Die Wirkung blieb nicht aus, die Patienten erfuhren Linderung und ein langsameres Voranschreiten der Krankheit, doch mit einem wirklich nachhaltigen Heilmittel konnte auch Kupferschmid nicht aufwarten. Noch nicht.
Gerade diese neuartige und fortschrittliche Syphilisstation aber war es, die den Burgdorfern Unbehagen bereitete. Dass sich ein akademisch geschulter Arzt, ein Doctor medicinae, mit der Lustseuche befasste, dieser Strafe Gottes für einen sündigen Lebenswandel, gehörte sich nicht. Das war doch Sache des Baders, der auch noch gleich Zuhälter war, des Scherers und der fahrenden Quacksalber, aber doch sicher nicht eines gebildeten und wohlanständigen Mediziners aus der bürgerlichen Oberschicht.
Behutsam wickelte Johannes das Päckchen aus, das Katharina für ihn in der Apotheke geholt hatte. Zum Vorschein kam ein Ziegel aus gepresstem schwarzen Tabak. Er roch daran.
„Hmm, riecht das würzig und kräftig; wenn ich nicht wüsste, dass es ungesund ist, würde ich mir nun eine Pfeife stopfen und munter drauflosschmauchen“, sagte er, griff nach einem Messer, schabte etwas von dem Tabak ab und gab ihn in ein Glas Wasser. Der Schuhmacher Trechsel hatte nämlich für heute seinen Besuch angekündigt; er litt an chronischer Zahnfleischentzündung, die Kupferschmid mit einer Tabakspülung behandeln wollte.
„Übrigens, Katharina“, sagte er, während er den Tabak im Wasser umrührte, „hast du den blauen Teller mit der verschimmelten Kräuterpaste gesehen, der eigentlich dort neben dem Mörser stehen sollte?“
„Ach der; den habe ich gereinigt und weggestellt“, antwortete Katharina.
„Schade, ich habe den Schimmel eigens angesetzt; daraus lässt sich angeblich ein Medikament herstellen, das die Syphilis nicht nur lindert, sondern heilt.“
„Woher weisst du das? Hast du mit Patienten Versuche angestellt?“
„Nein, ich bin neulich auf ein altes Buch gestossen, in dem ein Jesuitenpater berichtet, dass die Einheimischen auf einer Karibikinsel die Lustseuche schon zu Zeiten der spanischen Eroberer mit Schimmelpilz bekämpft hätten, und zwar mit durchschlagendem Erfolg. Das will ich nun unbedingt ausprobieren.“
„Und ich, ich habe die Pilzkultur vernichtet, ich dummes Huhn!“
„Kein Problem. Ich mische einfach eine neue Kräuterpaste und lasse sie ein paar Tage stehen, und schon habe ich wieder den schönsten Schimmel. Stell dir vor, was wäre, wenn es stimmt, was der Jesuit berichtet! Dann hätte ich ein wirksames Heilmittel gegen die Syphilis wiederentdeckt. Und könnte die Menschen vor den Folgen der schlimmen Krankheit bewahren.“
„Und dein Traum von Patienten aus Paris und Moskau würde wahr werden“, ergänzte Katharina.
„Ja, unsere Praxis würde blühen, daran kann kein Zweifel bestehen“, bestätigte ihr Mann.
„Dann könnten wir unseren betuchten Patienten gleich entgegenreisen und unseren Sitz zum Beispiel nach Paris verlegen“, meinte Katharina und lachte.
Johannes lachte auch. „Ja, das würde dir so gefallen. Aber wie gesagt, ich bleibe meiner Heimatstadt treu. So schlimm steht es um mein persönliches Ansehen dann auch wieder nicht, sonst hätte man mich wohl kaum in den Burgdorfer Rat gewählt. Dass man mich als Arzt beargwöhnt und dich gleich dazu, kann sich ändern, vielleicht schon bald. Du darfst mir einfach den Schimmel auf dem Teller nicht mehr wegschrubben.“
Katharina zog eine gespielt beleidigte Schnute. „Und ausgerechnet du ermahnst mich als deine Gehilfin immer zu äusserster Sauberkeit und Hygiene – das hast du nun davon!“ Sie warf ihm eine neckische Kusshand zu und verliess eilig das Ordinationszimmer, denn es hatte an der Haustür geklopft. Der zahnkranke Schuhmachermeister Trechsel war eingetroffen und begehrte Einlass.