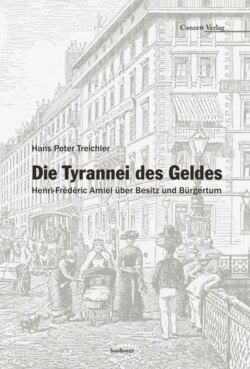Читать книгу Die Tyrannei des Geldes - Hans Peter Treichler - Страница 10
KAPITEL 3
ОглавлениеDer Literat und das Geld oder
La tyrannie de l’écu
Je constate mon défaut croissant de goût pour tout ce qui est finances, placement, comptabilité, etc. J’aime l’ordre, mais je ne puis souffrir les basses œuvres par lesquelles il s’effectue. Je suis heureux qu’on abatte les chiens malades, mais je ne saurais faire le valet de ville.
Ich stelle meine wachsende Abneigung gegen alles fest, was mit Finanzen, Investitionen, Buchhaltung und so weiter zu tun hat. Ich liebe die Ordnung, aber ich ertrage die erniedrigende Arbeit nicht, mit der sie erstellt wird. Ich bin froh, dass jemand die tollwütigen Hunde abtut, aber ich könnte nicht Abdecker sein.
Selber bezeichnete sich Amiel mit Vorliebe als lettré, homme de lettres, seltener als savant, Letzteres mit deutlichen Abstrichen. Denn gehörte zum Intellektuellen, zum Literaten nicht gerade, dass er ständig auf der Suche blieb? Dass er auch als Dozent auf dem Katheder die Frage nach der Erkenntnis vermittelte und nicht die Erkenntnis selbst? Nicht von ungefähr dominierte in Amiels Gedichten, im Penseroso oder in La Part du rêve, das Ungelöste, der offene Schluss. Zahlreiche Verszeilen münden in eine Frage, manchmal mehrere Male pro Strophe:
Suis-je une femme enfin ou suis-je une statue?
Seule, pourquoi faut-il que le désir me tue?
Stellvertretend für die Gesellschaft blieb der homme de lettres offen für Fragen und mögliche Antworten. Er suchte neue Wege in der Welt des Geistes und neue Furten durch die Strömungen der aktuellen Philosophie – anders als der Geistliche, der sonntags von der Kanzel die Gewissheiten des protestantischen Kanons verkündete. Aber was Amiel im Haushalt von Schwager Franki Guillermet täglich vor Augen geführt bekam: Die Genfer Kirche bot mehreren Dutzend Pfarrern ein anständiges Auskommen, eine behagliche Existenz im gutbürgerlichen Rahmen. Welche Möglichkeiten blieben dagegen dem Intellektuellen, der sich genauso wie Franki als Diener des Wortes sah, nur in einem weiter gesteckten Rahmen? Der Lehrstuhl an der Académie, den der junge Amiel mit so grossen Hoffnungen übernommen hatte, erwies sich immer deutlicher als harter und ungepolsterter Sessel. Es gab zahlreiche Verpflichtungen neben den eigentlichen Vorlesungen, Sitzungen über Lehrpläne, Examen und Ernennungen; beim Institut national genevois blieb das Sekretariat der Abteilung Literatur an Amiel hängen. Keine dieser Aufgaben wurde entschädigt. Es blieben einzig das Jahresgehalt für die Professur und der Anteil an den Semestergeldern, das verhasste casuel. Denn diese Sporteln waren völlig ungewiss und hingen ab von der Anzahl eingeschriebener Studenten; diese wiederum schwankte je nach Attraktivität des Kursthemas. Oft kam zum jährlichen Grundgehalt von 2000 Francs nur ein lächerliches Trinkgeld hinzu. «Mon casuel académique du semestre d’hiver est réduit à rien», notiert das Tagebuch mehr als einmal.
Kurz: Wie Genf die Dozenten seiner Académie bezahlte, war eine Schande, une vergogne. «Es reicht gerade für den Ankauf der nötigen Bücher und die Kosten einer Ferienreise.» Die meisten seiner Kollegen, so musste Amiel feststellen, behandelten diese Einkünfte – Gehalt wie Sporteln – als schlechten Witz. Aber dem Unglücklichen, der sein Budget auf diese Beträge stützen musste, waren sie eine trübe Quelle von Kummer und Enttäuschung: un nid à chagrins et une boîte de déceptions ... Gehörte es denn nicht zu den Aufgaben des Staates, seinen Vordenkern einen bescheidenen Wohlstand zu garantieren? Aber nein, für einen kleinen Beamteten der Hochehrwürdigen Republik, Sérénissime République, stellte noch der bescheidenste gesellige Anlass eine unverantwortliche Ausschweifung dar. Amiel bekam das einmal mehr zu spüren, als er im Februar 1867 ein paar Kollegen und Freunde zu einem kleinen Souper einlud und dann die Rechnung überreicht erhielt. «Jedes Glas Wein stellt die Balance auf den Kopf!», klagt das Tagebuch. «Es ist beschämend, daran zu denken. Fünfzehn Gäste stellen, so scheint es, einen ungeheuren Luxus dar für einen Professor, der kein Kapitalist ist. Nur schon eine einzige solche Einladung im Monat würde mehr als die Hälfte meiner mageren Einkünfte verschlingen.»
Wie kam es, dass nur in einem einzigen Beruf die Löhne stagnierten, und zwar bei der «ehrenhaftesten aller Beschäftigungen», nämlich der des Unterrichtens? So wie der Intellektuelle von heute, der seinen Stundenlohn bestürzt mit dem des Garagisten oder Heizungsinstallateurs vergleicht, verwarf Amiel die Hände: «Der kleinste Kommis, der schäbigste Zahnbrecher verdient mehr.» Nein, es lag auf der Hand: Unterrichten, Dozieren war ein Beruf für Gimpel. Wer ihn ergriff, wurde vom Staat über den Tisch gezogen. Noch nicht einmal eine bescheidene Rente für die alten Tage schaute heraus! «Was wird man in diesem métier (...) doch übers Ohr gehauen! Ein Leben lang für Nussschalen schuften! (...) Wenn ich daran denke, bewahre ich nur mit Mühe die Ruhe. Die Republik bestiehlt ihre Diener, und das Schicksal spielt den Geistesarbeitern übel mit.» Denn zur Freiheit des Wortes und des Gedankens gehörte notwendigerweise die Freiheit von den Sorgen des Alltags. Und die stellte das Gehalt der Académie nicht einmal für einen Junggesellen sicher, geschweige denn für eine Familie, die ein verwegener Springinsfeld allenfalls zu gründen wagte.
La gêne, die Bedürftigkeit. Alle Einträge Amiels bezeugen es: Der ärgste Feind des Geistesarbeiters war nicht die nackte Armut. Die Armut stellte die Betroffenen vor ein Entweder-oder, stellte eine existenzielle Herausforderung dar: Man rappelte sich hoch, oder man endete in der Gosse. Was den jungen oder älteren Professor, was den Redaktor oder Künstler lähmte, das war die tägliche Rechnerei, das Schielen auf das Haushaltbuch und den monatlichen Abschluss. Amiels Tagebuch findet vielerlei Ausdrücke dafür: Rappenspalterei, la préoccupation du centime, das unübersetzbare boursicotage, das Scharwenzeln rund um die Geldbörse. Vor allem aber: la gêne, die Bedürftigkeit, die Bedrängnis, die Klemme. Wer als geistig Schaffender, als Literat in dieser Klemme sass, war verloren, war unfrei, auch wenn er sich freier Künstler nannte. «Die Freiheit wird zur Knechtschaft, wenn sie andauernd gegen die Bedürftigkeit kämpfen muss», heisst es im Journal intime vom März 1866. «Diese ängstliche Sorge um jeden Rappen, diese zwanghafte und erzwungene Sparsamkeit – was ist sie, wenn nicht erniedrigendste Sklaverei?»
Amiel notierte diese Überlegungen nach einer Diskussion mit Tante Julie. Julie Brandt, eigentlich eine Cousine seiner Mutter, war 17 Jahre älter als er und als Romantikerin aufgewachsen, mit Idealen, die Amiel eher einer Romanze des Biedermeier zuordnete als der Wirklichkeit. Julie lebte in einer Welt, in der sich das Glück noch in der ärmlichsten Hütte fand und wo mausarme Liebende Liedchen wie L’Amour avec l’eau claire trällerten. «Sie versteht nichts von den Bedürfnissen des heutigen Lebens, so als hätte sie wie Epimenides vierzig Jahre in einer Höhle verschlafen.» Was sollte er mit den Ratschlägen einer romantischen alten Jungfer anfangen? In ihrer Naivität rührten und ärgerten sie ihn zugleich.
Wo Tante Julie recht hatte: Der lettré, auch der Künstler, lebte in einer Welt des Geistes und bezog aus ihr seine Würde und seinen Trost. Aber wie lange hielten Würde und Trost vor für den Literaten in seiner Dachkammer, den Maler im zugigen Atelier? Auf die Dauer mussten beide an den Kleinlichkeiten des Alltags scheitern. «Die Bedürftigkeit», heisst es kurz später im Tagebuch, «ist letztlich noch schlimmer als die Einsamkeit, da sie unfehlbar das intellektuelle Leben abtötet.» Denn das geistige Leben, der Gestaltungsdrang des Künstlers gingen von der Prämisse aus, dass es keine Grenzen gab – für die Wissbegierde, für die Welt der Formen, Klänge und Farben. Wer aber täglich seine Francs und Centimes umdrehen musste, wurde auf Schritt und Tritt ans Limit erinnert, an Schranken und Beschränkung. «Geld zählen heisst eine Grenze ziehen», notiert Amiel, «heisst sie anerkennen, sich vor der Notwendigkeit beugen.» Nein, es gab nur eins für den Literaten, den Künstler: die materielle Absicherung durch einen bescheidenen Wohlstand, une aisance modeste, die kein Nachdenken über Geld mehr erheischte. Letztlich bedingten sich aisance und Freiheit gegenseitig, da mochte Tante Julie noch lange von ihrer Hütte mit dem Strohdach und den kaltes Wasser trinkenden Liebenden schwärmen. «Wenn man Einladungen ausschlagen muss, weil man sie nicht erwidern kann, wenn man sich in den Ferien nicht ein paar Wochen auf dem Land oder in den Bergen leisten kann wie alle anderen, wenn der Ehemann nicht mehr gelegentlich auf einer Reise seine Ideen auffrischen kann, da kann man nicht mehr von Wohlstand und Freiheit sprechen.»
Aber wie hielten es denn die anderen damit? Die Kollegen an der Académie, die so wenig wie Amiel einer der alten Patrizierfamilien Genfs entstammten? Die Dichter und Schriftsteller, zu denen er aufblickte? Hier gab es warnende Beispiele genug – zum Beispiel Walter Scott, dessen Ivanhoe Amiel verehrte. Scott hatte sich als Drucker und Verleger weit auf die Äste hinausgewagt und war in Konkurs gegangen. Genauso erging es Balzac, der sich mit einer Verlagsdruckerei und einer Letterngiesserei in die Nesseln ritt. Wenn sich der Romancier als Geschäftsmann gebärdete, konstatierte Amiel, spielte eine Art Hybris mit. Als Schöpfer seiner Romanwelt war er es gewohnt, seine Figuren nach Belieben einzusetzen, ihnen Pech und Leiden zu bescheren, aber auch Erfolg und Glück. Wehe, wenn der Schriftsteller dieses Prinzip auf die Wirklichkeit übertrug! Erdrückt von einem Schuldenberg, wie ihn beispielsweise Walter Scott während Jahrzehnten abzutragen versuchte, wurde selbst das Genie versklavt: «Même le génie peut devenir le forçat des écus.»
Ungleich näher noch gingen Amiel manche Schicksale aus dem eigenen Lebenskreis, etwa jenes des eine Generation älteren André Cherbuliez. Der hochgebildete Hellenist und Gräzist war ein angesehener Dozentenkollege an der Académie, wahrte aber nur mit Mühe einen würdigen äusseren Rahmen für sich und seine Familie. «Eine schäbige, mühsame Karriere voll geheimer Ängste», notiert das Tagebuch über den väterlichen Freund, «voll von Entbehrungen, Demütigungen und Selbstverleugnung. Noch mit fünfzig Nachhilfestunden geben müssen, unter dem Dach wohnen, seine Kleider austragen, bis sie fadenscheinig werden ...»
Sah so seine eigene Zukunft als Literat aus, als Mann des Wortes? Da war weiter der langjährige Freund Albert Heim, ein Theologe und Gymnasiallehrer. Auch Heim hätte gerne eine eigene Familie gegründet, war aber gefangen in einem Haushalt mit einem kränkelnden Vater und zwei verwaisten Nichten, für die er Tag und Nacht unterwegs war. Eine eigene Gattin, eigene Kinder? Undenkbar. «Der Grund für seinen Verzicht sind die mangelnden finanziellen Ressourcen. Darin besteht die empörende Macht des Geldes, dass es noch das bescheidenste Schicksal zermalmt und die edelsten Instinkte zunichte macht.»
La puissance révoltante de l’écu. Geld versklavte, Geld zermalmte. Amiel konnte verstehen, dass einst die Gesetzgeber der Antike den Unternehmer und Händler aus dem Kreis der freien Männer ausgeschlossen hatten. «Die Begehrlichkeit, die Geldgier, das ist die Knechtschaft. Der Sklave des Mammons ist ebenso wenig ein Mann wie der Leibeigene der Scholle.» Aber stand es ihm als Mann des Wortes denn nicht offen, sich auf würdige Weise vom Schreiben zu ernähren, sich wenigstens einen namhaften Zusatzverdienst zu verschaffen? Wie schaffte das Marc Monnier, der offenbar eine goldene Feder gefunden hatte? Monnier, auch er ein Literat und Dozent, war ein weiterer langjähriger Freund. «Dieses Bürschchen meldet mir doch», heisst es ziemlich missmutig, «dass er monatlich 1000 Francs macht.» Monnier profitierte von der Telegrafenverbindung durch den Ärmelkanal, übersetzte und übermittelte Depeschen zwischen Italien und England. Ein Tausender im Monat! Täglich ein Stündchen Arbeit oder zwei! Und das, ohne sich dem Teufel zu verschreiben! Denn stellte es nicht ein Stück Völkerverständigung dar, wenn man in Westminster wusste, was in Turin vor sich ging?
Amiel selbst schrieb regelmässig für das Journal de Genève, wenn auch mit grossen Abständen – eine Besprechung vom Konzert des Kirchenchors, der Hinweis auf das Buch eines Freundes, mitunter ein Nachruf auf einen verstorbenen Zeitgenossen, der ihm besonders am Herzen lag. Aber über diesen kurzen Texten brütete er ganze Abende lang, war selten mit dem Ergebnis zufrieden, besonders nicht, wenn der Redaktor die wohlgeformten Sätze schliesslich auf zehn oder zwanzig Zeilen zusammenstrich. Wie sollte dabei ein anständiges Honorar herausspringen? Und wie sollte ein Projekt wie die Übersetzung von Schillers «Glocke» je rentieren? Amiel sass monatelang über den rund 400 Verszeilen der Ballade, hielt schliesslich (im Herbst 1860) das schmale Heft mit der französischen Version in der Hand, nahm stolz das Lob eines befreundeten Redaktors entgegen: «Sie haben ein Meisterwerk durch ein Meisterwerk wiedergegeben!» Aber die paar hundert verkauften Exemplare deckten knapp die Druckkosten, und die zweite Auflage blieb in den Gestellen der Buchhändler liegen.
Und wie stand es mit der Hymne à Genève vom Vorjahr, Amiels Beitrag zum 300-jährigen Bestehen der Académie? Ein Komponist namens Franz Grast hatte die Verse vertont; das Festlied war für die Feierlichkeiten im Druck erschienen und verteilt worden. Der Musikverlag Kübli & Noverraz hatte am Druckauftrag verdient, der Komponist war entlöhnt worden – aber Amiel? Ein paar lobende Worte im Journal de Genève und das zweifelhafte Vergnügen, die Hymne im 600-plätzigen Festsaal aufgeführt zu wissen. So wie die Trinksprüche ging sie im Stimmenlärm unter: «Man hörte nichts.»
Amiels Gedichte, welche die Revue du monde gelegentlich aufnahm, brachten jeweils ein paar Francs ein, aber Gedichtbände wie Grains de mil und La part du rêve waren das reine Verlustgeschäft. Der Buchhändler und Verleger Cherbuliez liess sie drucken und verkaufte sie in Kommission. Eine erste Abrechnung nach fünfzehn Jahren ergab, dass je etwa 150 Exemplare über den Ladentisch gegangen waren. Der Reingewinn betrug 98 Francs, die Tantième Amiels ein Viertel davon. So wie jeder Autor, der sich in seinem Stolz verletzt sieht, witterte der Dichter Betrug, bösen Willen, Missgunst und bewusste Vernachlässigung. «Welche Halsabschneiderei! Reiner Diebstahl! Dieser Räuber will mich mit 25 Francs abspeisen ... 25 Francs in fünfzehn Jahren, und kein Wort über die Zinsen! Wenn das ehrlich gehandelt ist, was tun denn die Gauner?»
Comment font les coquins, si c’est là de l’honnêteté? Und beflügelt vom rabenschwarzen Ärger zieht Amiel im Tagebucheintrag gleich noch über Joseph Hornung her, seinen besten Freund, klagt über Aimé Herminjard, der ja auch ein langjähriger und achtenswerter Kollege ist: «J. H. verreist nach Brent und borgt ein paar Bücher bei mir aus. Er kauft nie selbst etwas und profitiert von den Kastanien, die andere aus dem Feuer holen. Warum stellst du dich selber nie so geschickt an? – Hrd. hat genüsslich einige meiner Bände aus dem 16. Jahrhundert durchgeackert. Diese Schlingel von Gelehrten lecken sich die Finger, wenn sie ein seltenes Buch in die Hände bekommen. Aber man sollte ihnen den Willen lassen, nur schon um die Freude zu sehen, mit der sie es sich unter den Nagel reissen.»
Macht er sich denn nie ernsthaft Gedanken darüber, sich ganz als Autor zu etablieren, vom Schreiben zu leben – er, den man in seinem Kreis als tiefsinnigen und gleichzeitig geistreichen Causeur rühmt? So abwegig ist der Gedanke auch für einen kleinen Genfer Professor keineswegs. Gleich zwei von Amiels nächsten Bekannten schaffen sich als Korrespondenten der grossen Pariser Gazetten einen Namen. Er erlebt in den 1860er-Jahren mit, wie sie beide in die französische Hauptstadt ziehen und sich dort behaupten. Edmond Scherer, mit dem er bei manch einer Wanderung auf den Mont Salève über Gott und die Welt diskutiert hat, schafft es in Paris zum führenden Literaturkritiker von Le temps. Victor Cherbuliez, der Sohn des ärmlichen Griechischprofessors und Bruder des Mädchens mit den meergrünen Augen, steigt auf zum gefeierten französischen Romancier, wird in die Ehrenlegion aufgenommen. Ist es ihretwegen, dass sich Amiel erstmals Gedanken über eine literarische Karriere macht, im reifen Alter von 42 Jahren? «Mit der Feder Geld verdienen – sagen wir tausend Francs im Jahr; dieser Gedanke kommt mir zum ersten Mal. Es wäre die einzige Lösung, die mir erlauben würde, ein armes Mädchen zu heiraten. Und es wäre vielleicht auch die einzige Möglichkeit, meine Scheu vor dem Sich-Produzieren zu überwinden.»
Es soll hier noch die Rede sein von Amiels fast zwanghafter Beschäftigung mit den Kosten einer Eheschliessung und der Gründung eines gutbürgerlichen Haushalts. Was uns hier interessiert, ist die Frage der beruflichen Laufbahn. Geht es dem Autor im Grunde genommen zu gut, trotz aller Klagen über die kümmerliche Besoldung durch die Académie? Hindert ihn das kärgliche, aber gesicherte Einkommen, ergänzt durch die Erträge seines kleinen Vermögens – hindert es ihn daran, ein gut verkäufliches Werk zu schaffen, das sich an ein breites Publikum richtet? Das ihn ins Gespräch bringt, vielleicht auch auf den Pariser Redaktionen? Es fehlt an Druck und Zwang von aussen, und so gesehen stellen seine Einkünfte eine Art allzu sanftes Ruhekissen dar, un oreiller de paresse. Mehr als einmal merkt er es selbst an: Statt sich auf ein durchschlagendes Werk zu konzentrieren, verzettelt er sich mit seinen Konzertkritiken, seiner Hymne à Genève und Gelegenheitsarbeiten wie einem gereimten Stadtführer für Touristen. Hat denn die Welt auf launige Verse über die Gassen der Genfer Altstadt gewartet?
Auf einer der Wanderungen zum Mont Salève hat er mit den Freunden Scherer und Heim eine Anfrage der Genfer Bildungsdirektion diskutiert. Er, Amiel, soll ab Januar 1861 eine zehnteilige öffentliche Vortragsreihe im Stadthaus halten, Thema frei wählbar. Die Freunde warten mit einem ganzen Feuerwerk möglicher Sujets auf. Amiel notiert sie getreulich. Weshalb nicht eine populär gehaltene Betrachtung über das Wunderbare: Le merveilleux, son analyse et son histoire? Und wenn er das Material ohnehin zusammentragen muss – weshalb das Ganze nicht anschliessend ausarbeiten zu einem Buch, womöglich hübsch illustriert? Was das Genfer Publikum sicher ebenso interessiert: die Kultur des Geschmacks. Eine Vortragsreihe unter dem Titel Le goût, sa valeur et sa culture würde bestimmt die Damenwelt ins Stadthaus locken. Oder eine Untersuchung des Komischen, müsste sie nicht auch die Herren interessieren? Le Comique et ses variétés hätte zudem den Vorteil, dass Amiel ungeniert Beispiele anführen dürfte, mit Witzen oder Bonmots das Publikum zum Lachen bringen würde.
Dreizehn Themen kommen so schliesslich zusammen. Amiel wählt das unauffälligste von allen, Le langage et la langue maternelle, und hält am 8. Januar im Hôtel de Ville den ersten seiner zehn Vorträge. Die Sprache und das gesprochene Wort – das tönt nach philologischen Spitzfindigkeiten, nach trockenem Kästchendenken. Entsprechend lichten sich denn auch die Sitzreihen im Stadthaus schon in der dritten Januarwoche. Währenddessen hält, an einem anderen Wochentag, Kollege Victor Cherbuliez seine Vorträge zum Artusroman und zur höfischen Liebe vor brechend vollem Saal, auch bei Folge zwei, drei und so weiter bis in den März.
Cherbuliez, der Sohn des bedrängten Griechischprofessors, wird nach Paris ziehen. Amiel nicht. Es fehlt am Zwang, am Druck von aussen; zuhause wartet das weiche Ruhekissen, l’oreiller de paresse.
Amiel verdient zu wenig für ein Leben ohne Sorgen und trotzdem zu viel, als dass sich ein energischer, zupackender, selbstbestimmter Lebensentwurf aufdrängen würde. Aber was hindert ihn daran, sein eigenes kleines Vermögen zu optimieren, solange die Ehefrage offenbleibt? So wie viele seiner Bekannten hier und dort eine Anlage zu tätigen, wie ihm dies sein Treuhänder Louis Goetz immer wieder rät? Er könnte, meint Goetz, täglich ein halbes Stündchen für diese Dinge einsetzen, gleichsam mit der linken Hand die Finanzen nachführen, während er mit der rechten an einem ernsthaften Werk arbeitet. So wie dies jeder solide Haushalt handhabt, so wie Schwester Fanny es ihm täglich vorlebt: nouer les deux bouts, sein Scherflein zusammenhalten. So wie die Schwester und ihr Mann «das Gleichgewicht finden zwischen Bedürfnissen und Möglichkeiten, zwischen Einnahmen und Ausgaben». Und dabei tüchtig nutzen, was übrig bleibt. Weshalb gelingt ihm das nicht?
Regelmässig zum Jahresende erklingt im Tagebuch das gleiche Lied: Die Finanzen sind in Unordnung, es fehlt die Übersicht. «Mit Beschämung den wirren Zustand meiner Buchhaltung und die Unordnung meiner Kontoauszüge konstatiert», heisst es beispielsweise zu Silvester 1854. «Versäumnisse jeglicher Art in meinen Geschäften und meinen finanziellen Interessen. Alles als Folge meiner fatalen Faulheit, die alles aufschiebt, und meiner Unkenntnis bei den Methoden und Vorgehensweisen.» Manchmal reisst er sich zusammen, sortiert er seine Werttitel, setzt er sich mit Goetz und seinem Bankier Lejeune zusammen, zahlt das Bargeld ein, das sich in seiner Schublade angesammelt hat – die schmalen Honorare vom Journal de Genève, das Kursgeld für die Literaturvorlesungen, die er am Töchterinstitut der Demoiselles Maunoir hält. Aber noch viel öfter tut er nur das Allernötigste mit dem Bezahlen ausstehender Rechnungen, lässt er den Rest schleifen. Ist es der Hochmut, mit dem der geistig Tätige auf die Welt der Finanzen herunterblickt? «Geld verdienen erscheint mir instinktiv als eine schäbige Sache, die allein durch die Unterwerfung unter ein moralisches Ziel veredelt wird – zum Beispiel seine Familie ernähren, das Gesetz der Arbeit erfüllen, Gutes tun und so weiter. Ich ehre die Arbeit und heisse alle Berufe gut, aber der Handel, das Geschäft, die Bank stossen mich direkt ab, als niedrigste unter den menschlichen Tätigkeiten, als gemeinste und beschämendste.»
Der Eintrag stammt vom Herbst 1856. Damals ist er 35-jährig, aber auch der 50-Jährige empfindet ähnlich, wenn nicht noch eine Spur heftiger. «Ich stelle meine wachsende Abneigung gegen alles fest, was mit Finanzen, Investitionen, Buchhaltung und so weiter zu tun hat», heisst es im Frühling 1870. «Ich liebe die Ordnung, aber ich ertrage die erniedrigende Arbeit nicht, mit der sie erstellt wird. Ich bin froh, dass jemand die tollwütigen Hunde abtut, aber ich könnte nicht Abdecker sein.» Und später, im gleichen Eintrag: «Man könnte meinen, ich sei ein Adliger des Ancien Régime, so sehr missfällt mir das bürgerliche Krämertum, so widerlich ist mir dieses Jonglieren mit Zinsen, Konti, Wechseln undsoweiter. Lieber noch werde ich von diesen Beutelschneidern mit ihrem Geldriecher ausgebeutet, als dass ich mich mit dieser unwürdigen Wissenschaft herumschlage. Ich gehöre nicht in meine Zeit und in meine Schicht.»
Je ne suis pas de mon temps ni de ma classe ... Sollen wir das hier so stehen lassen? Es wird im folgenden Kapitel die Rede sein vom Dilemma, das Amiel während eines Vierteljahrhunderts immer neu formuliert hat: Wie finde ich eine Braut, mit der ich einen gutbürgerlichen Haushalt gründen kann? Wie lässt sich die Forderung nach einer namhaften Mitgift, ohne die ein standesgemässer Lebensstil unerreichbar bleibt, vereinbaren mit dem Ideal bedingungsloser gegenseitiger Liebe? Fällt er auch damit ausserhalb seiner Zeit, seiner Klasse?
Vorerst steht als Fazit fest: Im Umgang mit Geld schwingt beim feinsinnigen Philosophen stets die Stilfrage mit, vermischt mit dem Gefühl des verletzten Stolzes. «Die Tyrannei des Mammons ist erniedrigend», heisst es so oder ähnlich immer wieder. «Es ist unwürdig, dem Reichtum nachzujagen; es ist irritierend, vom Mammon abhängig zu sein.» Vom Geizigen oder vom Geldscheffler, der dem Geld dient, sagt ein Dichterwort, er sei «seines Knechtes Knecht». Natürlich will er sich nicht zu ihnen gezählt wissen. Aber sieht denn die Knechtschaft, die das Budget ausübt, so völlig anders aus?
Tatsächlich wird Amiel erst im Jahre 1873, zweieinhalb Jahrzehnte nach seiner Ernennung zum Dozenten, bei der Académie eine Gehaltserhöhung fordern. Obwohl Erziehungsdirektor Carteret umgehend, ja fast schon erschrocken, die Bezüge um die Hälfte anhebt, kann sich Amiel über den Triumph nicht so recht freuen. Zwar bezieht er statt 2000 nun 3000 Francs im Jahr – aber er hat sich mit seinem Vorpreschen selbst verleugnet, ist sich selbst untreu geworden. «Il est odieux de sortir de son caractère, après 24 ans de discrétion», bedauert er im Tagebuch. Immerhin hat ihn nicht Gewinnsucht zu seiner Forderung getrieben, auch das will er festgehalten wissen. Oh nein, es war das Gefühl für Recht und Unrecht, le sentiment de justice.
Nach welchen Kriterien wähle ich meine Zukünftige? Geist, Schönheit, Reichtum? Amiels Heiratspläne scheitern alle an der einen oder anderen Klippe.