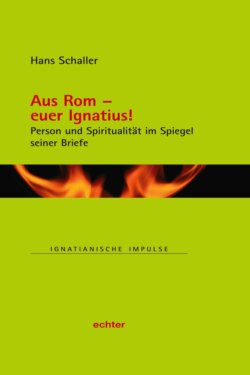Читать книгу Aus Rom - euer Ignatius! - Hans Schaller - Страница 9
Оглавление1. Aura schreibender Menschen
Der Brief ist kostbar. Er kann Träger lebenswichtiger Mitteilungen sein. – Um zu begreifen, was ihn so bedeutend und wertvoll macht, müssen wir für einen Moment zu seinen Anfängen zurückgehen, zu dem, was im Hand-Schreiben überhaupt passiert. Was geschieht denn mit uns, wenn wir einen Stift in die Hand nehmen, wenn wir Buchstaben auf das Papier setzen?
Ein Griffel in der Hand
Um bei etwas ganz Äußerem zu beginnen: »Das Besondere vom Hand-Schreiben liegt vorerst darin, dass hier buchstäblich Hand angelegt wird.«3 Es sind bei diesem Tun nicht allein die Finger, die beansprucht werden, sondern die ganze Hand, ja sogar der Körper. Der Stift muss richtig angefasst werden, muss gut in der Hand liegen; man muss sich richtig hinsetzen. Nur so wird das, was aufs Papier kommt, lesbar, vielleicht gar schön. So kann auch Freude am Schreiben entstehen.
Die Hände sind beim Schreiben ganz im Dienste des Leibes, ja des ganzen geistigen Menschen. Sie gehorchen unserem Geist und scheinen doch ein Eigenleben zu führen: »Die Hand … ist Tätigkeit; sie ergreift, sie erschafft und manchmal ist man sogar versucht zu sagen, dass sie denkt. Wenn sie ruht, ist sie nicht ein seelenloses Werkzeug, das man auf dem Tisch zurücklässt oder das am Körper entlang herabhängt: Die Gewohnheit, der Instinkt und der Wille zur Tat wachen in ihr, es braucht keine lange Übung, um die Gebärde zu erraten, die sie ausführen wird.«4
Die Hand, die ganze äußere Haltung müssen zum Schreiben vorbereitet und disponiert werden. Dies aber nicht allein. Auch der Geist muss für das Schreiben geordnet werden. Was vor allem nottut, ist die Bereitschaft, sich für diese verlangsamte Bewegung, dieses Nacheinander von Worten, Zeit zu nehmen, sich dafür zu sammeln. Ein Stift in der Hand macht ruhig, konzentriert die Kräfte, lenkt den Blick aufs Papier. Er schafft damit die Voraussetzung, dass Gedanken und Formulierungen entstehen können.
Sehr poetisch und detailliert wird dieses Hand-Anlegen, das beim Schreiben vor sich geht, von Ulla Hahn beschrieben, wenn sie ausführt:
»Seit ich schreiben konnte, liebte ich das lautlose Gleiten meiner Hand über den offen und frei vor mir liegenden Bogen, nichts zwischen der Verwandlung der Schwingungen meiner Nervenzellen in Schwünge auf dem Papier. Ich liebte den Anblick meiner Hand, meiner schreibenden Hand, die Haltung von Daumen, Zeige- und Mittelfinger, die Willfährigkeit des Schreibgeräts. Die Kinderfaust mit dem Griffel auf der Schiefertafel verschwand in der älter werdenden Hand mit dem buntmelierten Federhalter, verschwand in der mit dem Kolbenfüller … Bleistifte lagen in meiner Hand, Kugelschreiber, egal.
Von Anfang an war es mir gleichgültig, womit ich schrieb, allein die Bewegung zählte, das Aufspapierbringen der Buchstaben, Wörter und Sätze. Den Körper verlängern in der Schrift; sein Innerstes nach außen kehren. Gedanken sichtbar machen. Mich schreiben, mich befestigen, Ding-Festmachen … Von Anbeginn war die Schreibmaschine nur ein Ärgernis, ein Hindernis zwischen mir und der Schrift. Es nicht zu überwinden eine Frage der Ehre. Nichts außer meiner Hand sollte meine geliebten Buchstaben hervorbringen. Ich wollte sie nicht an eine Maschine verraten.«5
Ein Stift am Mund
Nicht ohne Grund zeigen Bilder von schreibenden Menschen, wie sie gesammelt sind, wie sie innehalten und still werden. Sie machen den Eindruck, als ob sie auf ihre Gedanken warten müssten, halten den Stift bereit, bis er sich in Bewegung setzt. Die Rede formt sich auf den Lippen.
Schönstes wie auch ältestes Beispiel davon ist das Bild der Sappho, einer bedeutenden Lyrikerin der Antike. Sie wird gezeigt, wie sie den Stift am Munde hält, nach innen lauscht, um auf die Worte zu warten, die sie als Brief auf die Wachstafel schreibt.
Ein Stift am Munde! Eine Geste von Einhalt, Unterbrechung, von Pause. Es wird gewartet, man gibt sich Zeit, damit sich die Gedanken, die wir suchen, einstellen können. Aber auch Gefühle und Emotionen, die an der Wurzel unserer Gedanken sind, müssen inneren Raum haben, damit sie geklärt werden. Wo sie Zeit bekommen, wird es allgemein ruhiger, der Zorn wird gedämpft und das Blut beginnt ruhiger zu fließen. – Aus solchen Erfahrungen mag die Bemerkung von Max Frisch stammen, mit der er sein schriftstellerisches Tun zusammenfasst: »Das war eigentlich immer schon so, dass ich schreibend erst meine Erfahrungen entdeckte.«
Ein Wort auf der Zunge
Nicht immer jedoch hat der Schreibende die nötige Geduld, mit dem Stift am Mund auf die Gedanken zu warten. Oft sind die Gefühle so hitzig und streitbar, dass sie aufs Papier drängen. Sie stürzen wie eine Flut nach außen, müssen niedergeschrieben werden, egal, ob dies schön oder durcheinander gerät. Unausgegoren und ungeordnet fließen sie aufs Papier, breiten sich dort aus und werden sichtbar – Montaigne muss seiner Feder freien Lauf lassen, wenn etwas Schönes entstehen soll: »Diejenigen Briefe, die mir die meiste Mühe kosten, taugen am wenigsten. Sobald ich langsam schreibe, so ist dies ein Zeichen, dass ich meine Gedanken nicht drauf habe; ich fange gern an, ohne vorher zu wissen, was ich schreiben will. Die ersten Gedanken bringen die nächsten hervor.«6
Wie immer wir schreiben, ob schnell oder langsam, wir suchen nach Worten, warten darauf, dass sie sich bilden. Wir erspähen unser Inneres, hoffen auf Licht, Klärung, Sinn. Dass aus dem Durcheinander Ordnung entsteht, vage Gefühle sich in Worten fassen lassen.
Wo wir ausdrücklich Briefe auf das Papier bringen, da erspähen wir nicht bloß unser Inneres, sondern auch das des Adressaten. Die Erkundung des eigenen Selbst weitet sich zu einem Dialog. Briefe sind Gespräche. Sie vermögen diese nicht zu ersetzen, erreichen nie oder nur ganz selten diese Unmittelbarkeit, wie sie spontanem Austausch eigen ist. Sie können das Aug in Aug nicht ersetzen, bleiben ein Notbehelf. Goethe sagt es einmal mehr auf schöne und präzise Weise: »Das Papier ist eine kalte Zuflucht gegen deine Arme.«7
Dennoch hat der Brief wiederum Vorteile, die dem Gespräch abgehen. Nicht nur kann der Brief das Gespräch nicht ersetzen, es gibt auch Dinge, die für die Spontaneität eines Gespräches ungeeignet sind und im Brief besseren Platz finden. Probleme, die man sich mündlich nicht anzusprechen traut, sei es aus Rücksicht oder Scheu oder einfach weil die Situation nicht passt, die jedoch im Brief ruhig Platz finden. Dieser hat eine Vertrautheit, die in der direkten Begegnung nicht immer gegeben ist. Es gibt Worte, Mitteilungen, die einen besonderen Rahmen brauchen, um gesagt werden zu können.