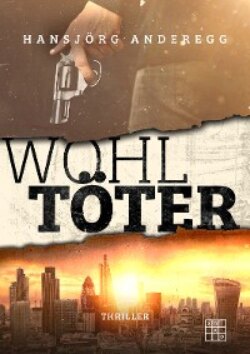Читать книгу Wohltöter - Hansjörg Anderegg - Страница 6
ОглавлениеKapitel 2
South Kensington, London
Gegen ein Uhr morgens betrat Chris den Laden des Pakistaners an der Sloane Avenue gegenüber ihrem Wohnblock. Der Tante-Emma-Laden war nicht viel mehr als ein prall gefüllter Schlauch. Ein Füllhorn mit allerlei Nützlichem und noch mehr Ramsch. Vierundzwanzig Stunden am Tag offen, sieben Tage die Woche. Das Family Business des Rashid Barija. Das greise Familienoberhaupt stand an manchen Abenden selbst im Laden, außer freitags. Er brauche wenig Schlaf, hatte er ihr schon beim ersten Besuch anvertraut. Er liebte lange Gespräche, kannte sich aus in der Lokalpolitik und hatte eine klare Meinung zur Regulierungswut des Mayors. Auch das hatte sie schnell festgestellt, nachdem sie vor zwei Wochen im Haus gegenüber eingezogen war. Einen besseren Einstieg ins pralle Londoner Leben hätte sie sich nicht wünschen können.
»Ist Rashid nicht da? «, fragte sie den jüngeren seiner Söhne an der Kasse, der praktischerweise auch Rashid hieß.
»Nein, Miss Chris. Vater hat sich erkältet.«
»Das ist doch kein Grund für ihn, nicht im Laden zu stehen.«
Rashid lachte. »Ja, Sie haben recht, aber Mutter hat es ihm verboten.«
»Kluge Frau.«
Im Grunde kam ihr die Abwesenheit des kommunikativen Alten nicht ungelegen. Der erste Arbeitstag im Yard hatte sie ziemlich geschafft. Sie war zu kaputt für lange Diskussionen. Beide Hände voll mit Essigchips und vier Flaschen Mineralwasser und Cola, alles Größe XXL, verließ sie den Laden. Sie hatte Glück. Eine Nachbarin, die in der Etage unter ihr wohnte, traf gleichzeitig ein und schloss die Haustür auf. Unter dem leichten Mantel trug sie elegante Abendkleidung.
»Auch Spätschicht?«, scherzte Chris.
Die Frau war etwa gleich alt wie sie, hatte ungefähr die gleiche Statur. Neckische Ponyfransen kitzelten ihre Stirn, und sie schaute sie mit braunen, fast schwarzen Rehaugen erschrocken an. »Nein – ich war in der Oper. Orfeo«, stammelte sie.
»Oh, Barock, Monteverdi.«
Die Frau lächelte erleichtert. »Kennen Sie die Oper?«
»Nur Ausschnitte. Ich habe sie nie gesehen. Barockopern sind nicht so mein Ding.«
»Meins auch nicht, ehrlich gesagt«, lachte die Nachbarin. »Ich habe nur meiner Freundin einen Gefallen getan. Eigentlich mag ich die modernen Musicals.«
»Ich liebe so ziemlich jede Musik seit Mozart.«
Die Frau hielt ihr die Lifttür auf. Es gab doch Menschen im Haus, mit denen man reden konnte, dachte Chris. Während der ersten zwei Wochen war sie hin und wieder einem Mitbewohner begegnet, hatte jedoch kein Wort gewechselt. Es war beim freundlichen Kopfnicken geblieben, wie sie es nicht anders erwartet hatte in der Großstadt. Sie benutzte die Gelegenheit, streckte der Nachbarin ihre Rechte entgegen, so gut es ging, ohne die Flaschen fallen zu lassen, und stellte sich vor:
»Ich bin übrigens Chris.«
Die Frau schlug zaghaft ein. »Kate. Freut mich – dass wir uns kennenlernen.«
»Mich auch, Kate. Ich fürchtete schon, die Leute im Haus hätten die Sprache verloren.«
»Sind alle sehr beschäftigt, wie Sie.«
»Da haben Sie wohl recht.«
Sie verließ den Aufzug mit ihrer neuen Bekanntschaft, verabschiedete sich und stieg die Treppe hinauf zu ihrer Wohnung. Jeder Schritt schmerzte. Sie hätte im Stehen einschlafen können. Ihre Hand tastete nach dem Schlüssel. Eine der Plastikflaschen begann zu rutschen. Sie fiel zu Boden und rollte polternd die Treppe hinunter. Mit einem leisen Fluch ging sie in die Knie, schaffte es gerade noch, ihre Einkäufe abzusetzen, bevor sich weitere Flaschen selbständig machten.
»Alles in Ordnung?«, fragte Kate besorgt mit der Flasche in der Hand.
»Ja, Entschuldigung – danke. Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz zurechnungsfähig.« Sie erhob sich ächzend und schloss auf.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Nein, vielen Dank, ich bin schon O. K., nur zum Umfallen müde.«
Es war ihr äußerst peinlich, dass Kate die Unordnung in ihrer Wohnung sah. Im Korridor stapelten sich immer noch die Umzugskartons. Die drei Zimmer waren bestenfalls notdürftig eingerichtet. Was eigentlich ein schönes Apartment hätte sein können, glich einer Besenkammer. Das fiel ihr erst jetzt auf, nachdem fremde Augen das Chaos gesehen hatten. Für die paar Stunden, die sie sich, meist schlafend, hier aufhielt, genügten ein Bett, ein Schrank, ein kleiner Küchentisch und ein Stuhl. Zwei Stühle, falls doch einmal jemand zu Besuch käme. Die paar Bücher, die sie nicht elektronisch besaß, lagerten noch in einer Kiste, zusammen mit der Musikanlage und dem originalverpackten ›IKEA‹-Regal. Nur das Wichtigste hatte sie ausgepackt. Die Zahnbürste, ein paar Klamotten, ihre Schuhe und das Saxophon, ihren treusten Begleiter, dem sie täglich eine Stunde widmete, um abzuschalten oder sich aufzurichten. Charlie ›Bird‹ Parkers ›My Melancholy Baby‹ war eine kostenlose Droge, wirksamer als jedes Valium oder Aspirin. Am Ende des ersten Arbeitstages wollte sie allerdings nur noch eines: Die Augen schließen in der Hoffnung, nicht von Wasserleichen und Pathologinnen zu träumen.
Scotland Yard, London
Vielleicht hätte sie doch besser einen der Kollegen gefragt, statt sich auf den Plan im Intranet zu verlassen. Chris stand ratlos, mit dem halbleeren Pappbecher in der Hand, im Gebäudeflügel, der die Labors der Kriminaltechnik beherbergen sollte. Es roch nach frischer Farbe. Die meisten Türen im langen Korridor waren nicht angeschrieben. Dort, wo das forensische Labor sein sollte, fand sie ein leeres Großraumbüro und endlich einen Menschen, den sie fragen konnte. Der Maler bemerkte sie nicht. Er stand auf seiner Leiter, summte leise vor sich hin und strich die Decke im Rhythmus der Musik aus seinem iPod. Sie blieb in sicherer Entfernung stehen, winkte und rief, bis er den Farbroller absetzte und einen Stöpsel aus dem Ohr zog. Er starrte sie mit offenem Mund an.
»Das hier ist wohl nicht die Kriminaltechnik?«, fragte sie ironisch.
»Keine Ahnung, Miss.«
Er stopfte den Knopf ins Ohr und widmete sich wieder der Decke. Humor ist auch in England Glückssache, dachte sie kopfschüttelnd. Sie trank die kalte Brühe aus, zerknüllte den Becher und warf ihn zum andern Müll neben der Leiter. Mit dem Telefon am Ohr kehrte sie dem passionierten Maler den Rücken.
Ron lachte laut auf, als er hörte, wohin sie sich verirrt hatte. »Wie, um alles in der Welt, sind Sie denn auf die Idee gekommen?«
»Sie werden’s nicht glauben. Ich habe im Netz nachgesehen.«
»Verstehe. Ich weiß nicht, wie gut das Intranet beim BKA ist, aber hier nimmt man es nicht mehr so genau mit der Aktualität seit der letzten Sparrunde. Manchmal hat man Glück …«
»Beschreiben Sie mir einfach den Weg, Ron«, unterbrach sie ungeduldig. Sie war schon zehn Minuten zu spät und kam sich reichlich albern vor.
»Sicher, Entschuldigung, Sergeant. Die Technik ist vor zwei Wochen ins Erdgeschoss umgezogen, 10 Broadway.«
»Heißen Dank.«
Die hellen, großzügigen Räume und die moderne Einrichtung der Labors flößten ihr wieder etwas Vertrauen ein. Niemand wunderte oder beklagte sich, dass sie eine Viertelstunde zu spät zur vereinbarten Besprechung kam. Im Gegenteil, ihr schien, die Leute wären überrascht, dass sie überhaupt auftauchte.
»Sie müssen Dr. Hegel sein«, begrüßte sie ein älterer Gentleman im offenen, weißen Labormantel freundlich.
Sie nickte und gab ihm die Hand. »Dr. Powers, nehme ich an?«
»So ist es. Freut mich, Adams neue Stütze in unserer Küche willkommen zu heißen. Ich hoffe, der DCI hat Ihnen die Lust an der Arbeit noch nicht ganz genommen.«
»So leicht, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, wird er mich nicht wieder los«, lachte sie.
»Nehmen Sie nur nicht alles ernst, was er sagt. Meist bereut er es, sobald es raus ist. Dann läuft er mit einer Miene durch die Gegend, als säße er auf seinem Echinocactus, und das ist wirklich sehenswert.«
Die Atmosphäre in diesem Labor gefiel ihr immer besser. Hier unter Chemikern, Physikern und Hochleistungsmessgeräten fühlte sie sich ohnehin zu Hause. Powers bat sie an einen der Schreibtische, wo Beutel mit Proben, Akten, Fotos vom Fundort der Leiche und Großaufnahmen von Details der Kleidung auslagen. Er nahm eine der Akten und gab sie ihr.
»Das sind unsere vorläufigen Erkenntnisse. Wir müssen davon ausgehen, dass der Tote mindestens zwölf Stunden im Wasser lag. Das macht es uns nicht gerade leichter, wie Sie wissen.«
Sie überflog die wenigen Seiten schnell, während er die weiteren Ergebnisse zusammenfasste. Plötzlich stutzte sie. »Sie haben ein Haar an der Jacke gefunden«, staunte sie. »Wieso wurde das nicht weggespült?«
»Es befand sich im Innern der Seitentasche.«
»Stammt es vom Toten?«
»Mit Sicherheit nicht. Und der DNA-Abgleich mit der Datenbank war negativ, falls das Ihre nächste Frage ist.«
»Ein fremdes Haar«, murmelte sie nachdenklich. »Könnte wichtig werden.«
»Falls sich diese Person meldet«, spottete Powers.
»Was ist mit dem Blut auf der Kleidung?«
»Sein eigenes. Es gibt keine fremden Blutspuren.«
»Also doch ein Unfall?«
Er zuckte die Achseln. »Spekulationen überlasse ich Ihnen. Ich stelle nur die Tatsachen zusammen.«
»Schon klar«, grinste sie. Mit dem gleichen Satz hatte sie während ihrer Arbeit im Labor des BKA den Kommissaren geantwortet. Sie fragte weiter: »Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Herkunft der Kleider?«
»Ja und nein. Es handelt sich um Massenware, Standardausrüstung für Pflegepersonal. Finden Sie in jedem Spital und an tausend anderen Orten. Nach dem Zustand der Fasern zu urteilen, dürfte das Material höchstens zwei Jahre alt sein. Wir kennen die Lieferanten. Dauert eine Weile, alle Lieferungen zu überprüfen.«
»Vielleicht wurden die Sachen gestohlen.«
»Auch daran haben wir gedacht. Ein Schuss ins Leere, wie sich rasch zeigte. Sie glauben nicht, was alles in den Kliniken gestohlen wird.«
Sie deutete auf einen der Beutel, in dem ein schmutziger Stofffetzen steckte. »Was wissen wir über diese Schmutzspuren?«
»Rost und mikroskopische Farbreste, die wir bisher leider nicht zuordnen konnten.«
Sie blickte ihn erstaunt an. Die Analyse solcher Spuren war forensische Routine, dauerte normalerweise keine zwei Stunden. »Wann glauben Sie …«, begann sie vorsichtig, doch er winkte ab.
»Ich weiß, was Sie denken, und ich muss Ihnen leider zustimmen.« Er ließ den Blick betrübt über sein Labor schweifen, während er murmelte: »Wir sind eben erst umgezogen.«
Sie konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. »Ich weiß.«
»Was Sie aber nicht wissen: Einige Apparate sind noch nicht einsatzfähig, zum Beispiel unser MS.«
»Sie haben kein Massenspektrometer?«, rief sie bestürzt.
»Sieht so aus«, gab er kleinlaut zu.
Sie schüttelte verwirrt den Kopf. Ein modernes forensisches Labor ohne MS mutete an wie ein Büro ohne elektrisches Licht. Der gute Dr. Powers und seine Leute waren sozusagen auf einem Auge blind, solang diese Geräte nicht funktionierten. »In diesem Fall kann ich wohl annehmen, dass es auch kein Gaschromatogramm gibt«, meinte sie mitfühlend.
»Sie vermuten völlig korrekt: Die ganze GC/MS Kette ist außer Betrieb. Und das Beste ist, ich weiß noch nicht einmal, wann wir wieder voll einsatzfähig sind.«
»Na prost!«
Sie schaute ihn eine Weile unschlüssig an. Dieser Zustand bedeutete schlicht, dass die Spuren nicht professionell analysiert werden konnten. Nicht eben beruhigend, wenn sie daran dachte, dass es sich bereits um Leiche Nummer zwei handelte.
»Was machen wir jetzt?«
»Ich habe vor vier oder fünf Tagen den Antrag gestellt, externe Labors zu benutzen, während wir hier nicht arbeiten können. Die Antwort steht noch aus.«
»Warum überrascht mich das nicht?«
»Ich sehe, Sie verstehen unsere Situation. Für die Schreibtischtäter in der Administration bedeutet es kaum mehr als eine Kaffeemaschine, die nicht funktioniert. Vielleicht können Sie mehr Druck aufsetzen.«
»Ausgerechnet ich als blutiger Neuling?«
»Unterschätzen Sie sich nicht. Sie haben das Ohr des DCI, da bin ich mir ganz sicher. Er erkennt Kompetenz sofort, auch wenn er nichts vom Fach versteht.«
Sie schaute ihn misstrauisch an. Nahm er sie auf den Arm? Als sie seinen ernsten, gespannten Ausdruck sah, errötete sie leicht. »Ich kann’s versuchen«, meinte sie unsicher. »Aber das hilft mir in unserm Fall nicht weiter. Sie erwähnten externe Labors. Meinten Sie ein Bestimmtes?«
Er entspannte sich. »Aber sicher«, lächelte er. »Meine Tochter arbeitet als Assistentin im Chemielabor des Imperial College.«
»Zufälle gibt’s. Und ihr Massenspektrometer funktioniert?«
Er brach in schallendes Gelächter aus. »Davon können wir wohl ausgehen«, rief er, »ebenso wie alle andern Geräte, von denen wir hier nur träumen können.«
Beim Blick auf die Uhr erschrak sie. Höchste Zeit, sich zu verabschieden. Der DCI und die rote Zora erwarteten sie in der Pathologie.
»Na, ausgeschlafen?«, brummte DCI Rutherford mürrisch, als sie den Obduktionssaal betrat.
Einer seiner Kaktussprüche, nahm sie an und ignorierte die Bemerkung. Stattdessen grüsste sie ihn und die Pathologin freundlich.
»Treten Sie näher, meine Süße«, lockte Dr. Barclay mit ihrer rauchigen Stimme.
Der Tote vom Hampton Pier lag unter einer Decke auf dem Chromstahltisch. Einen Augenblick lang bildete Chris sich ein, selbst unter dem Tuch zu liegen. Dr. Barclay war eine attraktive Frau. Ihre forschenden und zugleich sinnlichen Blicke schnitten wie scharfe Skalpelle in ihre Seele. Das beklemmende Gefühl, ihr ausgeliefert zu sein, löste sich erst, als der DCI sich ungeduldig räusperte:
»Können wir loslassen? Wir haben nicht ewig Zeit.«
Die Pathologin schlug das Tuch soweit zurück, dass sie Kopf und Brust des Toten sehen konnten. »Männliche Leiche, 25 bis 30 Jahre alt«, begann sie. »Höchstwahrscheinlich Pakistaner aus dem Nordosten des Landes, Kaschmir vielleicht. Schürfungen am rechten Ellenbogen, beiden Unterarmen und am linken Schienbein.« Sie ergriff die rechte Hand des Toten und hielt sie Chris unter die Nase. »Abgebrochener Fingernagel am rechten Pollex und Index. Die Schürfungen hat er sich kurz vor seinem Tod zugezogen. Sonst keine äußeren Wunden.«
»An den kaputten Fingernägeln ist er wohl nicht gestorben«, brummte Rutherford.
»Sind wir schlecht gelaunt, Chief Inspector?«
»Keine Ahnung, wie du dich fühlst. Ich weiß nur, dass ich so schnell wie möglich wieder hier raus will. Also, woran ist er gestorben?«
Dr. Barclay neigte ihren Kopf, dass sie fast Chris‘ Wange berührte, und flüsterte ihr ins Ohr: »Was sagen Sie dazu, der DCI hat Angst vor Toten.« Laut antwortete sie: »Der Mann ist auf See ertrunken, und zwar eindeutig im Bereich der Themsemündung. Es muss schnell gegangen sein. Er hat sich nicht lange über Wasser halten können.«
»War er geschwächt, krank?«, fragte Chris.
Die Pathologin schenkte ihr ein warmes Lächeln, als sie antwortete: »Kann man wohl sagen. Wäre er nicht ertrunken, hätte ihn die fortgeschrittene Pneumonie getötet.«
Der Befund erstaunte Chris. »Tod durch Lungenentzündung? Ungewöhnlich bei einem so jungen Menschen.«
»Sie haben völlig recht, meine Teure. Aber dies ist kein gewöhnlicher junger Mann. Sein Immunsystem war erheblich geschwächt.«
»Drogen, HIV?«
»Nein, Medikamente. Immunsuppressoren.«
»Todkrank ertrunken, mal was Neues«, meinte der DCI kopfschüttelnd. Anzeichen, dass er ins Wasser gestoßen wurde?«
Dr. Barclay schüttelte ihren roten Pferdeschwanz. »Keine Hämatome, die darauf hindeuten. Er hat zwar alte Druckstellen an beiden Hand- und Fußgelenken, als hätte man ihn eine Weile gefesselt oder irgendwo festgebunden, aber die haben nichts mit seinem Tod zu tun.«
Rutherford rümpfte die Nase. »Also doch ein Unfall.«
»Oder eine Panikreaktion?«, vermutete Chris. Die abgebrochenen Nägel und Schürfungen deuteten für sie eher auf eine Flucht. »Vielleicht wollte er sich in letzter Minute festhalten und ist dann ins Wasser gestürzt.«
»Das wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen«, pflichtete die Pathologin bei.
Rutherford schnaubte verächtlich. »Großartig. Halten wir uns doch an die Tatsachen: Es gibt offenbar keine Anzeichen von Gewalteinwirkung. Der Junge ist einfach ertrunken, wie du versicherst, Doctor. Damit ist der Fall wohl fürs Morddezernat erledigt.«
Dr. Barclay warf ihm einen eisigen Blick zu und wetterte: »Ich bin noch lange nicht fertig, Chief Inspector. Oder interessieren wir uns heute nicht für die Innereien?«
»Nicht wirklich. Mach es kurz.«
Sie schlug die Decke noch weiter zurück, legte den Unterleib des Toten frei. »Hier habe ich etwas Interessantes festgestellt, sehen Sie?«
Chris bemerkte zwei lange Narben zu beiden Seiten auf Taillenhöhe. »Operationsnarben«, rief sie überrascht. »Die linke sieht noch ziemlich frisch aus.«
Die Pathologin strahlte. »Dein süßer Sergeant hat eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe«, verriet sie dem DCI. »Vielleicht wissen wir auch, was man hier operiert hat?«
»Soll das ein Scheiß Quiz werden?«, gab Rutherford unwirsch zurück.
Dr. Barclay wartete schmunzelnd auf Chris’ Antwort. Sie tat ihr den Gefallen und sprach aus, was sie sofort vermutet hatte: »Nierentransplantation?«
»Bingo!«, freute sich die Ärztin.
»Man hat beide Nieren ersetzt?«
»Das nicht, sehen Sie selbst.«
Die Pathologin fasste ohne Vorwarnung in den Bauchhöhlenschnitt, zog das Gewebe auseinander, sodass sie das Innere der rechten Seite sehen konnten. Der DCI wandte sich angewidert ab, während Chris sich keine Blöße geben wollte. Sie brauchte keine medizinische Ausbildung, um festzustellen, dass die Niere auf dieser Seite fehlte. Wo das Organ liegen sollte, klaffte eine Lücke. Die Gefäße waren sauber verschlossen, die Wunden vernarbt. Man hatte diese Niere chirurgisch entfernt.
»Der junge Mann hat seine rechte Niere gespendet«, bestätigte Dr. Barclay. »Freiwillig oder unfreiwillig, das müssen Sie entscheiden.«
Sie schloss die Bauchdecke wieder und holte eine Nierenschale vom Arbeitstisch. »Das ist die andere Niere«, erklärte sie. »Und dieses Organ hat es in sich«, bemerkte sie dazu, während sie den Deckel entfernte.
Rutherford schaute nicht hin, und Chris konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Kein Wunder, hatte sie doch noch keine Niere gesehen, abgesehen von geschnetzelter Kalbsniere an Sahnesauce. Auch das nur einmal.
»Fällt Ihnen nichts auf?« Sie beantwortete die rhetorische Frage gleich selbst: »Das ist keine menschliche Niere.«
Rutherford fuhr herum, als wäre eine Bombe detoniert. »Was?«, rief er verblüfft.
»Du hast schon richtig gehört, Chief Inspector. Das hier ist keine menschliche Niere.«
»Was zum Teufel ist es dann?«
»Ich vermute, sie gehörte einem Sus domestica, bevor man sie dem Mann eingepflanzt hat.«
»Rede Klartext, verdammt.«
»Es ist wahrscheinlich die Niere eines gemeinen Hausschweins. Die Untersuchung steht noch aus.«
Chris starrte den blaugrauen Klumpen in der Schale an wie ein Wesen aus einer andern Welt. Ihr wurde übel beim Gedanken daran, einst etwas ganz Ähnliches gegessen zu haben. »Xenotransplantation«, murmelte sie bestürzt. »Das ist doch …«
»Verboten, nehme ich an«, ergänzte der DCI.
Die Pathologin runzelte die Stirn und schüttelte ärgerlich den Kopf. »So klar ist das leider nicht, wie vieles in unserem Rechtssystem. 1997 wurde die ›UK Xenotransplantation Interim Regulatory Authority‹, kurz UKXIRA, gegründet. Dieses übergeordnete und unabhängige Gremium sollte alle Aspekte und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verpflanzung von tierischem Gewebe und tierischen Organen auf den Menschen untersuchen und koordinieren. Die UKXIRA hatte das letzte Wort bei Forschungsprojekten und Transplantationen. Das Gremium wurde allerdings im Dezember 2006 stillschweigend aufgelöst. Seither ist es praktisch den einzelnen Forschungseinrichtungen überlassen, an welche ethischen und medizinischen Richtlinien sie sich bezüglich Xenotransplantation halten wollen.«
»Mit andern Worten, jeder macht, was er will«, schnaubte Rutherford.
Chris wollte nicht glauben, was sie hörte. »Sie sprachen von Forschungseinrichtungen«, sagte sie unsicher. »Was bedeutet das aber für Spitäler und Kliniken? Führen die solche Transplantationen tatsächlich durch?«
»Mir ist bisher nur ein Fall bekannt«, lächelte die Ärztin mit einem Blick auf den Toten. »Und der war nicht sehr erfolgreich. Nein, die klinische Anwendung ist nicht erlaubt. Wer diese Schweineniere einem ursprünglich gesunden jungen Mann eingepflanzt hat, gehört hinter Gitter, wenn Sie mich fragen.«
Die Pathologin bedeckte den Toten wieder, warf die Gummihandschuhe in den Abfalleimer und packte Chris plötzlich am Arm. »Gilt unsere Verabredung noch?«, fragte sie lauernd.
Der unerwartete Angriff warf Chris völlig aus dem Gleichgewicht, schnürte ihr die Kehle zu. »Welche Verabredung?«, wollte sie fragen, doch sie sah die Ärztin nur entgeistert an.
»Sie wollten mir alles über sich erzählen«, flüsterte die Frau nahe an ihrem Ohr, bevor sie den Arm losließ.
Der DCI wandte sich zum Gehen. »Wenn das alles ist, wir haben zu tun. Kommen Sie Sergeant.«
Chris zwang sich, nicht aus dem Saal zu rennen. Draußen bedankte sie sich hastig bei ihrem Vorgesetzten. »Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist«, murmelte sie errötend. »Wir haben keine …«
Rutherford lachte. »Vergessen Sie’s. Die spinnt, wenn Sie meine bescheidene Meinung hören wollen. ›Mad‹ Barclay verdient ihren Spitznamen zu Recht. Hat Detective Cornwallis Sie nicht gewarnt?«
»Er hat etwas angedeutet. Mad also. Ich weiß nicht. Für mich sieht es eher aus wie der verzweifelte Versuch, der Einsamkeit der Leichenhalle zu entfliehen.«
Der DCI schüttelte den Kopf. »Pathologen haben grundsätzlich nicht alle Tassen im Schrank«, grinste er. »Ich wundere mich, dass es stets genügend von der Sorte gibt.«
Das verstand sie auch nicht. Pathologen wie Mad Barclay mussten ausgesprochene Materialisten sein. Für sie war ein toter Körper nichts weiter als eine schier unerschöpfliche Experimentiermasse. Aber vielleicht galt das auch für andere Mediziner und lebende Körper. Die Besprechung in Dr. Barclays Totenreich hatte jedenfalls eines deutlich gemacht: Sie konnten den Fall des Toten vom Hampton Pier nicht einfach als unaufgeklärten Unfall zu den Akten legen. Zurück im Büro besprach sie die Obduktionsergebnisse mit Ron. Sie hatte eine neue Aufgabe für ihren Partner.
»Wir müssen die Transplantationszentren befragen. Können Sie das machen?«
»Klar. Die Suche in der Vermissten-Datenbank hat bisher nichts ergeben, und bis die Resultate aus Canterbury vorliegen, wird es noch eine Weile dauern. Womit vertreiben Sie sich die Zeit, Sergeant, wenn ich fragen darf?«
»Ich helfe der Kriminaltechnik«, schmunzelte sie. Auf den Sergeant würde er nicht so schnell verzichten.
Der DCI saß in seinem Terrarium am Schreibtisch. Sie benutzte die Gelegenheit, klopfte an die Glastür und trat ein. Er schob den Bericht beiseite, an dem er gearbeitet hatte, und blickte sie fragend an.
»Sir, Detective Cornwallis wird die 25 Kliniken befragen, die Nierentransplantationen durchführen.«
»Wird zwar nichts bringen, aber es muss sein«, meinte er stirnrunzelnd.
»Das fürchte ich auch. Ich war übrigens heute Morgen bei der Kriminaltechnik. War – ziemlich enttäuschend.«
»Kein Vergleich mit dem BKA?«
»Das habe ich nicht gemeint, Sir.«
»Wollte ich Ihnen auch nicht raten«, grinste er. »Jonathan ist ein alter Freund von mir. Ich halte große Stücke auf ihn. Übrigens versteht er etwas von Kakteen.«
»Was natürlich nicht zu unterschätzen ist«, spottete sie. »Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich zweifle nicht im Geringsten an der Kompetenz von Dr. Powers oder an der Qualität der Arbeit in seinem Labor. Das Problem ist, dass er zurzeit ein scheinbar unlösbares Problem hat.«
Um Rutherfords Augen bildeten sich Lachfältchen. »Haben wir das nicht alle?«
»Im Ernst, Sir. Seit dem Umzug funktionieren wichtige Apparate nicht mehr oder noch nicht. Das Labor verfügt nicht einmal mehr über ein Massenspektro …«
»O. K., O. K.«, winkte er ab. »Was wollen Sie mir eigentlich sagen?«
»Wir müssen die Materialproben extern untersuchen lassen, wenn wir in unserm Fall weiterkommen wollen. In diesem Zustand kann uns Dr. Powers Labor nicht weiterhelfen.«
Rutherfords Reaktion überraschte sie völlig. »Warum sagt mir das der alte Bock nicht selbst?«, brauste er auf. »Scotland Yard ohne Kriminaltechnik. Das darf nicht wahr sein.« Er starrte eine Weile missmutig durch sie hindurch, dann begann er plötzlich zu schmunzeln. »Das scheint mir eine ideale Aufgabe für unsern Chief zu sein, meinen Sie nicht auch?«
Sie hütete sich, zu antworten, obwohl sie ihm zustimmen musste. Für eine funktionierende Infrastruktur und reibungslose Abläufe zu sorgen, war eine ebenso edle Aufgabe des Managements, wie Beförderungsanträge abzulehnen.
»Mager, in der Tat«, kommentierte er ihre Schilderung der Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung.
»Eben. Ich meine, wir sollten wenigstens versuchen, die Herkunft der Kleidung und der Rost- und Lackspuren genauer einzugrenzen. Mit den geeigneten Geräten hätten wir in kurzer Zeit Gewissheit, nichts zu übersehen.«
»Spart im Endeffekt Kosten«, nickte der DCI. »Auch das müsste der Chief einsehen.«
Er hatte seinen Entschluss gefasst, gab ihr das O. K. für die externe Untersuchung und griff zum Telefon.
Imperial College, London
Das physikalisch-chemische Labor am Imperial College, das Dr. Powers empfohlen hatte, wirkte auf den ersten Blick nicht sehr vertrauenerweckend. Der Raum war zu klein und vollgestopft mit Instrumenten, deren Zweck Chris nur erraten konnte. Aber Gaschromatograph und Massenspektrometer funktionierten, wie ihr Powers Tochter Janice erfolgreich demonstrierte.
»Wundert mich, dass Dad nicht dabei ist«, bemerkte Janice, während sie auf die Ergebnisse der ersten Probe warteten. »Sonst lässt er keine Gelegenheit aus, mich zu kontrollieren, wissen Sie.«
Genau um dieses Vorurteil zu entkräften, hatte Powers sie allein geschickt. Vielleicht sollten die beiden öfter miteinander reden. Während sie Janice insgeheim beobachtete, bereitete sie die zweite Probe vor, ein handtellergroßes Stück der Jacke des Toten. Janice hatte sofort begriffen, was sie mit der Analyse erreichen wollte. Sie arbeitete schnell und konzentriert, beherrschte ihren Stoff und die Hightech-Werkzeuge. Dr. Powers brauchte sich wirklich keine Sorgen um seine Tochter zu machen. Der Apparat begann, das Ergebnis der Analyse auszudrucken. Chris atmete auf, als sie die ersten ›Peaks‹ sah, deutliche Ausschläge des Detektors. Entgegen ihren Befürchtungen war die Kurve, die das Spektrogramm darstellte, alles andere als flach. Janice hatte nicht zuviel versprochen. Ihr Gerät der neusten Generation vermochte auch metallische und metallorganische Atome und Verbindungen zu entdecken. Das war wichtig für die Untersuchung der Rost- und Farbspuren.
»Ich kopiere das Ergebnis jetzt auf Ihren USB-Stick, ist das in Ordnung?«
Chris nickte. »Ja, bitte. Den Abgleich mit den Referenzdaten muss ich im Büro machen.«
Die Kurve des Spektrogramms war eine verwirrende Folge unterschiedlich hoher und breiter Spitzen, jede charakteristisch für die Häufigkeit eines chemischen Elements oder Moleküls. Der Computer im Yard würde diesen ›Fingerabdruck‹ mit dem Spektrogramm bekannter Substanzen vergleichen. So hoffte sie, mehr über die Art der Umgebung herauszufinden, wo sich der junge Mann vor seinem Tod aufgehalten hatte.
Die zweite Probe enthielt keine sichtbaren Verunreinigungen. Mit ihr suchte sie nach Hinweisen über die Atmosphäre, die Luft, in der das Opfer seine letzten Stunden verbrachte. Die Kleider nahmen Gerüche auf, die mit diesen empfindlichen Geräten auch nach Stunden im Seewasser nachzuweisen waren. Nach einer Stunde steckte sie die Ergebnisse beider Proben in die Aktentasche. Mehr war aus den Stofffetzen nicht herauszuholen, war sie überzeugt.
Janice schaute befremdet zu, wie sie zusammenpackte. »Was ist mit den andern Tests?«
Dr. Powers Liste! Die Checkliste mit seinen genauen Anweisungen lag unbenutzt auf Janices Schreibtisch. Chris hatte sie sofort nach ihrer Ankunft in diesem fantastischen Labor verdrängt. »Ach – richtig«, murmelte sie verlegen, »wir sollten Ihren Vater nicht enttäuschen.«
»Nein, sollten wir nicht«, lachte Janice.
»Wäre es möglich, mir die restlichen Resultate zu mailen? Ich möchte mich so schnell wie möglich um diese Auswertungen kümmern.«
»Kein Problem. Die Rechnung schicke ich dann Dad.«
Scotland Yard, London
Chris’ Augen schmerzten von der stundenlangen Arbeit am Bildschirm. Die Auswertung der Spektrogramme war schwieriger, als sie angenommen hatte, doch allmählich ergab sich ein zusammenhängendes Bild. Sie erhob sich, um die verkrampften Muskeln zu dehnen. Sofort stand Ron neben ihr.
»Kaffee?«
»Ein Schokoladeriegel wäre mir lieber, ehrlich gesagt.« Sie hatte den ganzen Tag nichts gegessen, brauchte dringend Zucker.
»Ihr Wunsch ist mir Befehl«, grinste Ron. Er ging zu seinem Schreibtisch, durchwühlte mehrere Schubladen und kehrte schließlich mit einer Auswahl von Süßigkeiten zurück. »Alles originalverpackt«, versicherte er triumphierend.
Sie betrachtete erst ihn, dann seine Riegel misstrauisch. Die Kandidaten hatten teilweise ihre Form verloren. Sie sahen alle nicht sehr vertrauenerweckend aus. Aber der Hunger siegte. Sie zog einen heraus. »Wusste nicht, dass die noch hergestellt werden«, wunderte sie sich, bevor sie ihn in den Mund schob.
»Werden sie auch nicht. Das Ding hat Seltenheitswert.«
Die Kollegen ringsum brachen in lautes Gelächter aus, was Ron die Zornesröte ins Gesicht trieb.
»Ehrlich, das war einer der Letzten weltweit«, verteidigte er sich.
Chris schluckte die antiken Kohlenhydrate in einem Kraftakt hinunter. »Ein Kaffee wäre jetzt doch nicht schlecht«, meinte sie dann. Sie zupfte den verstörten Detective am Ärmel, um ihn zum Automaten zu lotsen.
»Pass auf, sie ist scharf auf deine Sammlung«, war das Letzte, was sie verstand, bevor Ron die Tür hinter ihnen zuschlug.
»Idioten«, zischte er wütend.
Nur mit Mühe verbarg sie ihre Heiterkeit. Um die Klippe zu umschiffen, fragte sie ihn nach seinen Ermittlungsergebnissen.
»Enttäuschend«, antwortete er. »Die Kliniken weisen jeden Verdacht auf Xenotransplantation weit von sich. Ich habe trotzdem die Operationsprotokolle der letzten zwei Monate verlangt. Die schriftlichen Unterlagen werden morgen oder übermorgen eintreffen. Ich nehme allerdings nicht an, dass wir darin etwas Neues finden werden.«
Sie nickte. »Keine Überraschung. Das bestätigt nur unsere Vermutung: Die Transplantation wurde illegal, ohne offiziellen Nachweis, durchgeführt. Was wiederum ganz gut zu meinen Resultaten passt.«
Das Mahlwerk des Kaffeeautomaten verhinderte jede weitere Unterhaltung. Sie wartete, bis der Apparat die braune Brühe ausspuckte, dann fasste sie zusammen, was die Analyse der Kleiderproben aufgedeckt hatte:
»Ich habe Rückstände von Peroxiden gefunden. Das sind Sauerstoffverbindungen, die vor allem in aggressiven Reinigungsmitteln vorkommen, wie man sie in Kliniken verwendet. Typische Komponenten solcher Spitalreiniger sind PES, Peroxiessigsäure, und Wasserstoffperoxid, wie man es auch zum Bleichen verwendet. Zudem gibt es Spuren von Chlor, was auf Ammoniumchlorid oder Salmiak hindeutet, auch eine häufige Komponente in Spital-Reinigungsmitteln. Die Waschmittelrückstände sind nicht aussagekräftig. Übliche Waschmittel eben, wie man sie überall findet. Soweit deckt sich das Ergebnis mit den Spuren, die man von einer Klinik erwartet.«
»Aber?«, drängte Ron, als sie eine Kunstpause einlegte.
»Jetzt kommt die Überraschung. Die Umgebung, in der sich der Mann vor seinem Tod aufgehalten hat, weist geringste Spuren metallorganischer Farbe auf, wie man sie benutzt, um Eisen zu färben – oder zu tarnen.«
»Ein Container?«, rief Ron verblüfft.
Sie schmunzelte. »Dachte ich zuerst auch, bis ich noch etwas herausfand.«
»Jesus, Sergeant. Machen Sie’s nicht so spannend. Ich fange gleich wieder zu rauchen an.«
»Das würde ich mir nie verzeihen«, lachte sie. »Dieser Typ Farben wird seit 1945 nicht mehr benutzt.«
»Ein alter Container.«
Sie schüttelte den Kopf. »Unmöglich. Die ersten Container tauchten in der US-Armee 1948 auf.«
»Ein Schiff? Die Navy?«
»Könnte sein. Ich habe auch deutliche Spuren von Dieselkraftstoff entdeckt. Allerdings …«
Ron zerknüllte den Becher in schierer Verzweiflung, als sie innehielt. »Mensch!«
»Zuviel ›GtL‹«, grinste sie. »Anteile, die aus Synthesegas hergestellt werden. Dieses Gemisch verbrennt sauberer, wird aber kaum auf Schiffen verwendet.«
Er schnaubte verächtlich. »Großartig. Die Wissenschaft gibt uns mehr verfluchte Rätsel auf, als sie löst.«
»Ein wahres Wort, Ron. Immerhin wissen wir jetzt, dass sich das Opfer vor seinem Tod mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einer normalen Klinik aufgehalten hat. Wir suchen nach einem alten Gebäude, dessen Wände vermutlich aus Stahl bestehen oder mit Stahlplatten verstärkt sind. Mindestens Teile davon müssen mit grauer Tarnfarbe bestrichen sein, wie man sie von alten Kriegsschiffen kennt. Und das Gebäude ist nicht am Stromnetz angeschlossen.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Der Dieselkraftstoff. Ich nehme an, die Spuren stammen von einem Generator.«
Ihre Geschichte gefiel dem DCI gar nicht, als sie eine Stunde später den Bericht ablieferte. Die Andeutung, es könnte sich um eine Einrichtung der Navy handeln, bedeutete Ärger. Gewaltigen Ärger.
»Und Powers stützt diese Hypothese?«, wollte er wissen. »Ich habe seinen Bericht noch nicht gesehen.«
Sie nickte. »Er bestätigt die Ergebnisse der Untersuchung, obwohl er die Navy nicht explizit erwähnt.«
»Wenn die etwas beherrschen, ist es dichtzuhalten«, schnaubte er. »Die Militärköpfe werden uns gar keine Informationen liefern. Sie werden ihre eigene Untersuchung durchführen, ohne Ergebnis. Das ist so sicher, wie ich hier sitze und mich blau ärgere.«
Er meinte es keineswegs ironisch, sprach offenbar aus Erfahrung.
»Noch wissen wir nicht, ob die Navy betroffen ist«, betonte sie. »Wir haben nur Hinweise auf die Art des Gebäudes, das wir suchen.«
»Und genau das werden wir tun«, nickte er. »Geben Sie eine neutrale, aber möglichst detaillierte Suchmeldung an die Dienststellen rund um die Themsemündung in Kent und Essex heraus. Keine Aktion, nur Meldung, verstanden?«
Vielleicht handelte es sich doch um eine Abrechnung unter den Clans. Chris zweifelte daran, aber sie konnten bisher keine Möglichkeit ausschließen. Es gab zwar keinen Beweis, dass der junge Pakistani ins Wasser gestoßen worden war, aber gegen die Hypothese eines simplen Unfalls sprach die erste, verschwundene Leiche. Die beiden Fälle hingen mit großer Wahrscheinlichkeit zusammen, aber auch das war nicht sicher. Was allerdings eine Schweineniere mit einer Familienfehde zu tun haben sollte, verstand sie am allerwenigsten.
Sie hatte Rutherfords Glashaus schon verlassen, als er sie zurückrief. Er hielt ihr eine Akte hin. »Der Obduktionsbefund«, murmelte er und widmete sich wieder seiner Arbeit.
Erleichtert nahm sie die Klemmmappe entgegen. Sie hatte schon befürchtet, Mad Barclay würde ihr den Bericht persönlich überbringen. Den ersten Teil des Dokuments überflog sie schnell. Die Beschreibung des Leichnams und der Organe enthielt nichts, was sie nicht schon wusste. Der letzte Teil über die toxikologische Untersuchung interessierte sie mehr. Im Blut des Toten wurden keine Drogen gefunden, wohl aber Rückstände eines Medikaments, dessen Name ihr nichts sagte. Die Pathologin beschränkte sich darauf, diese nüchterne Tatsache festzuhalten, ohne zu erklären, was sie bedeutete.
»Mist«, seufzte sie schwer.
Ron, den Telefonhörer am Ohr, schaute verwundert über den Bildschirmrand. Er bot ihr einen der grasgrünen Äpfel an, die plötzlich wie durch ein Wunder auf seinem Schreibtisch lagen, während er am Telefon die immer gleichen Fragen stellte. Sie betrachtete das Obst misstrauisch, rieb, bis es glänzte, dann biss sie vorsichtig hinein. Die Säure fühlte sich angenehm frisch an. Sie ließ sich Zeit beim Kauen. Zeit, die sie brauchte, um sich auf das unvermeidliche Gespräch mit der gefährlichen Pathologin vorzubereiten.
»DS Hegel!«, freute sich Dr. Barclay mit einer Stimme, als hätte sie eine 0909 Nummer gewählt. »Ich wusste, Sie würden anrufen. Im Augenblick habe ich allerdings sehr wenig Zeit für Sie …«
Chris dankte dem Himmel. »Kein Problem, Doctor«, unterbrach sie schnell. »Ich habe nur eine ganz kurze Frage zu Ihrem Obduktionsbericht.«
Ein langgezogenes »Jaaa?« war die Antwort.
»Der Tote hat das Medikament Thymoglobulin im Blut, und Sie erwähnen explizit, dass kein Tacrolimus nachzuweisen ist. Was bedeutet das?«
»Eine kurze Frage, sagten Sie. Meine Liebe, die Antwort könnte dauern. Wollen Sie nicht lieber …«
»Ein knapper Hinweis würde mir genügen.« Mit der Elektronik der Telefonverbindung zwischen ihnen war es leichter, Abstand zu wahren, fand Chris.
»Wie Sie meinen.« Sie hörte Dr. Barclay die Enttäuschung an. »Also, kurz gesagt geht es um Folgendes: Die Schweineniere wurde dem jungen Mann höchstens zwei Wochen vor dem Tod eingepflanzt. In dieser Phase von Leber- und Nierentransplantationen ist es üblich, Medikamente wie ›Prograf‹, also Tacrolimus, zu verabreichen, ein Immunsuppressivum. Das Immunsystem wird dadurch geschwächt, das fremde Gewebe wird besser angenommen. Dass er kein ›Prograf‹ erhalten hat, ist für mich unverständlich.«
»Thymoglobulin statt ›Prograf‹?«
»Nein, die beiden ergänzen sich. Thymoglobulin wird verwendet, um akute Abwehrreaktionen zu verhindern. Es tötet T-Lymphozyten, weiße Blutkörperchen. Die Behandlung ist sehr heikel, da sich der Patient extrem leicht infizieren kann, weil sein Abwehrsystem nicht mehr funktioniert. Daher die schwere Lungenentzündung. Die Thymoglobulin-Therapie findet deshalb praktisch ausschließlich in keimfreien Klinikräumen statt.«
»Herzlichen Dank, Doctor. Sie haben mir sehr geholfen.«
Sie legte auf, bevor die Pathologin doch noch mehr Zeit für sie erübrigen konnte.
»Neues von Mad Barclay?«, fragte Ron grinsend.
»Allerdings. Unser Container muss mit ziemlicher Sicherheit auch eine moderne Klinik sein.«