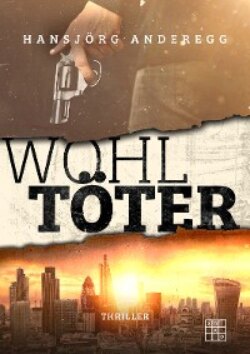Читать книгу Wohltöter - Hansjörg Anderegg - Страница 7
ОглавлениеKapitel 3
South Kensington, London
Wieder hörte Chris das ungewohnte Geräusch. Mit geschlossenen Augen drehte sie sich auf den Rücken. Es war Samstagmorgen. Gab es einen Grund, die Augen aufzuschlagen? Das hartnäckige Geräusch. Sie blinzelte. Es war düster im Zimmer. Die weiße Decke wirkte alt und grau. Das Geräusch kam vom Fenster. Ein steifer Wind schmetterte schwere Tropfen an die Scheibe. Das Trommeln hatte sie geweckt. Mürrisch schaute sie auf die Uhr und sprang mit einem Satz aus dem Bett. Schon nach neun. Sie erinnerte sich plötzlich wieder an den Grund für das Aufstehen am freien Samstag. Die Gründe, um genau zu sein. Während der hektischen ersten Woche beim Yard war so ziemlich alles Private liegen geblieben. Morgens vor sieben ohne Frühstück aus dem Haus, nachts kaum vor Mitternacht ins Bett, todmüde und doch den Kopf voll neuer Eindrücke, Theorien und Zweifel, die sie lange nicht einschlafen ließen. Ihr neues Leben in der City war geprägt von einem eklatanten Mangel an Zeit. Das Apartment brauchte dringend eine Putzfrau, obwohl sie es kaum benutzte. Die Umzugskartons in Flur und Wohnzimmer blickten sie mit jedem Tag vorwurfsvoller an. Sie war weit davon entfernt, den Rhythmus zu finden, den man hier brauchte, um längere Zeit unbeschadet zu überleben. Sie hatte nicht einmal ihre Dreizimmerwohnung im Griff, geschweige denn ihr gesellschaftliches Leben.
»Welches soziale Leben?«, fragte sie die sperrige Schachtel mit dem Aufdruck ›BILLY Bookcase‹.
»Alles braucht seine Zeit«, antwortete die Schachtel.
»Und genau die habe ich nicht.«
Was konnte sie anderes erwarten von einem Stück Pappe. Sie schlurfte lustlos in die Küche. Die stumme Zwiesprache mit dem Kühlschrank blieb kurz und heftig. Nach einem Blick ins leere Eierfach schlug sie ärgerlich die Tür zu. Brot gab es zwar, aber ihr fehlte das Beil. Und draußen regnete es von allen Seiten, als hätte der Himmel beschlossen, die Stadt einmal gründlich zu waschen.
»Das ist gemein, weißt du das?«, schalt sie den Kühlschrank.
Vorsichtig, als dürfte sie nicht stören, prüfte sie die Kaffeemaschine, ihre letzte Hoffnung auf ein menschenwürdiges Erwachen. Bohnen waren da, Wasser auch, mehr brauchte sie nicht. Mit der Belebung ihres Geistes flammte die Erinnerung an ihr fehlendes Sozialleben wieder heftig auf. Überrascht stellte sie fest, dass sie möglicherweise ein Problem hatte. »Du lässt niemanden an dich ran«, hörte sie ihre Mutter händeringend ausrufen. Sie hatte den Vorwurf nie begriffen. Die lange Ausbildung, die ersten, harten Jahre in Wiesbaden, die geschlossene Gesellschaft in Oxford, zwei, drei lockere Affären, an ein anderes Leben hatte sie nie gedacht. Soziale Kontakte musste sie nie suchen, sie waren einfach passiert. Bisher.
»Bis jetzt hast du dich auch nie mit Schachteln unterhalten«, sagte ›BILLY‹.
Höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Wozu gab es Nachbarn? Sie duschte, zog dem schlechten Wetter zum Trotz das ärmellose Top zu den engen Jeans an und eilte die Treppe hinunter zu ihrer neuen Bekannten.
»Chris«, rief Kate erfreut. »Guten Morgen. Kommen Sie herein.«
Chris zögerte. »Ich möchte nicht stören. Ich hätte nur eine Bitte. Haben Sie eventuell zwei Eier für mich übrig?«
»Sie haben noch nicht gefrühstückt«, lachte Kate. »Kommen Sie herein, keine Widerrede. Ich habe auch Speck und Bohnen.«
Die Ausrede lag ihr auf der Zunge, aber der Gedanke an ihr Sozialleben ließ sie doch eintreten. Die verspielte Wohnungseinrichtung, die Pastellfarben und Rüschen an den Vorhängen muteten an, als wohnte hier ein romantischer Teenager. Sie schätzte Kates Alter auf etwa 35, ähnlich wie ihres. Auch die äußerliche Ähnlichkeit war erstaunlich. Selbst die Andeutung einer Stupsnase fehlte nicht. Nur im Geschmack unterschieden sie sich fundamental.
Kate stellte ein perfektes Arrangement mit Spiegelei, Speck, weißen Bohnen und gegrillter Tomate vor sie hin. Es duftete zu verführerisch, um zu protestieren. Sie ließ sie eine Weile in Ruhe essen, dann fragte sie unvermittelt:
»Sie arbeiten bei Scotland Yard?«
Chris nickte langsam. »Woher …«
»Im Haus wird getuschelt«, lachte Kate. »Es sind nicht alle so sprachlos, die hier wohnen. Mr. Henderson, der Hausmeister, zum Beispiel. Der redet gerne. Er hat die vertrauliche Information wohl von der Hausverwaltung. Aber ich hab’s nicht weitergesagt.«
Chris zuckte die Achseln. »Es ist kein Geheimnis. Von mir aus darf es jeder wissen.«
»Mein Gott, ich stelle mir das aufregend vor, wie im Fernsehen. Völlig falsch und irre, nicht wahr?«
Chris schmunzelte. »Ich schaue selten Krimis, und wenn, dann alte Filme mit rauen Sitten, wo sich der Gute nur durch den fehlenden Schlips vom Bösen unterscheidet.«
Kate nickte begeistert. »Humphrey Bogart, Michael Caine, Bob Hoskins.«
»Eher den französischen ›Film Noir‹, Delon, Belmondo, die Art. Ich war einmal richtig verknallt in Alain Delon.«
»Oh, kenne ich leider nicht. Na ja, so wie in den Filmen wird’s wohl bei Scotland Yard nicht zugehen. Trotzdem beneide ich sie ein wenig.«
»Wieso das denn?«, wunderte sich Chris. Sie liebte ihren Job, hielt sich aber für eine Ausnahme. Welcher normale Mensch mit hervorragender Ausbildung wollte sich schon freiwillig mit Gewalt, Mord und Totschlag beschäftigen, bei bescheidenem Gehalt und jeder Menge unbezahlter Überstunden. Sie musste eine psychisch gestörte Ausnahme sein, anders konnte sie sich ihr Verhalten selbst nicht erklären.
Kate hatte andere Vorstellungen: »In Ihrem Job blicken Sie hinter die Fassaden, lernen die wahre Natur und die dunklen Geheimnisse der Leute kennen. Das ist doch viel interessanter, als Termine von Patienten und Ärzten zu koordinieren. Ich bin Arztgehilfin, müssen Sie wissen.«
»Ärzte haben manchmal auch ihre dunklen Seiten«, murmelte Chris beim Gedanken an Mad Barclay.
Kate überraschte mit der prompten Antwort: »Oder Ärztinnen.«
Chris’ Telefon piepste. Mit einer Entschuldigung zog sie es aus der Tasche. Der Bildschirm zeigte den Empfang einer neuen E-Mail an. »Letzte Warnung!«, stand im Betreff.
Liebe KollegInnen,
heute Nachmittag ist es soweit. Ich werde euch für zwei Jahre verlassen. Wie schon angekündigt, sind alle, die sich über meinen Abgang freuen oder um mich weinen werden, herzlich eingeladen. Ab 14 Uhr geht’s los im Jazz Keller des Big Bang. Bier und Bangers hat’s, solang’s hat.
Euer Marcus
Sie hatte Marcus’ Ankündigung völlig verdrängt. Auf seine erste Mail vor einem Monat hatte sie mit einem zurückhaltenden »Vielleicht« geantwortet. Damals stand noch nicht fest, wann sie ihren Job in London antreten würde. Der Hauptgrund ihres Zögerns war jedoch die reichlich chaotische und am Ende recht einseitige Affäre, die sie mit dem Abenteurer gehabt hatte.
Sie stand auf, bedankte sich bei Kate und entschuldigte sich: »Ich muss leider wieder.«
»Hab ich’s nicht gesagt? «, lächelte Kate unter der Tür. »Das meinte ich mit ›interessant‹.«
Die ›IKEA‹-Schachtel stand immer noch untätig in ihrer Wohnung herum, aber sie glotzte nicht mehr gar so vorwurfsvoll, und sie schwieg. Beinahe hätte Chris zum Kreuzschraubenzieher gegriffen, den sie am Vorabend bei Wilson gekauft hatte. Den Staubsauger ließ sie ebenso in Ruhe, denn vor dem Fenster zeigte sich der erste blaue Fleck am Himmel. Das Unwetter verzog sich. Es versprach, ein ganz ordentlicher Samstag zu werden. Entschlossen tippte sie ein paar Mal auf ihren Handy-Bildschirm. Wenn sie nicht trödelte, würde sie den 12:21h Zug ab Paddington noch erreichen. Oxford, ich komme. Von wegen kein Sozialleben.
Oxford, UK
Als Chris in Oxford auf den Bahnsteig trat, beschlich sie das angenehme Gefühl, nicht nur an einem andern, ruhigeren Ort, sondern auch in einer andern Zeit angekommen zu sein. Eine Zeit, in der irgendwie alles einfacher war, spontan, unverbindlich und doch berechenbar. Sie beschloss, zu Fuß weiterzugehen, noch einmal durch ein paar Straßenzüge zu schlendern, die sie an ihr Studium am ›CRL‹, dem topmodernen Chemical Research Laboratory, erinnerten. Ihre Hand umschloss den Griff des Saxophonkoffers unwillkürlich fester, als sie in die Museum Road unweit des Labs einbog. Hier hatte sich nichts verändert. Das gelbe Haus mit der karminroten Tür am Anfang der Häuserzeile, eines der wenigen ohne Erker, sah genau so frisch gewaschen aus wie damals, als sie es mit den zwei schweren Koffern verlassen hatte. Selbst die dicht gedrängten Fahrräder am Zaun schienen sich nicht bewegt zu haben.
Sie wagte einen Blick hinauf zum niedrigen Sprossenfenster im zweiten Stock. Ihr Schlafzimmer. Nicht gerade ein Hort der Tugend damals, in ihrer Zeit mit Marcus. Der Kindskopf hätte beinahe ihren Rauswurf provoziert. Kurz und stürmisch war ihre Affäre. Die Letzte übrigens, wie sie mit einem leisen Seufzer feststellte. Mit einem Urknall hatte sie begonnen, mit einem lapidaren »Hat Spaß gemacht« in der Cafeteria geendet. Warum war sie auf den Frauenschwarm hereingefallen wie die andern Tussis? Und warum stellte sie sich jetzt diese Frage? Sie verließ die Straße der Erinnerungen eilig. Erst unter den Platanen der St. Giles Street verlangsamte sie ihre Schritte.
Bei der Abzweigung in die Little Clarendon blieb sie unschlüssig stehen. Am ›Maison Blanc‹ gegenüber war sie noch nie vorbeigegangen, ohne wenigstens ein ›Chocolate Éclair‹ zu kaufen. Die Bäckerei übte früher eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf sie aus. Die Kraft spürte sie heute nicht. Kopfschüttelnd schlenderte sie weiter. Wahrscheinlich gehörte sie nicht mehr hierher. Kapitel abgeschlossen. Sie hatte das Gefühl, heute würde nicht nur Marcus seinen Abschied feiern.
Die Jamsession im Keller des ›Big Bang‹ war in vollem Gange, als sie eintraf. Ein Volk füllte den engen Schlauch wie sonst um Mitternacht. Marcus war nirgends zu sehen, so packte sie das Instrument aus und gesellte sich zu Schlagzeug, Bass und Klarinette. Sie hörte ein paar Takte lang zu, dann fiel sie in den Chorus ein. »Baby Please Don’t Go«, wie passend, der Titel des uralten Blues-Standards. Aus Freude über die unerwartete Verstärkung verstieg sich der Holzbläser in eine abenteuerliche Improvisation. Die lebhafte Unterhaltung im Keller verstummte für einen Augenblick. Chris nutzte die Gelegenheit, um mit einem langgezogenen, jaulenden G zu ihrem Solo überzuleiten. Sie interpretierte den Part mit der gleichen flehenden Stimme, wie Muddy Waters ihn gesungen hatte. Ihre Zauberflöte wirkte Wunder. Nach wenigen Takten stand Marcus neben ihr, grinste übers ganze Gesicht und rief in die Menge:
»Ladies and Gentlemen, live from Scotland Yard: die wundervolle Chris!«
Sie spielte trotzdem weiter, entschlossen, die Gelegenheit voll auszukosten. Zu lange hatte sie nicht mehr in Formation gespielt. Der fetzige Beat verlieh ihr Flügel. Ihre Ex-Affäre musste warten.
»Super, du bist also doch gekommen«, freute sich Marcus albern nach einem herzhaften Kuss auf die Lippen, der sie wohl an alte Zeiten erinnern sollte.
»Wie du siehst, aber keine Angst: Ich bin nicht im Dienst und unbewaffnet.«
»Was heißt das schon«, seufzte er. »Deine Waffen sind die schönen Augen, das Näschen, dein spitzbübisches Lächeln. Du siehst immer noch gleich hinreißend aus.«
»Oh, du meinst, man sieht mir die zwei Jahre gar nicht an? Heißen Dank auch.«
»Du weißt, wie ich es meine …«
Eine strohblonde Schöne drängte sich dazwischen. »Willst du uns nicht vorstellen, Schatz?«
Er warf Chris einen verlegenen Blick zu. »Entschuldige, meine Freundin Lizzy, und das ist Chris. Wir haben uns am Institut kennengelernt.«
Chris wunderte sich, wie viele Lizzies er in der Zwischenzeit vernascht haben mochte. Andererseits – so genau wollte sie es auch wieder nicht wissen. Sie stellte zwei, drei harmlose Fragen, um den ungeschriebenen Gesetzen höflichen Smalltalks zu genügen, dann setzte sie sich ans Büfett ab.
»Die Oxford Bangers sind schon die Besten«, sagte eine lange nicht mehr gehörte Stimme hinter ihr.
Sie wirbelte erfreut herum. »May, wie geht es dir?«
Dr. May McGregor hatte sich verändert. Die schwarz umrandete, viel zu große Brille war verschwunden. Statt des knöchellangen, bunten Rocks trug sie einen eleganten Hosenanzug, und die Füße steckten in richtigen Schuhen, nicht den alternativen Flachtretern, die sie während ihrer Arbeit am ›CRL‹ getragen hatte. Keine Spur mehr vom früheren Landei. Diesmal waren ihre Komplimente ernst gemeint. Sie umarmten sich und zogen sich mit ihren Würsten in eine ruhigere Ecke zurück.
»Wo bist du gelandet?«, fragte Chris.
»Edinburgh.«
»Die alte Heimat.«
»Aye, aber nicht aus Heimweh«, sagte die Schottin in ihrem herben Akzent, der Chris stets an das Plätschern eines Bergbachs erinnerte. »Ich hatte die Gelegenheit, ein spannendes Projekt an der Uni zu übernehmen. Wir wollen die chemische Bodenbeschaffenheit der ganzen Insel katalogisieren.«
»Da hast du dir einiges vorgenommen.«
»Allerdings. Die Beschaffung und Analyse der Proben grenzt schon an Sisyphusarbeit, aber die echten Probleme beginnen mit dem Indizieren. Die Datenbank soll allgemein für möglichst verschiedenartige Zwecke zur Verfügung stehen. An dieser Knacknuss arbeiten wir noch.«
»Mich überrascht, dass ihr eure Geologie noch nicht vollständig erfasst habt«, meinte Chris erstaunt.
May lachte. »Natürlich ist das längst geschehen, aber unser Projekt geht viel weiter. Wir messen die chemische Zusammensetzung so genau, dass die Herkunft jeder Bodenprobe praktisch auf den Quadratkilometer genau bestimmt werden kann.«
»Alles klar. Der Traum jedes Kriminalisten.«
»Wer weiß schon, wovon ihr träumt, Detective.«
»Detective Sergeant«, grinste Chris.
Nicht jede Begegnung auf dieser Party verlief so harmonisch. Auf der Toilette stellte sie Lizzy die falsche Frage. Die Antwort interessierte sie nicht im Geringsten. Sie wollte nur höflich sein, nicht wortlos an Marcus’ letzter Eroberung vorbeigehen.
»Schon gepackt?«, fragte sie arglos.
Lizzy schaute sie entsetzt an, dann brach sie in Tränen aus und warf sich heulend an ihre Brust. Sie schluchzte hemmungslos, dass Chris nicht wusste, wohin sie blicken und was ihre Hände tun sollten. Es dauerte eine Weile, bis sie begriff: Lizzy musste zu Hause bleiben. In den Geologen-Camps am Kap Hoorn und in der Antarktis gab es weder Platz noch Arbeit für ein Model.
Ihr gesellschaftliches Soll war für heute erfüllt. Sie griff noch einmal zum Saxophon und spielte Marcus zum Abschied einen Ausschnitt aus dem ›Farewell Blues‹ in der Version von Charlie Parker. Solo, schnell. Es sollte ein fröhlicher Abschied werden, obwohl sie das Stück schon in besserer Stimmung interpretiert hatte.
Wie in einem schlechten Film zogen auch draußen wieder schwarze Wolken auf, als sie das Lokal verließ. Die ersten Tropfen fielen, kurz bevor sie den Bahnhof erreichte. Auf der Rückfahrt betrachtete sie eine Weile die flüssigen Gemälde, die der Regen auf die Fensterscheibe zeichnete. Den Rest der Strecke versuchte sie, dösend die Leere in ihrem Innern zu vergessen.
Eine leichte Berührung weckte sie. »Your phone, Madam«, sagte der sichtlich ungeduldige Herr gegenüber.
Sie murmelte eine Entschuldigung, während sie das Handy aus der Tasche klaubte. Anrufer unbekannt stand auf dem Display. Missmutig drückte sie die Empfangstaste. »Hallo?«
»DS Hegel?«
Diese Stimme kannte sie. Ihr Puls beschleunigte sich. Es kostete sie einige Anstrengung, ruhig und freundlich zu antworten: »Dr. Barclay, was kann ich für Sie tun?«
»Nichts, meine Teure, aber ich kann etwas für Sie tun. Sie müssen herkommen.«
»Was – wohin soll ich?«, stammelte sie verblüfft.
»Zu mir in die Gerichtsmedizin. Es gibt Neuigkeiten.«
»Es ist Samstag. Ich bin nicht im Dienst. Hat das nicht Zeit …«
»Nein.«
Keine Verbindung mehr. Wie lange dauerte es wohl, sich an Mad Barclays erratischen Charakter zu gewöhnen, falls man es überhaupt schaffte? Die bohrende Frage beschäftigte sie, bis der Zug in der Paddington Station hielt.
Scotland Yard, London
Der Regen erwischte Chris doch noch auf den wenigen Schritten vom Taxi zum Gebäude. Sie wischte sich die nassen Haarsträhnen aus dem Gesicht und steckte den Ausweis in den Schlitz. Der Beamte an der Sicherheitsschleuse schmunzelte beim Anblick ihres Instrumentenkoffers.
»Etwas nicht in Ordnung?«, fragte sie spitz.
Der Uniformierte schüttelte den Kopf. »Sorry, Detective Sergeant, ich fragte mich nur, ob das Orchester nun komplett sei.«
»Wieso – sind noch mehr Musiker in der Pathologie?«
»Das nicht, aber ihre Kollegen sind schon da.«
Kollegen. Plural. Der Mann konnte sich gar nicht vorstellen, wie sie diese Information erleichterte. Kein Tête-à-Tête mit der verrückten Pathologin. Der Samstagnachmittag war vielleicht doch nicht ganz verloren. Sie fand Dr. Barclay, den DCI und Ron im Labor.
»Tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte«, entschuldigte sie sich. »Ich bin erst gerade nach London zurückgekehrt.«
»Wohnt er außerhalb?«, bemerkte die Pathologin spöttisch, offensichtlich ohne eine Antwort zu erwarten. »Wo war ich stehengeblieben? Ach so, ja, die Gewebeproben.« Sie führte sie zu einem Bildschirm, der an ein Mikroskop angeschlossen war. Mit einem wohlwollenden Blick auf Chris fuhr sie fort: »Das Telefongespräch mit unserm neuen Sergeant hier hat mir keine Ruhe gelassen. Ich musste der Sache mit dem fehlenden ›Prograf‹ auf den Grund gehen. Entgegen all meinen bewährten Prinzipien habe ich also nach der Obduktion, sozusagen in meiner Freizeit …«
»Und unserer …«, brummte der DCI mürrisch, aber laut genug, dass sie es verstand.
»Du wirst es überleben, Adam. Ich habe also in meiner Freizeit nochmals Gewebeproben von der Schweineniere genommen und Chemie und Struktur des Zytoplasmas und der Nuklei analysiert.«
Der DCI schüttelte ungeduldig den Kopf. »Kannst du vielleicht so reden, dass auch ich verstehe, warum wir am Samstagabend hier sind?«
Sie bedachte ihn mit einem eisigen Blick, der jeden zum Schweigen gebracht hätte, dann sprach sie weiter, ohne seinen Einwand zu beachten: »Gefunden habe ich das hier. Ich kann Ihnen sagen: So etwas habe ich noch nie gesehen, und Sie mit Sicherheit auch nicht.«
Da mochte sie recht haben, dachte Chris. Das Bild auf dem Monitor bestand in ihren Augen aus ein paar rot und blau gefärbten Klecksen. Es glich der Fensterscheibe in ihrer Küche, als sie eingezogen war, nur die Farben stimmten nicht. Um nicht ganz dumm dazustehen, wagte sie die Vermutung: »Verschiedene Zelltypen?«
Die Ärztin strahlte. »Jeder intelligente Mensch würde das vermuten, nicht wahr?«, platzte sie heraus. »Das ist ja das Verrückte, warum ich Sie hergebeten habe. Die unterschiedlich gefärbten Zonen bestehen alle aus ein und demselben Zelltyp. Alle stammen aus dem Nephron. Das ist das Gewebe, das die eigentliche Nierenfunktion ausübt.«
Sie stand mit verschränkten Armen vor dem Bildschirm und wartete auf Kommentare. Die Männer schwiegen, also versuchte Chris es nochmals:
»Das heißt …«
»Genau«, freute sich Dr. Barclay. »Das sind zwar alles Nephronzellen, aber sie stammen nicht alle von unserm Schwein. So ist das, meine Lieben. Die blauen Zellen sind normales Nierengewebe des Tiers. Die Roten, die sich da so friedlich zu den blauen gesellt haben, das ist menschliches Nephron, und zwar von unserm jungen Mann dort drüben im Kühlschrank.«
Chris schaute sie mit großen Augen an. »Aber …«
»Genau das sagte ich auch, als ich es entdeckte. So etwas gibt es gar nicht, dachte ich.«
»Sieht aus, als hättest du dich geirrt«, spottete der DCI. »Was lernen wir nun daraus?«
»Mein lieber Chief Inspector, das ist das Wesen der Wissenschaft. Je mehr wir wissen, desto mehr Rätsel entdecken wir. Das ist aber noch nicht alles.«
Sie schob eine andere Probe auf den Objektträger, justierte das Bild, dann trat sie einen Schritt zurück und wartete auf die Reaktion ihrer ahnungslosen Zuschauer.
»Links sehen Sie menschliche Zellen aus verschiedenen Gewebeproben des Toten. Oben zum Beispiel Hautzellen. Rechts daneben habe ich Nephronzellen präpariert. Menschliche Zellen aus dem Nierengewebe, die Sie vorher als rote Flecke gesehen haben. Was man in diesem Bild sehr schön sieht, ist das Alter der Zellen. Je dunkler die Färbung, desto länger die Telomere.«
Der DCI verdrehte die Augen. Er öffnete den Mund zu einer zweifellos spitzen Bemerkung, doch Ron kam ihm zuvor: »Telomere, das sind doch die Dinger, die bei jeder Zellteilung kürzer werden?«
Dr. Barclay schenkte ihm ein gnädiges Lächeln. »Genau so ist es, junger Mann. Siehst du, Adam, nicht allen Leuten fehlt es an Allgemeinbildung. Telomere sind repetitive Proteingruppen am Ende der Chromosomen. Sie schützen das Erbgut. Bei jeder Zellteilung werden sie kürzer, und irgendwann kann sich die Zelle nicht mehr weiter teilen. Sie stirbt, und schließlich stirbt auch der Organismus.«
»Das haben wir nun alles kapiert, Frau Professor, aber was hat es mit unserm Fall zu tun?«
»Hättest du verstanden, was ich gesagt habe, wüsstest du es«, antwortete sie mit einem spöttischen Grinsen. Sie wandte sich wieder dem Monitor zu. »Wie man feststellt, sind die Gewebeproben links alle ungefähr gleich alt. Sie haben in etwa gleich viele Zellteilungen hinter sich. Das Nephron rechts aber ist viel jünger. Die Zellen entsprechen denen eines Kindes. Sie stammen vom Opfer, sind aber viel jünger.«
»Sie können nicht in seinem Körper gewachsen sein«, murmelte Chris mehr zu sich selbst.
»Jetzt ist es raus«, freute sich die Pathologin. »Es sind verjüngte Zellen des Toten, wie sie nur in einem hochspezialisierten Labor hergestellt werden konnten. Der Rest ist Spekulation. Ich vermute, dieses eingeschleuste Nephron sollte eine Art immunologische Schutzschicht bilden, eine biologische Tarnkappe, um akute Abwehrreaktionen zu vermeiden. Das könnte zumindest das fehlende ›Prograf‹ erklären.
»Vollkommen irre«, brummte der DCI.
»Danke.«
Rutherford schnaubte. »Ich meinte nicht dich. Es ist irre, was die mit diesem Jungen angestellt haben.«
»Labors, die so etwas zustande bringen, gibt es wahrscheinlich nicht viele in Großbritannien?«, fragte Chris.
Dr. Barclay schüttelte den Kopf. »Nicht viele in Europa, würde ich sagen. Ich kenne kein Einziges, um ehrlich zu sein. Diese Frage kann nur ein Spezialist beantworten.«
»Und, gibt es einen Namen?«, drängte der DCI ungeduldig.
»Mir fällt nur einer ein. Er ist eine international bekannte Kapazität in der Transplantationsmedizin und Immunologie. Professor Nathaniel Pickering in Cambridge. Ich werde ihn gleich Montag früh anrufen.«
Rutherford schüttelte den Kopf. »Das lässt du schön bleiben. Wir werden dem Professor einen Besuch abstatten. Ich muss sehen, wie er auf unsere Fragen reagiert.«
Als Ron sie vor ihrem Haus absetzte, schoss Chris der Gedanke an das vernachlässigte ›BILLY‹-Regal und den neuen Schraubenzieher durch den Kopf. Sie verwarf ihn schnell wieder. Mochte Ron noch so geschickte Hände haben, ihr Bedarf an Sozialleben war gedeckt für diesen Samstag. Für den Rest des Wochenendes, um genau zu sein.
Anne McLaren Laboratory, Cambridge
Das Navigationssystem des Dienstwagens lotste sie auf den Parkplatz bei der Einfahrt in die Forvie Site. Chris schaltete den Motor ab. DCI Rutherford auf dem Beifahrersitz machte keine Anstalten, auszusteigen.
»Sir, wir sind da«, sagte sie lächelnd. »Jedenfalls behauptet das unser GPS.«
Er stieg aus, schaute sich vergeblich nach einem Wegweiser um und brummte ärgerlich: »Können die ihre Häuser nicht vernünftig anschreiben?«
Sie fragte den Gärtner, der in der Nähe wuchernden Klee ausstach. Das West Forvie Building befand sich am südlichen Ende des Gebäudekomplexes, der sich ›Biomedizinischer Campus der Universität Cambridge‹ nannte. Das Haus beherbergte das ›Anne McLaren Laboratory for Regenerative Medicine‹, das medizinische Forschungszentrum, über das Professor Nathaniel Pickering mit eiserner Hand herrschte wie Heinrich der Achte über seine Untertanen, wenn sie Mad Barclay glauben wollten.
Der DCI zückte den Ausweis und meldete sie beim Empfangsschalter an: »Detective Chief Inspector Rutherford und Detective Sergeant Hegel von Scotland Yard. Wir müssen Professor Pickering sprechen.«
Die Angestellte hinter dem Pult starrte mit aufgerissenen Augen auf den Ausweis, dann drückte sie nervös eine Taste ihrer Telefonanlage. »Hier sind zwei Detectives von Scotland Yard für Professor Pickering«, hauchte sie mit zitternder Stimme. Nach einer Weile legte sie den Hörer ganz sachte auf die Gabel zurück, um den Professor ja nicht zu erschrecken. »Es kommt gleich jemand«, versicherte sie leise.
Der Jemand ließ sich Zeit. Noch eine Minute, bis der DCI explodieren würde, schätzte Chris, als eine Dame im mausgrauen Deuxpièces mit strengem Blick auf sie zutrat.
»Sie sind nicht angemeldet«, stellte sie zur Begrüßung fest.
»Und mit wem haben wir das Vergnügen?«, knurrte Rutherford zurück.
Die Dame ließ sich nicht so schnell einschüchtern. »Professor Pickerings Sekretärin«, entgegnete sie spitz. »Der Professor ist auf dem Weg zum Flughafen. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten …«
Chris beobachtete, wie Rutherfords Hals anschwoll und fragte schnell mit freundlichem Lächeln: »Hat der Professor das Haus schon verlassen?«
»N – nein«, stammelte die graue Maus überrascht, »aber der Wagen wird jeden Augenblick eintreffen.«
Chris lächelte noch freundlicher. »Gut, dann können wir ihm unsere Fragen stellen. Wir werden ihn nicht aufhalten. Es geht ganz schnell.«
Die Sekretärin blickte unschlüssig von einem Detective zum andern. Unvermittelt drehte sie sich auf den Absätzen um und forderte sie auf, ihr zu folgen.
Der Gesichtsausdruck des DCI sagte soviel wie: Darüber müssen wir noch reden, aber die Methode Hegel funktionierte wenigstens. Der Mann, der ihnen in seinem Büro entgegentrat, entsprach ungefähr dem genauen Gegenteil des Bildes, das sie sich von Pickering gemacht hatte. Er war auffällig klein, schon fast kleinwüchsig. Ein unscheinbares, dürres Männchen mit schütterem, grauem Haar und Spitzbart. Und er hatte entschieden bessere Manieren als sein Vorzimmer.
»Detective Chief Inspector, Detective Sergeant«, grüsste er freundlich. »Was habe ich verbrochen?«
»Das wissen wir nicht«, scherzte der DCI. »Aber Spaß beiseite. Wir möchten Ihnen nur einige fachliche Fragen stellen, deren Klärung uns bei einer Ermittlung weiterhelfen könnte.«
»Ich helfe der Polizei selbstverständlich jederzeit gerne, aber wie Ihnen Miss Jones gesagt hat, werde ich in Kürze abreisen.«
»Das ist uns bewusst, Professor. Deshalb gleich die wichtigste Frage: Sind Ihnen Fälle von Transplantationen bekannt, bei denen Patienten Schweinenieren verpflanzt wurden?«
Pickering schaute ihm unverwandt in die Augen. Außer einem leicht erstaunten Stirnrunzeln zeigte er keine Reaktion. »Xenotransplantation?«, fragte er nachdenklich. »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Gibt es solche Fälle?«
Pickering schüttelte den Kopf. »Das wäre medizinisch höchst fragwürdig. Man diskutiert die Verpflanzung tierischer Organe in Fachkreisen schon lange als eine hypothetische Methode, dem eklatanten Mangel an menschlichem Spendermaterial zu begegnen. In der Praxis wird die Xenotransplantation aber nicht durchgeführt. Zu viele Fragen sind noch offen, medizinische und ethische.«
»Wie ist die Praxis im Ausland?«
»Meines Wissens wird Xenotransplantation nirgends praktiziert.«
»Pakistan?«, fragte Chris.
Einen Moment glaubte sie, einen irritierten Ausdruck auf seinem Gesicht zu entdecken, doch dann antwortete er kühl: »Es gibt natürlich keine Garantie. Sie müssen mich jetzt leider entschuldigen, Detectives.«
Als hätte sie es gehört, öffnete Miss Jones die Tür und kündigte den Wagen an. Pickering überlegte kurz, dann sagte er zu ihr:
»Führen Sie die Detectives doch bitte zu Dr. Roberts.« Zu Rutherford gewandt, erklärte er: »Dr. Roberts wird Ihnen alle fachlichen Fragen beantworten können. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Bitte entschuldigen Sie mich.«
Damit verließ er eilig das Büro und überließ sie der Obhut seiner Sekretärin. Chris wechselte einen verwunderten Blick mit ihrem Chef. Pickerings abrupter Abgang erstaunte sie umso mehr, als seine letzte Bemerkung mehr Fragen offen ließ, als sie beantwortete. Nach einem kurzen Telefongespräch führte sie Miss Jones ohne ein weiteres Wort durch die langen Gänge an einen verlassenen Arbeitsplatz im Erdgeschoss.
»Dr. Roberts ist noch im Labor. Er wird Sie gleich begrüßen«, sagte die Sekretärin und ließ sie stehen.
»Danke, Miss …«, rief ihr der DCI nach, doch sie war schon zu weit weg, um den subtilen Sarkasmus zu bemerken.
»Nette Gesellschaft hier«, murmelte Chris.
Rutherford schnaubte verächtlich, antwortete nur mit einem Wort, das offenbar alles erklärte: »Cambridge.«
»Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Detectives«, sagte eine warme Männerstimme, die ein paar der empfindlichsten Saiten in Chris spontan zum Schwingen anregte. Die restlichen Saiten begannen vibrieren, als Dr. Roberts ihr die Hand gab. Der Mann, der lässig im offenen weißen Mantel vor ihr stand, hatte ungefähr ihr Alter. Er war ein bisschen größer als sie, sein Mund auf ihrer Augenhöhe umrahmt von Lippen, an denen sie sich jetzt schon nicht sattsehen konnte. Und er schaute sie so betroffen an, als müsste er ihr die denkbar schlechteste Diagnose stellen und wüsste beim besten Willen nicht wie. Mit weichen Knien murmelte sie eine unverständliche Begrüßung und zog ihre Hand im letzten Moment zurück, bevor ihr der Schweiß ausbrach. Befremdet stellte sie fest, wie der junge Mann den DCI mit genau dem gleichen Diagnose-Blick begrüßte.
»Bitte nehmen Sie Platz in meiner Präsidentensuite. Ich muss mich für die Unordnung entschuldigen.« Diagnose-Blick zu Chris, dann fragte er: »Was kann ich für Sie tun, Detectives?«
Welcher Teufel ritt den DCI, dass er ihr bedeutete, diesen Doktor zu befragen? Sie räusperte sich umständlich, versuchte, sich auf den Fall zu konzentrieren und klärte Dr. Roberts über den Obduktionsbefund auf, ohne unnötige Einzelheiten zu nennen.
»Eine Schweineniere«, wiederholte er ungläubig. »So etwas hat man bisher nur in der Theorie diskutiert.«
»Das meinte auch Professor Pickering. Seiner Ansicht nach wird Xenotransplantation nirgends praktiziert. Würden Sie das bestätigen?«
»Absolut. Wir beschäftigen uns zwar hier nicht selbst mit Transplantationen, dafür sind Kliniken zuständig, wie das ›Addenbrooke’s‹ nebenan. Aber als Forschungseinrichtung für regenerative Medizin stehen wir in engem Kontakt mit den Spezialisten. Nein, eine Schweineniere zu verpflanzen, würde keinem dieser Leute einfallen, da bin ich mir sicher.«
»Und doch ist es offenbar geschehen.«
»Ja, vollkommen unglaublich.« Wieder schaute er sie fast erschrocken an. »Ich kann es nicht fassen.«
Sie ertrug den Blick nicht länger, tat, als konsultierte sie ihre Notizen und fragte weiter: »Was können Sie uns über die seltsamen Zellen sagen, die unsere Pathologin entdeckt hat?«
»Die adulten Stammzellen?«
»Wenn Sie es sagen …«
»Ich müsste das Nephron natürlich selbst untersuchen, um eine fundierte Aussage machen zu können. Aus Ihrer Beschreibung schließe ich aber, dass es sich bei den menschlichen Nierenzellen um Material handelt, das man wahrscheinlich aus Stammzellen gewonnen hat. Da ich nicht annehme, dass embryonale Stammzellen des Mannes zur Verfügung standen, kann ich mir nur zwei Möglichkeiten vorstellen: Entweder hat man gesundes Nephron aus den entfernten Nieren retten können, oder man hat Stammzellen aus anderem gesundem Gewebe des Mannes gezüchtet, zum Beispiel aus Hautzellen. Solche Stammzellen kann man anschließend zu Nierenzellen umprogrammieren. Aber das sind alles Spekulationen.«
DCI Rutherford schaltete sich ein. »Sie produzieren hier solche Zellen – wie heißen die noch mal?«, fragte er misstrauisch.
»Adulte Stammzellen. Ja, das ist einer der wichtigsten Forschungszweige am Institut. Ich selbst beschäftige mich seit einem Jahr ausschließlich mit der Regenerierung von Nierengewebe.« Beim Anblick der überraschten Gesichter brach er in Gelächter aus. »Entschuldigen Sie. Bevor Sie mich jetzt verhaften, muss ich darauf hinweisen, dass sich allein in Großbritannien fast zwanzig Forschungseinrichtungen mit dem gleichen Thema befassen. Das Gebiet der regenerativen Medizin ist riesig und das Zukunftsthema der Medizin.«
Der DCI gewann seiner Bemerkung nichts Heiteres ab. Düster sagte er: »Wir brauchen die Liste aller Institute.«
Dr. Roberts setzte sich an seinen Computer. »Kein Problem«, meinte er. »Soll ich sie ausdrucken oder mailen?«
»Beides – bitte«, verlangte Chris hastig, bevor der DCI es sich anders überlegte. Sie hatte das Gefühl, Dr. Roberts Mailadresse in Zukunft noch zu benötigen. Sie gab ihm ihre Visitenkarte. »Hier steht alles drauf«, erklärte sie unnötigerweise. »Rufen Sie mich jederzeit an, wenn Ihnen etwas einfällt, was wichtig für uns sein könnte.«
»Ich nehme Sie beim Wort, Detective Sergeant«, schmunzelte er, steckte die Karte ein und gab ihr den Ausdruck.
Der DCI betrachtete die lange Liste argwöhnisch. »Sind das alle?«
»Alle in Großbritannien.«
»Und jedes dieser Institute hat die Fähigkeit, solches Nierengewebe herzustellen?«
»Theoretisch ja. In der Praxis allerdings …«
»Ja?«
Chris musste sich abwenden. Dr. Roberts leicht verlegenes Lächeln ertrug sie nicht.
»In der Praxis«, fuhr er fort, »fürchte ich, sind wir das einzige Labor, das sich auf die Erzeugung menschlichen Nephrons spezialisiert hat. Allerdings haben wir nichts mit Schweinenieren zu tun.«
»Interessant«, murmelte Rutherford mit steinerner Miene.
»Allerdings«, stimmte Dr. Roberts zu. »Je länger ich über Ihren Obduktionsbefund nachdenke, desto rätselhafter erscheint er mir.«
Chris wagte einen Blick. »Was meinen Sie damit?«
Die Verpflanzung von Zellmaterial aus iPSC …«
»Bitte?«
»Entschuldigen Sie. iPSC ist nur eine Abkürzung für die Stammzellen, über die wir vorher gesprochen haben. Der Begriff bedeutet ›induced pluripotent stem cells‹, also erwachsene, spezialisierte menschliche Zellen, die man in Stammzellen zurückverwandelt hat. Solche Stammzellen kann man anschließend zu praktisch jedem beliebigen Zelltyp umprogrammieren. Daher die Bezeichnung pluripotent. Das Hauptproblem dabei ist, dass die Herstellung der iPSC kompliziert, langwierig und sehr ineffizient ist, ebenso die Spezialisierung. Bei der heute üblichen Methode entsteht so ein Brei aus, beispielsweise, Nierenzellen und nicht umgewandelten iPSC. Diese verbleibenden Stammzellen können extrem gefährlich werden. Es besteht ein hohes Risiko, dass ein solches Gewebe karzinogen wird.«
»Sie lösen Krebs aus«, ergänzte Chris nachdenklich.
Er nickte. »Ich kann Ihnen das gerne im Labor zeigen.«
Diesmal war der DCI schneller. »Das wird nicht nötig sein, Doctor«, winkte er ab. »Wir bedanken uns erst einmal für Ihre Auskünfte und würden gerne auf Sie zurückkommen, wenn wir weitere Fragen haben. Ist das in Ordnung?«
»Selbstverständlich, wird mir ein Vergnügen sein.«
Der Diagnose-Blick! Chris erwiderte seinen Händedruck beim Abschied nur flüchtig. Schnell wandte sie sich ab und folgte dem DCI zum Ausgang.
Im Wagen beobachtete der Rutherford sie eine Weile spöttisch, dann fragte er: »Haben Sie mitbekommen, dass der gute Dr. Roberts sich gerade als einer der Hauptverdächtigen profiliert hat?«
»Nett von ihm, nicht wahr?«, lächelte sie gequält. »Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass er etwas mit unserer Schweineniere zu tun hat. Er müsste schon ein außerordentlich begabter Lügner sein. Und warum sollte er uns auf die Nase binden, dass ausgerechnet er auf dem Gebiet künstlicher Nierenzellen forscht?«
»Eben weil er ein guter Lügner ist. Und weil wir das sowieso herausfinden würden.«
»Glaube ich nicht«, entgegnete sie trotzig.
»Was glauben Sie nicht?«
»Dass er ein Lügner ist.«
Der DCI nickte schmunzelnd, enthielt sich aber eines Kommentars. Erst als sie wieder auf der M11 Richtung London fuhren, hörte sie ihn murmeln: »Rufen Sie mich jederzeit an.«
Sie stellte sich taub, versuchte nur, Dr. Roberts Gesicht zu ignorieren, das sie ständig von der Windschutzscheibe her anlächelte.
South Kensington, London
Ihre Ermittlungen steckten fest. Nirgends sah Chris die brutale Wahrheit klarer als abends unter der Dusche. Die Suche nach der mysteriösen Klinik musste auf immer größere Gebiete ausgedehnt werden. Die Wahrscheinlichkeit, sie zu finden, nahm entsprechend rapide ab. Alle Indizien deuteten darauf hin, dass das Gebäude an der Küste stehen musste, doch die Durchsuchung der siebzehn Häuser, die dafür infrage kamen, war ergebnislos verlaufen. Ein buchstäblicher Schlag ins Wasser. Also doch ein Schiff? Dann würde der Fall kaum je aufgeklärt werden. Ron kam bei seinen Ermittlungen im undurchdringlichen Dschungel der pakistanischen Parallelgesellschaft auch keinen Schritt weiter. Die Familien und Clans hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Wo sie auch ansetzten, stießen sie auf eine Mauer des Schweigens. Nicht feindselig, meist durchaus freundlich, gar beredt, wortreiches Schweigen. Niemand schien den Mann in der Gerichtsmedizin und das unbekannte erste Opfer zu vermissen. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Sie hatte ähnliche Tiefpunkte in fast jedem Fall ihrer jungen Karriere erlebt. Allmählich sollte sie sich daran gewöhnen, aber diesmal fiel es ihr besonders schwer. Sie war nicht nach England gekommen, um mit wehenden Fahnen unterzugehen. Das Schlimmste an der Situation war, dass das einzige konkrete Verdachtsmoment ausgerechnet auf den netten Dr. Roberts fiel.
»Was heißt schon nett«, spottete die Dusche.
Sie war nicht in der Stimmung, sich auf diese Diskussion einzulassen. Noch einmal und noch intensiver spülte sie sich das Haar, dann drehte sie der vorlauten Dusche den Hahn zu. Sie richtete den warmen Strahl des Föhns zuerst aufs Gesicht, um die düsteren Gedanken aus ihrem Hirn zu blasen, dann begann sie seufzend mit dem umständlichen Trocknen ihrer langen Haare.
Ein neuer Ton überlagerte plötzlich das ermüdende Rauschen. Der Bildschirm des Telefons auf dem Fenstersims leuchtete. Die Nummer kannte sie nicht. Sie legte den Fön beiseite und drückte auf die Empfangstaste.
»Detective Sergeant Hegel?«, fragte eine warme Stimme, die ihr sogleich die Schamröte ins Gesicht trieb, denn sie stand nackt wie die Venus vor dem Spiegel und sprach mit Dr. Roberts.
»Ja?«, antwortete sie vorsichtig.
»Jamie Roberts hier. Sie haben mich in Cambridge befragt.«
»Ah, ja, ich erinnere mich.« Sie schnitt ihrem Spiegelbild eine Grimasse ob der albernen Bemerkung. Seit dem Besuch in Cambridge waren noch keine sechsunddreißig Stunden vergangen.
»Sie sagten, ich könne Sie jederzeit anrufen …«
»Ja – auch daran erinnere ich mich.«
»Mir ist noch etwas eingefallen, das Sie wissen müssten.«
»Ausgezeichnet, ich höre.«
»Nicht am Telefon. Ich bin zufällig in London.«
Beinahe ließ sie ihr Handy fallen. Es fühlte sich plötzlich heiß an. »In London?«, wiederholte sie erschrocken.
Er lachte. »Hin und wieder kommt es vor, dass mich meine Arbeit in die große Stadt führt.«
»Natürlich. Wenn das so ist, können wir uns in meinem Büro treffen. Sagen wir, um …«
»Ich dachte eigentlich eher an einen gemütlicheren Ort«, unterbrach er. »Haben Sie schon gegessen?«
Sie konnte sich an eine Schüssel Cornflakes zum Frühstück erinnern. Mit einem Mal spürte sie einen unbändigen Appetit und gleichzeitig einen Knoten im Magen. Sie wusste, wo das Gespräch hinführte, und der Gedanke gefiel ihr viel zu gut. Trotzdem antwortete sie mit einem ehrlichen Nein.
»Wunderbar, dann lade ich Sie zum Essen ein.«
»Das werden Sie schön bleiben lassen, oder wollen Sie mich bestechen?«
»Um Gottes willen, niemals. Ich finde nur, es wäre ganz angenehm, wenn wir beide unser Problem gemeinsam lösen würden. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch mich einladen.«
Sie glaubte, sein betroffenes Schmunzeln in ihrem Spiegel zu sehen und wandte sich ab. »Soweit kommt’s noch.«
»Also, Detective Sergeant, was halten Sie davon, wenn wir uns bei sauber getrennter Kasse bei einem neutralen Italiener treffen?«
»Ich hatte eigentlich nicht vor, auszugehen.«
»Ich fahre Sie.«
»Sie geben nicht so schnell auf, wie?«
»Sind Sie denn gar nicht an meinen Informationen interessiert?«
»Doch, ich könnte Sie vorladen.«
»Das wäre schön«, lachte er, »dann müssten Sie mich treffen.«
Allmählich begriff sie, worum es hier ging. Dr. Diagnose-Blick mit der warmen Stimme wollte sie unbedingt sehen. Gut möglich, dass sie sich das nur einbildete. Solche Wunschvorstellungen waren ihr nicht neu. Vielleicht hatte er auch einfach Hunger und wollte seine Information loswerden. Die Antwort auf diese Frage war durchaus bedeutsam für ihr Verhalten, hielt sie sich doch bisher an die eiserne Regel, Berufliches von Privatem zu trennen. Auch wenn es da nicht viel zu trennen gab.
»Sind Sie noch dran?«, fragte er besorgt.
»Wie – ja – kennen Sie ›Orsini’s‹?«
Herausgerutscht, einfach so. Klar und deutlich hatte sie das Restaurant in ihrer Nähe vorgeschlagen. Entscheid des Unterbewusstseins. Wie sollte sie sich dagegen wehren?
»›Orsini‹, South Kensington? Klar, kenne ich. Wann?«
»Um acht«, antwortete sie mechanisch.
Die Uhr bestätigte ihr: Sie hatte genau 56 Minuten. Zuwenig, um ein privates Treffen vorzubereiten, also würde es eine rein dienstliche Besprechung werden beim gemütlichen Italiener. In aller Eile flocht sie ihre blonden Strähnen zu einem dicken Zopf, zog frische Arbeitskleidung an, Jeans, weißes Shirt. Viel anderes gab ihr Kleiderschrank auch nicht her. Bevor sie die Lederjacke anzog, warf sie einen letzten Blick in den Spiegel. So lupenrein dienstlich war das Treffen doch nicht, meinte ihr blasses Spiegelbild. Etwas Rouge und Wimperntusche würde ihr Gesicht schon vertragen, ohne wichtige Regeln zu brechen. Sorgfältig zog sie die Lippen nach, rieb sie, beugte sich ganz nah an den Spiegel, schüttelte unzufrieden den Kopf, tupfte etwas Rot weg, strich nochmals mit dem Stift über die Lippen, kontrollierte, tupfte, strich, bis sie halbwegs zufrieden war mit ihrem dienstlichen Äußeren.
Sie traf wie geplant zehn Minuten zu spät ein. Dr. Roberts wartete an der Bar auf sie.
»Drink?«, fragte er mit einem besorgten Blick, als fürchtete er, sie würde gleich wieder verschwinden.
Sie schüttelte den Kopf. Ihr Magen knurrte, und sie wollte die dienstliche Besprechung nicht mit gefährlichem Smalltalk an der Bar beginnen. Der Kellner schien sich an sie zu erinnern. Seinem Gesicht nach zu schließen, freute er sich außerordentlich, dass sie diesmal nicht allein zum Dinner erschien. Sie dankte ihm für die Speisekarte, hinter der sie sich unauffällig verstecken konnte.
»Sie haben ja wirklich Hunger«, meinte er schmunzelnd.
»Sie nicht?«
»Doch, natürlich.«
Wieder der besorgte Blick. Sie entschied sich für die große Variante: Salat, Linguine und die würzigen Scaloppine al Marsala mit grünen Bohnen, die sie schon kannte. Drei Gänge, genug mechanische Arbeit, um sich auf den Fall zu konzentrieren und weniger auf ihr Gegenüber. Den Wein schlug sie aus.
»Sie sind immer im Dienst«, bemerkte er bedauernd und bestellte sich ein Glas Brunello, wie sie es, weiß Gott, auch benötigt hätte.
»Was führt Sie denn so häufig nach London?«, fragte sie zwischen zwei Bissen Brot. »Wohnt Ihre Freundin hier?«
Sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen. Zum ersten Mal verschwanden die Sorgenfalten von seiner Stirn. »Meine Freundin«, sagte er gedehnt. »Ja – die hat einmal hier gewohnt. Dann ist sie eines Tages abgereist. Ist schon eine Weile her.«
»Sie Ärmster.«
»Ich hab’s überlebt, wie Sie sehen. Jetzt kennen Sie meine persönlichen Verhältnisse.« Das Sorgenfältchen erschien wieder. »Um auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen: Ich bin praktisch jede Woche einmal in der City. Wir pflegen einen regen Informationsaustausch mit unsern Kollegen am Imperial College. Zufrieden, Detective Sergeant?«
Sie überhörte die Spitze. »Stand auch auf Ihrer Liste«, murmelte sie nur. Sie schenkte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Salat. Er wartete, bis sie die Gabel weglegte, dann wollte er wissen, wie sie mit den Ermittlungen vorankam.
»Dazu darf ich nichts sagen, das wissen Sie. Aber wollten nicht Sie mir etwas erzählen?«
Er nickte bedächtig. »Ja, schon. Ist wahrscheinlich gar nicht wichtig.«
»Nicht wichtig?«, rief sie überrascht aus. »Und dafür opfere ich meinen Feierabend?«
»Ist doch gut hier.«
»Sie haben Nerven.«
Er reagierte bestürzt: »Jetzt sind Sie sauer.«
Die Pasta ersparte ihr die Antwort. So sehr sie auch kaute, der Gedanke ließ sich nicht vertreiben, dass sie einem Verdächtigen gegenübersaß. Zu allem Überfluss schien er sich in ihrer Gegenwart wohlzufühlen. Noch schlimmer: Ihr erging es ebenso. Warum konnte Dr. Roberts nicht einer der arroganten Sorte sein, die versuchten, die Polizei mit lateinischen Fachwörtern in die Flucht zu schlagen? Mit solchen Typen wusste sie umzugehen. Warum war ausgerechnet ihr Verdächtiger ein liebenswerter Kerl, den sie am liebsten ans Herz drücken würde wie ihren Teddy, so besorgt, wie er sie dauernd anblickte?
Der Teller war leer. Sie nippte an ihrem Wasserglas, dann forderte sie ihn auf: »Nun schießen Sie mal los.«
Seine Sorgenfalte verschwand für einen Augenblick. Sie spricht wieder mit mir, schien er zu denken. Er trank den Rest des Rotweins aus, tupfte sich die Lippen trocken, dann sagte er kleinlaut: »Professor Pickering führt eine Privatklinik. Fast ausschließlich Nierentransplantationen.«
Sie starrte ihn an, als hätte er sie ins Gesicht geschlagen. »Und das erfahre ich erst jetzt?«, schnaubte sie erregt.
»Es – tut mir leid, wirklich. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Erst später ist mir eingefallen, dass es vielleicht wichtig sein könnte für Ihren Fall, obwohl ich mir das, ehrlich gesagt, nicht vorstellen kann.«
»Das zu entscheiden, überlassen Sie besser uns.«
Kopfschüttelnd fragte sie sich, wie sie so etwas bei der Vorbereitung des Besuchs in Cambridge übersehen konnte. Er beantwortete die Frage gleich selbst:
»Die Klinik heißt ›Winchmore Manor‹. Sie liegt im Westen von Cambridge und läuft auf den Mädchennamen seiner Frau, Lady Warton.«
»Deshalb ist sie uns nicht aufgefallen«, murmelte sie. »Ausschließlich Nierentransplantationen? Lohnt sich das?«
»Oh ja. ›Winchmore Manor‹ ist eine sündhaft teure Privatklinik, und der Name des Professors steht für medizinische Spitzenqualität. Ich selbst habe nichts mit der Klinik zu tun, aber ich weiß, dass dort nur Top-Leute operieren. Die Erfolgsquote liegt denn auch deutlich über dem Durchschnitt.«
»Wer kann sich diese teure Medizin leisten?«
»Vor allem Ausländer. Die Patienten kommen vorwiegend aus Israel und der Golfregion.« Er zögerte, bevor er lächelnd beifügte: »Kaum aus Pakistan.«
Sie stutzte. Hatte sie ihm erzählt, dass der Tote Pakistani war? Sie hatte. Die nächste Frage musste sie stellen, obwohl seine Antwort nur »Nein« lauten konnte. Der Gesichtsausdruck würde ihn verraten, falls er versuchte zu lügen. »Halten Sie es für möglich, dass in ›Winchmore Manor‹ eine Schweineniere verpflanzt wurde?«
»Ausgeschlossen.«
Kein Zögern, kein Wimperzucken, keine Spur von Stress in Gesicht und Stimme. Wenn sie nicht alles täuschte, sagte er die Wahrheit.
»Darum erscheint mir die Klinik ja auch nicht wichtig«, fuhr er fort. »Das Transplantationswesen ist streng reglementiert. Das ›NHSBT‹, das Direktorat des National Health Service für Organ- und Bluttransplantationen, kontrolliert und koordiniert Spender und Empfänger. Da bleibt kein Spielraum für solche Experimente. Trotzdem würde mich Ihre Gewebeprobe interessieren.«
»Sie haben selbst nichts mit der Klinik zu tun, sagten Sie?«
»Richtig. Der einzige Kontakt besteht in periodischen Informationsveranstaltungen, an denen wir unsere Forschungsergebnisse präsentieren.«
Nach dieser Bestätigung kehrte ihr Appetit zurück. Während sie die nur noch lauwarmen Schnitzel aß, überlegte sie, was die neue Information bedeutete. Vielleicht gar nichts. Ein weiteres Teil des Puzzles, von dem sie noch nicht einmal wusste, ob es sich am Ende zu einem Bild fügen würde.
»Enttäuscht?«, fragte er, nachdem der Kellner das Geschirr abgeräumt hatte.
Schau nicht so gequält, flehte sie im Stillen. Laut meinte sie: »Keineswegs. Es ist gut, dass Sie uns informiert haben.«
Das dienstliche Uns. Um die Härte der kühlen Formulierung etwas abzufedern, schenkte sie ihm ein warmes Lächeln. Das musste genügen als Nachtisch für ein dienstliches Dinner.