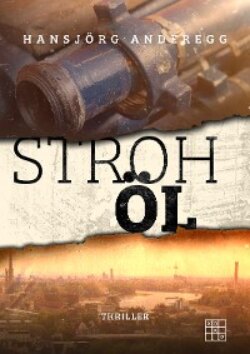Читать книгу Strohöl - Hansjörg Anderegg - Страница 6
ОглавлениеKAPITEL 2
KONSTANZ
Der süße Duft frischgebackenen Brotes stieg Chris in die Nase. Sie lag schon eine Weile wach im Zimmer über der Bäckerei, obwohl sie erst gegen zwei Uhr morgens ins Bett gekrochen war. Die Altstadt erwachte früh. Sie hörte durchs halb offene Fenster Passanten miteinander schwatzen und lachen, als freuten sie sich, zu dieser gottlos frühen Stunde unterwegs zu sein. Bevor sie ins Bad ging, schaltete sie den Laptop ein. Die Verbindung mit Berlin klappte auf Anhieb. Wenigstens ein Lichtblick an diesem Morgen. Die Dusche spülte den Schlaf in den Ausguss mit der Folge, dass sie im Wachzustand jeden einzelnen Knochen zu spüren glaubte. Sie hatte die lange Fahrt an den Bodensee unterschätzt. Vielleicht war es auch nur das Alter. Die Vierzig stand schon auf der Anzeigetafel, ganz unten zwar, aber immerhin: vierzig, Halt auf Verlangen. Vielleicht rebellierte ihr Körper gegen die hellwachen Leute auf der Gasse, das geschäftige Treiben im Laden unter ihrem Fenster oder den Lärm der Möwen. An diesem Morgen ging ihr so ziemlich alles auf den Geist – keine ideale Voraussetzung für die erste Begegnung mit der Konstanzer Kripo. Die Kollegen auf dem Polizei-präsidium taten ihr jetzt schon leid.
Sie klappte den Instrumentenkoffer auf, betrachtete ihr Altsaxofon unschlüssig und schloss den Koffer wieder. Ein paar Blues Riffs wirkten oft Wunder – nicht an diesem Morgen. Zu unmotiviert, ihr langes, strohblondes Haar zum Zopf zu flechten, band sie es rasch zum Pferdeschwanz zusammen. So sah es eher nach Tatendrang aus.
Der Computer kündigte neue Mail an. Die Betreffzeile entlockte ihr das erste Schmunzeln an diesem traurigen Tag. Munition hatte Jens Haase seine Mail betitelt, die ausgedruckt einen ansehnlichen Ordner gefüllt hätte. Haase vereinigte drei Eigenschaften, die ihn als Kollegen unentbehrlich machten. Er verbrachte gefühlte vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Büro, erledigte seine Recherchen ebenso schnell wie gründlich, und er braute den besten Kaffee, den sie je gekostet hatte.
Die Munition für den Einsatz in Konstanz umfasste nicht nur die Berichte des Kommissars Rappold, der die Ermittlungen vor Ort leitete. Haase hatte zudem eine intelligente Auswahl an Fachartikeln zur Fracking Technologie beigefügt und nicht vergessen, die häufigsten Argumente für und wider diese Fördermethode auf einem Blatt zusammenzufassen. Die Information stellte ein hilfreiches Repetitorium für sie dar. Die Zeit des Studiums lag doch schon einige Jahre zurück. Das Material über den NAPHTAG Konzern barg echten Sprengstoff. Sie fragte sich, wie Haase so schnell an die sensitive Information gelangt war, zweifelte aber keinen Augenblick am Wahrheitsgehalt. Nach diesen Unterlagen fanden die Testbohrungen bei Überlingen am falschen Ort statt. Das Fracking Projekt mit dem Namen Kranich – welch absurder Euphemismus, intakte Natur vorgaukelnd – war ursprünglich auf dem Gelände eines Klosterguts geplant gewesen. Da der Konzern sich nicht mit den Verantwortlichen des Klosters Mariafeld einigen konnte, hatte man die Versuchsanlage kurzerhand im hügeligen Gelände eines Nachbargrundstücks aufgebaut. Der Zugang zu den Schiefergas-Schichten gestaltete sich dadurch wesentlich komplizierter und erforderte längere, heikle Horizontalbohrungen. Diese Tatsache mochte für den Fall irrelevant sein, doch ihr Bauchgefühl sagte etwas anderes. Der Gedanke war jedenfalls notiert.
Die Hintergrundinformationen über die Gruppe Gaia beschränkten sich auf Gerüchte. Haase hatte dennoch mehr über die Umweltaktivisten zusammengetragen als die Kollegen in Konstanz. Es gab Hinweise, dass sich die Gruppe aus Studenten und Ehemaligen der Uni zusammensetzte. Der Hauptverdächtige hieß Thorsten Kramer. Ihm gehörte das sichergestellte Auto. Sein Name tauchte indessen in keinem Polizeibericht auf. Eine gute Frage als Einstieg, dachte sie, klappte den Laptop zu, schob ihn in die Tasche und verließ das Hotel.
Die Sekretärin im Präsidium führte sie an einen leeren Schreibtisch.
»Sind Sie sicher, dass Kommissar Rappold noch hier arbeitet?«, fragte sie.
Der junge Mann in der dunklen Ecke des Büros kugelte sich vor Lachen.
»Das ist sein Arbeitsplatz«, antwortete die Sekretärin schnippisch.
»Sieht nicht nach Arbeit aus. Wo steckt er?«
Der junge Mann fand auch das enorm lustig. Er stellte sich als Kommissaranwärter Hinz »wie Kunz« vor und beantwortete ihre Frage:
»Rappold ist beim Zahnarzt – Notfall.«
»Mein Beileid. Und Sie sind sein Stellvertreter?«
Der dritte Lacher erstarb abrupt, als sie ihm den Dienstausweis zeigte. Er mutierte binnen Sekunden vom Scherzkeks zum dienstbeflissenen Assistenten.
»Ich rufe ihn auf dem Handy an«, sagte er, das Telefon am Ohr. Nach einer Weile gab er auf. »Anrufbeantworter.«
Sie steuerte auf einen zweiten verlassenen Schreibtisch zu.
»Arbeitet hier auch ein unsichtbarer Kollege?«
Hinz drohte rückfällig zu werden.
»Nein – den – der ist frei«, stammelte er. »Wir sind etwas unterdotiert, was das Personal betrifft, dafür gibt‘s jede Menge freie Schreibtische.«
Der junge Mann besaß auch Humor. Das war ihr ein freundliches Lächeln wert.
»Kommissar Rappold sollte eigentlich schon zurück sein«, sagte er. »Ich kann Ihnen inzwischen die Akte zum Fall Überlingen heraussuchen.«
Er blickte sie erwartungsvoll an oder eher ihren Hintern in den engen Jeans, wie sie aus den Augenwinkeln feststellte.
»Wenn Sie mir dann die Akte geben könnten, sobald sie sich sattgesehen haben …«
Im nächsten Augenblick lag die Mappe auf ihrem Tisch. Zu verlegen für eine Antwort, eilte Hinz hinaus. Nach wenigen Minuten kehrte er mit einem älteren Herrn im Schlepptau zurück, der eindeutig zu viel Kohlenhydrate konsumierte. Seinen Schmerbauch zu bewegen, erforderte sichtbaren Kraftaufwand. Er ließ sich schwer atmend in den Sessel am leeren Schreibtisch fallen. Umständlich betastete er den Kiefer und brummte dabei Unverständliches. Verwünschungen, die sich gegen den Zahnarzt oder Zahnärzte im Allgemeinen richteten, nahm sie an. Er schien sie erst zu bemerken, als sie auf ihn zutrat.
»Sie müssen Kommissar Rappold sein«, sagte sie und stellte sich vor.
»So – muss ich?«
Noch ein Scherzkeks.
»Meinetwegen können Sie den Osterhasen spielen, aber wir müssen uns über den Fall Überlingen unterhalten. Und fragen Sie jetzt nicht: So – müssen wir?«
Ihr Ärger prallte an ihm ab, als säße er in einer Blase ohne Verbindung zur Außenwelt.
»Wir müssen nämlich«, fuhr sie fort, »ob es Ihnen passt oder nicht. Also lassen wir die Spielchen und kümmern uns um den Fall, einverstanden?«
Er bewegte sich, setzte sich aufrecht und öffnete die oberste Schublade des Schreibtisches. Sehnte er sich heimlich nach einer Domina? Ihr fehlte im Grunde nur die neunschwänzige Katze.
»Sie haben den Bericht sicher schon gelesen«, sagte er, wobei er sich demonstrativ den Kiefer rieb.
»Tut‘s weh?«, fragte sie lächelnd.
Der Kommissaranwärter in der dunklen Ecke musste sich abwenden.
»Ich bin im Bilde über den Stand der Ermittlungen. Allerdings vermisse ich die Vernehmungsprotokolle der beiden Verletzten.«
»Einer liegt noch im Koma. Der Zweite kann erst seit gestern Abend vernommen werden.«
»Und – was sagt er?«
»Gar nichts. Die Vernehmung ist für heute geplant.«
Sie traute ihren Ohren nicht.
»Ach, Sie planen die Vernehmungen langfristig«, brauste sie auf. »Warum nicht erst am nächsten Freitag?« Kopfschüttelnd fügte sie hinzu: »Mensch, Rappold! Der Verletzte ist der vorläufig einzige Zeuge in einem Sprengstoffanschlag! Der Hauptverdächtige läuft da draußen frei herum. Wer weiß, wie viel von dem Zeug der noch in seiner Garage hat. Wir müssen den Mann sofort befragen. Auf geht‘s!«
Der Tonfall der Domina setzte ihn tatsächlich in Bewegung. Die Rolle begann ihr zu gefallen. Müsste ich mal bei Jamie versuchen, dachte sie, während sie sich in Rappolds Dienstwagen zwängte.
Die Befragung des Verletzten lieferte keine neuen Erkenntnisse. Er gab an, im Magazin »Zusatz« für die Druckleitung geholt zu haben, als es krachte. Er verlor das Bewusstsein und wachte erst im Krankenhaus wieder auf. Er erinnerte sich zwar, vor der Explosion Geräusche vernommen zu haben, als befände sich noch jemand in der Halle, hatte aber niemanden gesehen.
»Wir müssen alle Mitarbeiter und Zulieferer des Projekts Kranich befragen«, sagte sie, als sie wieder im Auto saßen.
»Kranich?«
»So nennt die NAPHTAG ihr Fracking Projekt in Überlingen. Wussten Sie das nicht?«
Er wusste es nicht, ebenso wenig kannte er die mögliche Verbindung der Gruppe Gaia zum Campus der Uni Konstanz.
»Mensch, Rappold! Es wird Zeit, dass wir uns ernsthaft unterhalten.«
Die Domina hatte gesprochen. Der Sklave fuhr schweigend weiter.
Ein Tag mit Rappold genügte für ein halbes Leben. Chris fehlte die Kraft, noch am selben Tag an den Tatort in Überlingen zu fahren. Stattdessen verließ sie das Präsidium fluchtartig nach dem langen Gespräch mit dem Kommissar kurz vor dem Ruhestand, der seinen Arbeitsplatz schon einmal vorsorglich geräumt hatte. Sie schlenderte eine Weile ziellos durch die Gassen der Altstadt. Jetzt saß sie in einem Café am Hafen. Lustlos stocherte sie in ihrem Salat. Immer wieder blickte sie auf die Uhr. Es war zu früh, um Jamie anzurufen.
»Alles in Ordnung?«, fragte die Bedienung.
Sie nickte stumm und zwang sich, das Grünzeug in sich hineinzustopfen. Sie musste den Magen irgendwie beruhigen. Er war schon dabei, sich um sich selbst zu wickeln. Sie dachte ernsthaft darüber nach, die Maschinerie in Bewegung zu setzen, um dem offensichtlich überforderten Rappold den Fall zu entziehen und allein weiter zu ermitteln. Unschlüssig wog sie die Vor- und Nachteile ab, bis sie wütend beschloss, den Kommissar im Vorruhestand aus ihren Gedanken zu verbannen. Sie verließ das Lokal und rief Jamie an, während sie an der Mole entlang schlenderte. Es war noch zu früh. Sie würde ihn in der Vorlesung stören, aber sie konnte nicht länger warten. Zu ihrer Überraschung hob er sofort ab.
»Langweilst du dich?«, fragte er lachend.
»Ich wollte testen, ob du an der Arbeit bist, und prompt habe ich dich erwischt. Ich warte gespannt auf deine Erklärung.«
Eine kurze Pause entstand. Zu ihren Füßen klatschte der Kot einer Möwe auf die Plastikplane eines Bootes, dass sie unwillkürlich mit einem Kraftausdruck zurückwich.
»Also hör mal!«, rief er erschrocken.
Sie stellte sich sein verdutztes Gesicht vor, und der Tag im Präsidium war schon fast vergessen.
»Eine Möwe hat mich erschreckt«, beruhigte sie.
»Hat sie getroffen? Bist du verletzt?«
»Jetzt mach aber einen Punkt.«
Das Geplänkel ging weiter. Mit jeder Minute fühlte sie sich besser. Sie hätten übers Wetter oder Nordkorea reden können. Der Inhalt zählte nicht, nur seine warme Stimme.
»Du bist also tatsächlich an den Bodensee gereist«, sagte er unvermittelt.
»Wegen der Möwe meinst du? Die gibt‘s auch woanders, aber es stimmt. Ich bin in Konstanz, ein Einsatz am Bodensee.«
»Schade, wirklich schade«, seufzte er. »Ich hatte gehofft, du könntest nach dem letzten Fall für ein paar Tage rüber kommen.«
»Nach London?«
»Ja, wenigstens für ein verlängertes Wochenende. Ich bin einigermaßen flexibel.«
»Hab ich‘s doch gewusst! Dein Seminar ist nur Show. Du wolltest in die alte Heimat zurück. Das ist es doch. Gib’s zu.«
Er lachte schallend, ein wenig zu heftig, fand sie.
»Leider kann ich hier nicht weg. Die Kollegen brauchen jede Unterstützung.«
Da war es wieder, das Gespenst mit dem Schmerbauch. Um es endgültig zu vertreiben, holte sie nach dem Anruf das Saxofon aus dem Hotel und setzte sich im Stadtgarten ans Ufer. Eine angenehm laue Brise wehte vom See her. Sie saß lange unbeweglich an der Böschung und ließ ihre Gedanken übers Wasser schweifen, bevor sie den Instrumentenkoffer öffnete. Erstaunlich wenige Spaziergänger waren unterwegs. Nur eine Gruppe junger Leute unterhielt sich lautstark im Rasen zwischen den alten Bäumen. Ab und zu wehte ein Lacher zu ihr herüber. Behutsam nahm sie das Instrument aus dem Koffer. Das goldene ›Senso‹ von Buffet Crampon stellte so ziemlich den einzigen echten Luxus dar, den sie sich bisher geleistet hatte. Sie liebte die samtig weichen Tiefen des Altsaxofons. Jedes Mal, wenn sie zu spielen begann, hörte ihr verstorbener Vater lächelnd zu. Er hatte ihr in seinem Musikladen die ersten Töne auf der Blockflöte beigebracht. Sie begann, in tiefen Lagen zu improvisieren, leise, als spielte sie nur für sich und ihren Vater. Allmählich befreite sich die Musik wie von selbst. Sie verband die liebsten Motive ihres Meisters Charlie Parker im Blues-Schema zu einer nicht enden wollenden Kette von Kadenzen und Akkorden. Es war, als wehte die Brise durch ihren Kopf, trüge den Müll mit sich fort und füllte die grauen Zellen mit reiner Freude. Ins Spiel vertieft, bemerkte sie nicht, wie die jungen Leute sich näherten. Sie lauschten im Halbkreis hinter ihrem Rücken der Darbietung, als hätten sie teuer dafür bezahlt. Der Applaus erschreckte sie, als sie das Instrument absetzte.
»He – fantastisch – wer bist du, woher kommst du, was war das?«
Lächelnd ließ sie die Fragen an sich abperlen. Nur eine beantwortete sie gerne:
»Charlie Parker. Das waren Motive von Charlie Parker. Der war noch etwas besser auf dem Altsaxophon.«
»Wer ist Charlie Parker?«
Die jungen Leute gehörten zu einer anderen Generation. Sie kannten wohl die Namen aller angesagten DJs. Jazzgrößen wie ›the bird‹ waren etwas für Ewiggestrige, interessant nur, dass ihre Musik immer noch faszinierte.
»Du musst unbedingt am Freitag in der ›Blechnerei‹ spielen«, rief einer und drückte ihr einen Flyer in die Hand.
Open Stage!, stand darauf, quer über die Seite gedruckt, mit Ausrufezeichen. Sie bekam endlich Gelegenheit, ihre Frage zu stellen:
»Wer seid ihr?«
Die Jungs erinnerten sich blitzschnell an ihre Vornamen. Die Mädchen hielten sich zurück. Sie schüttelte lachend den Kopf.
»Ich meinte eigentlich: Was tut ihr hier in Konstanz?«
Es waren Studenten von der Uni, wie sie gehofft hatte. Sie merkte sich die Gesichter. Uni – Gaia – interessant. Ein unauffälliger Zugang zum Campus könnte sich eines Tages als nützlich erweisen.
»Also bis Freitag«, sagte der Blasse mit den roten Wangen, der ihr das Flugblatt in die Hand gedrückt hatte.
»Mal sehen.«
Nachdem sich die Gruppe Richtung Altstadt entfernt hatte, schickte ihr Saxofon ein paar letzte Seufzer über den jetzt fast schwarzen See. Kurz bevor sie das Instrument absetzte, klingelte es in ihrem Koffer. Zwei Fünfzig-Cent-Münzen und drei Fünfer lagen auf dem Staubtuch, das ihre Glock abdeckte. Sie rief dem einsamen Spaziergänger ein Danke nach und packte zusammen. Der Tag endete besser, als er begonnen hatte. Immerhin war sie um 1.15 Euro reicher. Das Geschenk erinnerte sie an den Vorsatz, Jamie eine Kleinigkeit mitzubringen nach ihrem Einsatz – bloß was? Das Problem würde sie noch lange beschäftigen, fürchtete sie.
Sie hatte den Eindruck, Rappold ducke sich vor ihr, als sie am Morgen fast gleichzeitig das Präsidium betraten. Im schwarzen Gilet über der ärmellosen Bluse, Pistole gut sichtbar im Schulterhalfter, erinnerte sie ihn vielleicht noch stärker an eine zu allem entschlossene Domina. Kaum stand sie im Büro, kam Hinz aus der dunklen Ecke geschossen und haspelte den Stand der Ermittlungen herunter. Er war schnell fertig.
»Thorsten Kramer hat niemand mehr an seiner Meldeadresse in Litzelstetten gesehen seit einem halben Jahr«, berichtete er. »Das bestätigen alle Nachbarn, sagen die Kollegen.«
»Was sagt die KTU über den Sprengstoff?«
»Die Analyse ist noch im Gang.«
Mehr gab es nicht zu berichten an diesem Morgen. Rappold hatte endlich die bequemste Stellung auf dem Sessel gefunden und war dabei, seinen Kaffee aus dem Pappbecher zu kosten, als sie ihn mit der Bemerkung schockierte:
»Wir fahren zum Tatort.«
Um ein Haar entglitt ihm der Becher. »Was – wieso das denn? Steht doch alles im Bericht.«
»Im Bericht steht, dass Sie gerade mal den leitenden Ingenieur und die Arbeiter der Nachtschicht vernommen haben.«
»Das waren die einzigen potentiellen Zeugen.«
Sie schüttelte den Kopf, beugte sich zu ihm hinunter und zeigte ihm den Drohfinger. Sofort brachte er seinen Kaffee in Sicherheit.
»Mein lieber Kommissar Rappold. Mir scheint, Sie ermitteln allzu offensichtlich nur in eine Richtung. Wie ich gestern schon erwähnt habe, müssen alle Leute befragt werden, die irgendwie mit dem Versuchsgelände in Kontakt gekommen sind. Insbesondere sollten wir uns um entlassene oder anderweitig frustrierte Mitarbeiter kümmern. Wer sagt uns denn, dass der Anschlag kein Insider Job gewesen ist? Bis wir die Phantome der Gruppe Gaia vernehmen können, müssen wir in alle Richtungen ermitteln, einverstanden?«
Ohne die Antwort abzuwarten, ging sie zur Tür.
»Auf geht‘s!«
Er betrachtete unschlüssig den Becher mit der siedend heißen Brühe.
»Lassen Sie den Kaffee stehen, Kollege. Sie werden ihn nicht vermissen. Zu viel Säure ist nicht gut für den übersäuerten Magen.«
Hinz versteckte sich wieder in der dunklen Ecke, wo seine Gesichtszüge weniger deutlich zu erkennen waren.
»Hinz, Alibis!«, brüllte Rappold ihn an.
»Ich fahre mit meinem Wagen«, sagte sie.
ÜBERLINGEN
Ingenieur Niklas Kolbe empfing sie im Bürocontainer. Er wischte sich mit einem öligen Putzlappen Striemen ins Gesicht und rieb die Hände am schmutzigen Tuch, bevor er sie begrüßte. Sollte heißen: Hier wird hart gearbeitet, keine Zeit für Fragen. Sie überließ Rappold die Einleitung.
»Wieso zum Teufel wollen Sie die Leute zum zweiten Mal befragen?«, fuhr ihn Kolbe an. »Sie halten uns von der Arbeit ab. Bei uns kostet jede Minute bares Geld, Mann!«
Sollte wiederum heißen: Bei uns wird gearbeitet, nicht wie bei der Polizei. Rappold hatte den Ingenieur wohl bisher mit Samthandschuhen angefasst. Kolbe schien jedenfalls keine besonders hohe Meinung vom Kommissar aus Konstanz zu haben, was sie durchaus nachvollziehen konnte. Diesmal sollte er sich täuschen. Mit der Domina im Rücken lief Rappold zur Hochform auf.
»Herr Kolbe, wir sind nicht hier, um Zeit zu vergeuden. Ich kann gerne die gesamte Belegschaft aufs Präsidium vorladen, wenn Ihnen das lieber ist. Also?«
Kolbe traute seinen Ohren nicht. Sein Blick wanderte unschlüssig zwischen dem Kommissar, ihr und Hinz, der hinter ihrem Rücken Deckung suchte, hin und her.
»Was wollen Sie?«, fragte er schließlich mit vor Ärger bebender Stimme.
»Wir werden sämtliche Mitarbeiter zur Tatnacht befragen, auch die, die jetzt in ihren Wohnwagen schlafen. Dazu brauchen wir eine vollständige Liste des Personals inklusive aller Zulieferer. Wir befragen jeden, der im letzten halben Jahr Zutritt zur Versuchsanlage hatte.«
Kolbe lachte hysterisch auf. »Sie sind verrückt!«
»Halten Sie sich zurück, sonst sind Sie wegen Beamtenbeleidigung dran. Wir machen nur unsere Arbeit und zwar gründlich. Es sollte auch Ihnen einleuchten, dass wir alle Alibis überprüfen müssen.«
Ihre Worte. Sie musste sich zurückhalten, um Rappold nicht auf die Schulter zu klopfen.
»Während die Kollegen Ihre Leute befragen, möchte ich mich auf dem Areal umsehen«, sagte sie.
Er warf ihr giftige Blicke zu und fragte mit kaum verhohlener Wut:
»Wozu soll das gut sein?«
»Wenn Sie gestatten, stelle ich die Fragen.« Mit einer einladenden Handbewegung wies sie nach draußen. »Bitte sehr, Herr Kolbe, nach Ihnen.«
Er rührte sich nicht.
»Je schneller ich mir einen Überblick über die Anlage und Abläufe verschafft habe, desto früher sind Sie mich wieder los«, fügte sie hinzu.
Dieses Argument leuchtete ihm ein. Er gab ihr einen Schutzhelm und trat ins Freie.
»Sie wissen, was wir hier tun?«
»Ganz grob«, antwortete sie und spielte die Naive. »Sie suchen im Tonschiefer nach Gas. Erklären Sie es mir.«
»Da haben wir schon das erste Missverständnis. Die Gesteinsschicht, in der das Erdgas, vor allem Methan, gebunden ist, hat nichts mit Schiefer zu tun. Es ist eine Schicht aus Tonstein. Die Bezeichnung Schiefergas ist Unsinn. Sie beruht auf einem Übersetzungsfehler.«
»Ach so, und dieser Tonstein befindet sich hier unter unseren Füßen?«
Er nahm ihr die wissbegierige Dilettantin ohne Weiteres ab. Die Kommissarin rückte in den Hintergrund. Es reichte gar für ein verständnisvolles Lächeln, als er antwortete:
»Nicht direkt an dieser Stelle. Wir befinden uns am Rand des Vorkommens. Die Bohrung führt senkrecht unter die undurchlässige Schicht, über der das Grundwasser liegt. Von dort bohren wir horizontal weiter in die Tonschicht hinein.«
»Horizontal?«, unterbrach sie mit großen Augen. »Wie geht denn das?«
»Es ist im Grunde eine alte Technik, die wir heute natürlich mittels Sensoren und Computern wesentlich besser beherrschen. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die Auswertungen im Überwachungswagen.«
»Danke, später vielleicht.«
Ihr Interesse galt im Augenblick eher dem Inhalt der vielen Tanks auf dem Gelände. Sie standen bei den Bohrtürmen.
»Also, hier führt die Druckleitung hinunter und stößt dann horizontal in die Tonschicht vor. Das Gestein bekommt durch den Druck Risse. So gibt es das eingelagerte Gas frei, das entlang der Bohrung aufgefangen und an die Oberfläche geleitet wird. Bei den Förderköpfen dort drüben fangen wir es auf und leiten es in die Vorratstanks. Das ist nur eine Versuchsanlage mit Testbohrungen. Deshalb sind wir natürlich nicht an ein Pipelinenetz angeschlossen.«
»Und das funktioniert einfach mit Wasser?«
Wieder lächelte er verständnisvoll. »Wir verwenden ein FracFluid aus Wasser, Sand und Stärke. Im Gegensatz zu klassischen Fracking Anlagen gibt es bei uns keine giftigen Chemikalien. Wir nennen die Methode deshalb ›Clean Fracking‹.«
»Tönt ja sehr fortschrittlich.«
»Ist es auch.«
Er führte sie zu einem Mischwerk nahe der Stelle, wo die Lagerhalle abgebrannt war. Es wies keinerlei Explosionsschäden auf, genau wie alle andern Anlagen, die sie besichtigte. Der Eindruck verstärkte sich, die Täter hätten genau darauf geachtet, nur den Inhalt des Lagers zu vernichten. Warum sollten Umweltaktivisten so etwas tun?
»Hier wird das Wasser mit dem Zusatz gemischt«, erklärte er. »So entsteht das FracFluid.«
»Mit dem Zusatz aus der abgebrannten Halle«, ergänzte sie mit ironischem Schmunzeln.
»Ja, Sie haben recht. Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Wir werden das Fluid vorderhand fertig gemischt aus Leverkusen beziehen.«
Die Auslagerung des Mischvorgangs und damit die Aufhebung des Lagers für Fracking Zusatz waren also die einzigen technischen Konsequenzen des Anschlags. Auf dem Weg zurück zum Container überraschte sie Kolbe mit der Frage:
»Warum gerade hier, so nahe am Schutzgebiet um den Bodensee?«
»Die Tonschicht verläuft nun mal genau hier entlang – und wie gesagt: Wir betreiben ›Clean Fracking‹ und halten uns an alle Auflagen.«
»Das möchte ich hoffen.«
Die Kommissarin war zurück, Kolbes Misstrauen auch.
»Ich muss Sie bitten, mir alle Arbeitsprotokolle und die Logfiles aus dem Überwachungswagen von der Nacht des Anschlags auszuhändigen. Wir brauchen ein vollständiges Bild der Ereignisse in jener Nacht.«
Nun waren auch Kolbes feindselige Blicke wieder da. Er hatte keine Wahl und wies eine Mitarbeiterin an, die gewünschten Informationen zusammenzustellen. Der dünne Papierstapel sah nicht sehr vertrauenerweckend aus. Sie zweifelte an der Vollständigkeit der Angaben, befasste sich aber zuerst mit der geologischen Karte, die Kolbe bei ihrer Ankunft weggeräumt hatte. Sobald sie allein war im Container, breitete sie die Karte aus. Die Tonschicht verlief in einem breiten Band vom See her nach Nordosten. Wie der Ingenieur behauptet hatte, befand sich das Versuchsgelände am südlichen Rand des Vorkommens. Sie rief das Satellitenbild der Umgebung auf ihrem Handy ab und legte es in Gedanken über die Karte. Zwanzig oder dreißig Stellen waren rot eingekreist, Gebiete, die sich besonders für eine Förderung eigneten. Die Kreise bildeten eine lange Kette, deren größtes Glied jemand durchgestrichen hatte. In diesem Kreis lag das Kloster Mariafeld.
Zehn Minuten später fuhr sie an einem Kornfeld entlang, wo ein Bauer auf dem Traktor dabei war, die Schwaden aus Stroh zu wenden. Sie hielt an, hupte und gab dem Mann Zeichen, dass sie mit ihm sprechen möchte. Er reagierte erst, als sie den Dienstausweis schwenkte.
»Es geht um den Sprengstoffanschlag, stimmt‘s?«, fragte er, kaum abgesprungen.
Er hieß Paul Weber und arbeitete als Gutsverwalter für das Kloster.
»Schon eine ganze Ewigkeit«, betonte er.
Sie brauchte nicht zu fragen. Er schnitt das Thema, das sie interessierte, von sich aus an.
»Wissen Sie, diese Chemie-Mafia will hier alles kaputtmachen. Sehen Sie sich das Land doch an.« Eine ausladende Handbewegung unterstrich sein Argument. »Das ist Landwirtschaftszone, so weit das Auge reicht. Seit vielen Generationen werden hier nachhaltig Getreide, Gemüse und Früchte produziert. Der Boden ist gut und ernährt uns alle zuverlässig. Und da kommen die geschniegelten Rechtsverdreher der Chemie-Bonzen in ihren Nadelstreifenanzügen und wollen den ganzen Landstrich mit Bohrtürmen überziehen.«
»Den ganzen Landstrich? Ich denke, es geht um einzelne Probebohrungen.«
Ein bitteres Lächeln umspielte seinen Mund. »Wäre es nur um diese zwei, drei Löcher gegangen, hätten sie nicht so einen Aufstand um unser Land gemacht. Dreimal waren die Herren Anwälte mit dem Ingenieur beim Prior, aber der hat sich Gott sei Dank nicht breitschlagen lassen. Es gibt eben noch anständige Menschen.«
»Verstehe ich Sie richtig: Die NAPHTAG wollte das Klostergut kaufen?«
»Genau, so heißt die Mafia, NAPHTAG. Sie haben am Ende eine astronomische Summe geboten für den Teil des Guts, auf dem wir jetzt stehen. Wenn Sie mich fragen, geht es denen darum, ein zusammenhängendes Gelände bis hinüber nach Memmingen zu erschließen. Einige Nachbarn haben schon verkauft oder gut bezahlte Vorkaufsrechte überschrieben.«
»Bis nach Memmingen! Das sind mehr als hundert Kilometer, Platz für hundert Förderanlagen.«
»Da sehen Sie es.«
Kolbe hatte nichts dergleichen erwähnt, als handelte es sich bei seinem Unternehmen nur um eine isolierte Probebohrung. Falls die Vermutung des Gutsverwalters zuträfe, könnte sich der Konzern ein Scheitern des Versuchsbetriebs gar nicht mehr leisten. Sie bedankte sich und zog das Telefon aus der Tasche. Es gab Arbeit für den Kollegen Haase. Bauer Webers Angaben bargen Zündstoff. Es lohnte sich, sie unverzüglich zu überprüfen.
Ingenieur Kolbe hatte das Versuchsgelände verlassen, als sie zurückkehrte. Sie benutzte die Gelegenheit, die Techniker an den Bohrtürmen direkt zu befragen. Beim Rundgang mit Kolbe war ihr der große, offenbar unbenutzte Vorrat an Bohrgestängen und Förderrohren aufgefallen. Sie suchte sich den Arbeiter aus, der sich am brennendsten für sie zu interessieren schien.
»Wie es aussieht, sind die Löcher noch nicht tief genug«, scherzte sie.
Der Scherz war offenbar gelungen. Er lachte herzhaft.
»Es täuscht«, sagte er mit dem Blick aufs Materiallager. Er neigte sich zu ihr herüber, dass sein Mund ihr Ohr beinahe berührte und flüsterte: »Der Herr Ingenieur hat sich verrechnet.«
»Wie darf ich das verstehen?«
»Wir sind schon in einer Tiefe von 2‘000 Metern auf ergiebige Schichten gestoßen.«
»2‘000 Meter, aha. Das ist aber ein ganz schön tiefes Loch.«
Er fand auch diese Bemerkung außerordentlich erheiternd.
»Sie haben keinen Schimmer von unserer Arbeit, was?«, platzte er heraus. »Zwei Kilometer sind gar nichts. Normalerweise treiben wir über vier Kilometer vor.«
3‘000 Meter war die gesetzlich erforderliche Minimaltiefe für solche Bohrungen. Das schien der Techniker nicht zu wissen. Kolbe wusste es ganz bestimmt. In seinen Protokollen war die Tiefe mit unbedenklichen 4‘500 Metern angegeben. Sie glaubte nicht an ein Versehen.
Hinz und Rappold hatten die Befragungen abgeschlossen. Die Überprüfung der Alibis für die Tatnacht würde einige Zeit dauern, ebenso wie die noch ausstehenden telefonischen Befragungen der externen Mitarbeiter und Zulieferer. Die bisherigen Ermittlungen ergaben kein einheitliches Bild. Nichts wies eindeutig in die Richtung eines Insider Jobs.
Hinz überraschte sie. Er hatte nicht nur Fotos aller Anwesenden geschossen, sondern auch die Autos auf dem Parkplatz abgelichtet und sie den Angestellten zugeordnet. Der Junge besaß Potenzial.
»Leider keine verdächtigen Fahrzeuge«, fasste er zusammen.
Nicht überraschend: Seine Aktion erfolgte einige Tage zu spät. In der Tatnacht war keinem Kollegen eingefallen, die anwesenden Autos zu kontrollieren.
»Wir fahren dann mal zurück«, sagte Rappold.
Die beiden saßen schon im Wagen, als laute Rufe und Flüche ihre Aufmerksamkeit auf die Förderköpfe lenkten. Dampf zischte pfeifend aus einem Ventil. Arbeiter flüchteten. Warnrufe scheuchten auch die letzten zwei Techniker von ihrem Arbeitsplatz. Der Druck von 400 bar sprengte das defekte Ventil. Es explodierte mit lautem Knall. Geschosse aus Gusseisen schwirrten durch die Luft wie gigantische Querschläger. Alarmsirenen schalteten sich ein. Mitten im Durcheinander entdeckte sie hinter dem Bohrgestänge am Rande des Versuchsgeländes ein geparktes Auto, das Hinz weder erwähnt noch auf einem Foto gezeigt hatte. Sie musste die Unglücksstelle mit dem geplatzten Ventil weiträumig umgehen, um zum Fahrzeug zu gelangen. Von Weitem sah sie eine Gestalt darauf zu laufen.
»Halt, Polizei, bleiben Sie stehen!«, schrie sie aus Leibeskräften.
Die tosende Schlammfontäne, die aus dem Leck in den Himmel schoss, übertönte alle Rufe. Sie verlor die Gestalt für kurze Zeit aus den Augen. Das Rohrlager versperrte den Weg. Fluchend rannte sie ums Hindernis herum. An der Ecke schoss die Schaufel eines Radladers wie das aufgerissene Maul einer Bulldogge auf sie zu. Ein Satz zur Seite in einen Sandhaufen rettete sie in letzter Sekunde.
»Alles in Ordnung?«, rief der Fahrer, ohne anzuhalten.
Er bremste nur leicht ab und beschleunigte sogleich wieder, als er sah, wie sie sich aufraffte. Wütend schüttelte sie den Sand aus den Kleidern, dann rannte sie weiter, den Puls auf hundertachtzig.
Die Gestalt war verschwunden, das Auto auch. Mann oder Frau? Sie konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Wagentyp und Kennzeichen blieben unbekannt. Eine schwarze oder dunkelblaue Limousine – mehr hatte sie nicht gesehen. Zu wenig für eine Fahndung, und die Verfolgung war zwecklos. Eine Stunde und unzählige Fragen später war sie kein bisschen schlauer. Niemand wollte den Unbekannten gesehen haben, aber es gab ihn oder sie, immerhin eine neue Erkenntnis.
Der rote Minivan hielt unterhalb des Hügels an. Von hier aus lag einem das ganze Klostergut zu Füßen. Die Luft flimmerte über den abgeernteten Feldern. In der Ferne glitzerte das schmale, silberne Band des Überlingersees. Maria Herzog stieg aus und atmete die trockene Landluft ein, die wie immer um diese Jahreszeit nach frischem Stroh roch. Sie war froh, wenigstens von ihrem Lieblingsplatz aus keine Bohrtürme zu sehen und das Summen der Pumpen nicht zu hören. Die Landschaft und das alte Gemäuer des Klosters hatten sich nicht verändert, seit sie als kleines Mädchen zum ersten Mal auf diesem Platz gestanden hatte. Die Zeit war stehen geblieben. Das erfüllte sie jedes Mal mit einer inneren Ruhe, die sie sonst im Alltag nicht kannte.
Die Marienglocke kündigte das mittägliche Angelusläuten mit drei bedächtigen Schlägen an. Sie war nicht religiös. Dafür war ihr Gehirn zu rational verdrahtet, aber die Jahre im katholischen Waisenhaus und Internat hatten ihr diese Kultur eingeimpft. Für sie war das Glockengeläute ein Stück Heimat wie der Bodensee oder der Zeppelin, der am stahlblauen Himmel surrend seine Runden drehte.
Bauer Weber war auf dem Weg in die Scheune. Seine Maschinen ruhten über Mittag wie früher die Landarbeiter. Er sprang vom Traktor, als sie auf den Hof fuhr.
»Da schau her, die Maria«, rief er freudig.
Für ihn war sie immer noch das Mädchen, das fast jede freie Minute auf dem Hof verbrachte. Er war der Herr Weber geblieben.
»Na, brauchen deine Pferde wieder Stroh?«, fragte er lachend.
Er wusste, dass ihre Pferde mikroskopisch kleine Lebewesen waren, die das Stroh schneller fraßen als ausgewachsene Pferde das Gras. Vorstellen konnte er sich dennoch nichts unter ihrer Arbeit.
»Sie lachen, Herr Weber, aber die Nachbarn haben uns tatsächlich schon gefragt, wann endlich die Pferde kämen.«
»Kann ich gut verstehen.«
Er half ihr, die zwei Strohballen ins Auto zu laden. Bald würde die ›Herzog Green Chemicals AG‹, ihre kleine Start-up Firma, mit einem Lkw vorfahren. Der Sprung vom Forschungslabor zur industriellen Produktion war endlich in Sichtweite gerückt. Sie war überzeugt, den endgültigen Durchbruch in den nächsten Tagen, höchstens Wochen, zu schaffen. Für sie und ihre Forscherkollegen, allen voran Felix Buchmacher, Mitbegründer und unverzichtbarer Partner, würde ein Lebenstraum in Erfüllung gehen. Ein Traum, an den auch die privaten Investoren glaubten, deren Risikokapital ihren Betrieb am Leben erhielt. Sie würden reich belohnt werden, daran zweifelte sie keinen Augenblick.
Bauer Webers Frage unterbrach ihre Gedanken.
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
»Wie bitte – nein, Entschuldigung.«
»Ihr Akademiker seid ein zerstreutes Volk«, sagte Weber kopfschüttelnd. »Ich habe gesagt, das Stroh koste diesmal nichts.«
»Kommt nicht infrage.«
»Willst du Streit?«, lachte er.
»Was halten Sie davon, wenn ich diese zwei Ballen bezahle, dafür die nächste Ladung geschenkt erhalte?«
Er musterte sie misstrauisch. »Da steckt sicher einer deiner schlauen Schachzüge dahinter.«
»Abgemacht?«
Sie streckte ihm die Hand entgegen. Er schlug zögernd ein.
»Vielen Dank, die nächste Ladung holen wir nämlich mit dem Lkw ab.«
Sie nahm den Handel nicht ernst, er offenbar auch nicht. Mit den Schultern zuckend, sagte er:
»Ich wusste es. Gegen euch Studierte ist kein Kraut gewachsen. Aber egal, vielleicht stehst du das nächste Mal sowieso vor einer leeren Scheune.«
»Wie das?«
»Ich weiß nicht, wie lang der Prior dem Druck der Fracking Mafia noch standhält. Das Kloster ist alles andere als auf Rosen gebettet, und nach der miserablen Ernte im letzten nassen Sommer herrscht Ebbe in der Kasse. Ich müsste dringend das Gebläse erneuern und das Dach ausbessern lassen, aber dafür fehlt das Geld.«
»Sie meinen, Pater Raphael verkauft das Land doch noch an die NAPHTAG?«
»Überraschen täte es mich nicht.«
Die Nachricht schockierte sie. Das Stroh würde sie auch woanders bekommen, falls das Kloster den Getreideanbau aufgäbe. Ihr Problem bestand darin, dass sie den Verheißungen des ›Clean Fracking‹ keine Sekunde traute. Eine solche Industrieanlage praktisch vor der Haustür würde die Qualität der übrigen Güter, die Bauer Weber produzierte, beeinträchtigen. Bio Label ade, Lebensqualität ade. Vor allem aber schockierte sie, dass offenbar nichts und niemand die Profitgier des Petrochemie Giganten stoppen konnte. Weber hörte sich ihre Argumente geduldig an. Am Schluss bemerkte er nur:
»Wem sagst du das.«
Sie musste unbedingt den Prior sprechen. Die Mittagspause verbrachte sie am Telefon mit den Kollegen im Labor in Wollmatingen und ihrer Geliebten. Emma verhielt sich merkwürdig verschlossen seit einigen Tagen. Maria wusste nur, dass sie an einer heißen Story arbeitete, in der die NAPHTAG eine Hauptrolle spielte. Mehr war nicht aus Emma herauszuholen. Wie üblich hielt sie die Geschichte strikt unter Verschluss bis zur Veröffentlichung. »Sonst wird aus der Bombe eine harmlose Verpuffung«, war ihr Argument. Maria hatte kein Problem damit. Sie selbst verhielt sich nicht anders, was ihre Forschungsergebnisse anbelangte. Der entscheidende Unterschied bestand nur in Emmas Tendenz, sich bei ihren Recherchen in unmögliche Situationen zu manövrieren. Kurz bevor die Bombe platzte, steigerte sich die Sorge um Emma zum latenten Unwohlsein. Hörte sie einen halben Tag nichts von ihr, begannen sich die Nerven zu kräuseln, als stünden sie unter Hochspannung. Emma beendete das Gespräch mit dem üblichen Zweckoptimismus:
»Mach dir keine Sorgen. Es ist bald vorbei.«
Pater Raphael, der Prior des Klosters Mariafeld, empfing sie freudestrahlend wie Bauer Weber. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn erschienen ihr zahlreicher und ausgeprägter als beim letzten Besuch vor zwei Monaten. Vielleicht bildete sie es sich ein nach dem Gespräch mit Weber, aber die Stimme des Paters bestärkte den Eindruck. Er klang müde, erschöpft, obwohl er sich alle Mühe gab, die gewohnte, unerschütterliche Kraft und Ruhe auszustrahlen, die ihr stets Halt und Zuversicht gegeben hatte. Sie sah in ihm nicht den Priester, den frommen Mönch. Pater Raphael war der gute Onkel, der sich ihrer nach dem Verlust der Eltern angenommen hatte. Ihm verdankte sie die Chance, an der Uni Konstanz das studieren zu können, was sie schon früh in den Bann gezogen hatte: Biologie, die Wissenschaft vom Leben. Er hatte sie letztlich überzeugt, den Schritt in die Selbstständigkeit mit dem Start-up-Unternehmen zu wagen, obwohl auch er sicher keine genaue Vorstellung davon hatte, was sein Schützling zwischen Petrischalen, Bioreaktoren und Chromatografen eigentlich trieb.
»Du hast Stroh geholt, nehme ich an«, sagte er nach der Begrüßung.
Sie nickte. »Die Mikroben brauchen Futter.«
»Eines Tages musst du mir mit den Worten eines Laien erklären, woran ihr arbeitet.«
»Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man von ein paar Einzelheiten absieht. Wir bringen Bakterien dazu, bestimmte Chemikalien aus Biomasse zu erzeugen. Bauer Webers Stroh eignet sich hervorragend als Futter. Unsere Bakterien ersetzen also eine ganze chemische Fabrik.«
»Das hört sich so einfach an.«
»Ganz so einfach ist es schon nicht. Immerhin tüfteln wir schon fünf Jahre daran, und während meiner Doktorarbeit habe ich auch nichts anderes getan. Anfangs wollten die Viecher partout nur in teurem Traubenzucker gedeihen.«
Die Bemerkung rang dem Prior ein Schmunzeln ab.
»Riesling-Sylvaner, vermute ich.«
»So ungefähr.«
»Und jetzt habt ihr die Einzeller umerzogen?«
»Genau das haben wir getan. Ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine stabile Population gezüchtet haben, Pater. Vielleicht sieht man es mir nicht an, aber ich bin richtig glücklich.«
»Man sieht es«, beruhigte er lächelnd, »andererseits hattest du schon immer ein sonniges Gemüt. Dafür beneide ich dich.«
Sie ließ den Blick durchs Arbeitszimmer des Priors gleiten. Wie oft hatte sie schon hier gesessen, das große, schwere Kruzifix vor Augen, das zu ihm gehörte wie die Kutte und die Brille mit dickem, schwarzem Rand? Auch dieser Raum veränderte sich nie. Pater Raphael besaß empfindliche Antennen. Ihm entging nicht, dass sie noch etwas loswerden wollte. Lächelnd forderte er sie auf, zu sprechen.
»Ich habe von Bauer Weber erfahren, dass die NAPHTAG Land vom Kloster kaufen will. Er ist sehr beunruhigt.«
Der Prior nickte nachdenklich. »Das kann ich verstehen. Er hängt am Klostergut wie wir alle.«
»Ehrlich gesagt, mache ich mir auch große Sorgen«, fügte sie hinzu.
»Du? Warum solltest du dir Sorgen machen?«
Sie wiederholte die Argumente, die sie schon beim Gutsverwalter vorgebracht hatte. Ähnliches musste Pater Raphael auch durch den Kopf gegangen sein. Er zeigte sich nicht überrascht, dachte aber lange nach, bevor er antwortete:
»Noch ist nichts entschieden.« Nach einer weiteren Pause ergänzte er: »Manchmal lässt einem der Herr nur die Wahl zwischen zwei Übeln.«
»Tun Sie es nicht. Verkaufen Sie nicht an die NAPHTAG, Pater. Ich weiß, es hört sich kindisch an, aber ich kann es nicht anders ausdrücken: Dieser Konzern ist böse. Die NAPHTAG kann sich die besten Anwälte leisten, dass Sie am Ende mit allen Konsequenzen leben müssen, selbst wenn das Fracking Unternehmen Ihr ganzes Grundwasser verseucht.«
»Übertreibst du jetzt nicht ein wenig, Maria?«
Sie schüttelte entschieden den Kopf. »Wir haben mit unserer Firma erlebt, wozu die NAPHTAG fähig ist. Wir haben bei verschiedenen Banken wegen des geplanten Börsengangs angefragt. Anfänglich erhielten wir attraktive Angebote, doch nach kurzer Zeit verabschiedete sich eine Bank nach der andern. Aus technischen Gründen, wie sie behaupteten. Ein paar ehrliche Banker haben uns den wahren Grund genannt. Die NAPHTAG hat gedroht, ihre Bankbeziehung zu beenden, falls sie weiterhin mit uns zusammenarbeiten.«
Der Pater starrte sie ungläubig an. »Warum sollten die so etwas Verwerfliches tun?«
»Weil sie sich bedroht fühlen, noch bevor wir unsere Forschungsergebnisse veröffentlichen. Der NAPHTAG Konzern will jede Konkurrenz im Keim ersticken. Eines Tages wird unsere ›grüne‹ Chemie große Teile der petrochemischen Industrie ersetzen. Davor haben sie panische Angst. Darum treiben sie dieses Fracking Projekt mit allen Mitteln voran, um Fakten zu schaffen und nachhaltige Alternativen wie unsere gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ich fürchte, dazu ist dem Konzern jedes Mittel recht.«
Sie war verstimmt, zornig. Pater Raphael kannte seine Maria so nicht. Jedenfalls ließ sie einen ziemlich verwirrten Prior im Kloster zurück, als sie sich auf den Heimweg machte.
KONSTANZ
Die Studentin sah die chemische Formel, die wie ein fettes Logo auf Felix Buchmachers Arbeitsmappe prangte.
»C4H6O4 – was ist an diesem Molekül so spannend?«, fragte sie provozierend.
»Was wissen Sie über Plattformchemikalien?«, fragte Felix zurück.
»So nennt man Basischemikalien, aus denen viele andere, komplexere Stoffe synthetisiert werden.«
»Das haben Sie schön auswendig gelernt«, sagte er lachend.
Er schob die Probe aus dem Labor in Wollmatingen ins NMR-Impulsspektrometer und schaltete das Gerät ein. Die Start-up Firma war zu klein und sparsam, um sich ein solches Instrument leisten zu können. Deshalb verbrachte er manche Stunde unter Studenten im Chemiegebäude der Uni – und in der Cafeteria. Er deutete auf die Formel und ergänzte:
»Bernsteinsäure ist so eine Basischemikalie. Man verwendet sie zum Beispiel zur Herstellung von Polyester. Lösungsmittel und Weichmacher für Kunststoffe werden daraus produziert. Sogar die Parfümindustrie braucht dieses Molekül.«
Die Studentin zeigte sich unbeeindruckt.
»Und jetzt wollen Sie die Struktur dieses einfachen Moleküls bestimmen?«, fragte sie mit einem ironischen Blick aufs Spektrometer.
Er schüttelte lachend den Kopf. »Die könnte ich im ›Beyer‹ nachschlagen. Nein, junge Dame, was das Instrument gerade analysiert, bleibt mein Geheimnis.«
»Na dann viel Erfolg.«
»Danke, werde ich haben«, murmelte er, während sie zur Tür hinaus rauschte.
Von hinten erinnerte sie entfernt an die Süße mit den Fransen, die ihm in der Cafeteria verstohlene Blicke zugeworfen hatte, wie er glaubte. Er wandte sich mit einem leisen Seufzer wieder dem Computerbildschirm zu, auf dem er den Fortschritt der Analyse kontrollieren konnte. Die Probe im Spektrometer gehörte tatsächlich zum bestgehüteten Betriebsgeheimnis der ›Herzog Green Chemicals‹. An der Struktur dieses Enzyms entschied sich, ob ihre junge Firma eine Zukunft hatte oder nicht. Das Molekül mit dem komplexen räumlichen Aufbau wirkte als Katalysator bei der Herstellung von Bernsteinsäure aus Stroh und anderen Zelluloseabfällen durch die eigens zu diesem Zweck programmierten Bakterien. Ohne Katalysator würde der Traum einer ›weißen Biotechnologie‹ nicht in Erfüllung gehen. Trotz unsicherer Rohstoffversorgung und schwankender Preise bliebe die klassische Herstellung von Basischemikalien und Kunststoffen durch petrochemische Verfahren attraktiver. Nachwachsende Rohstoffe statt Erdöl und Erdgas würden auf absehbare Zeit eine unbedeutende Randerscheinung bleiben. Das Molekül in diesem Spektrometer war die Zukunft – sofern die räumliche Struktur bis in alle Einzelheiten stimmte.
Er blickte auf die Uhr: halb eins. Die Analyse würde eine weitere Stunde in Anspruch nehmen. Er schaltete die Bildschirmanzeige aus und klebte Zettel an Computer und Spektrometer: Besetzt bis 15:00 Uhr, Dr. F. Buchmacher, dann verließ er das Labor. Der Zeitpunkt war günstig. Er schätzte die Chance auf über fünfzig Prozent, die blonden Fransen in der Cafeteria anzutreffen.
Er knabberte unruhig an einem Käsesandwich, dessen Semmel von letzter Woche stammte. Hin und wieder schlürfte er kalten Kaffee aus einem Pappbecher, um nicht zu ersticken. Er benutzte die traurigen Relikte nur als Tarnung, damit er nicht auffiel, während er das Uni Volk beobachtete. Sie ließ sich Zeit. Eine halbe Stunde verstrich ohne Fransen. Er nippte am leeren Kaffeebecher, unschlüssig, ob er diskret nach ihr fragen sollte. Erst als dieser verwegene Gedanke zwischen all den gefalteten Eiweißen in seinem Gehirn auftauchte, stellte er fest, dass er nichts über sie wusste, gar nichts. Außer dem liebenswürdigen Gesicht mit den Fransen gab es nichts, womit er sie hätte beschreiben können. War sie eine Studentin? Arbeitete sie in der Verwaltung? Wie hieß sie? Wie alt war sie? War sie schon vergeben? Fragen über Fragen und keine Antworten. Er kaute weiter an seinem Pappbecher und wartete.
Eine kleine Gruppe Studenten, zwei Männer, zwei Frauen, setzte sich eifrig diskutierend an einen Tisch am Fenster. Einer sprach ein Dezibel lauter als die andern. Felix verstand nur das Wort »Demo«, passend zu dem Typen im grünen T-Shirt, das lose an ihm flatterte, als wäre er nach dem Kauf vor Jahren in Hungerstreik getreten. Der Vortrag des Eiferers interessierte ihn nicht, wohl aber die Tatsache, dass er ihn einmal in Begleitung der Fransen gesehen hatte. Hoffnung keimte auf. Er erhob sich, um den Redefluss der Vogelscheuche mit seiner Frage zu stoppen, da stand sie unvermittelt am Eingang, Bücher unter dem Arm und heftig atmend. Sie steuerte stracks auf die Gruppe zu, wechselte einige hastige Worte, machte kehrt und eilte wieder hinaus. Mit der Geistesgegenwart des Verzweifelten stellte er sich ihr in den Weg. Der Zusammenstoß war kaum spürbar, verlieh dem zarten Geschöpf aber einen Drehimpuls, dass ihr Bücher und Notizen entglitten. Er entschuldigte sich wortreich, während er nach ihren Sachen tauchte. Ihre Blicke trafen sich zum ersten Mal richtig, länger als eine Millisekunde.
»Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht«, sagte er. »Es tut mir leid. Kann ich es mit einem Kaffee wiedergutmachen?« Er glaubte, sein Herz pochen zu hören, als er die Hand ausstreckte und verlegen zu lächeln versuchte. »Felix.«
»Sarah«, hauchte sie, senkte den Blick und huschte davon.
»Mit oder ohne H?«, murmelte er mit sturem Blick.
Sie war verschwunden, als sich der Verstand wieder einschaltete. Immerhin hatte er drei Dinge gelernt. Er kannte jetzt ihren Namen, wenn er ihn auch nicht mit Sicherheit richtig schreiben konnte. Zweitens duftete sie ebenso gut, wie sie aussah und drittens – das Wichtigste – errötete sie, als sie sich gegenüberstanden. Die Vorstellung, eine Chance bei ihr zu haben, verlieh ihm Flügel. Er rannte auf den Ausgang zum Parkplatz zu, wo er sie vermutete. Keine der Blondinen war seine. Enttäuscht stieg er ins Auto. Der Motor lief schon, als die Erinnerung ans Spektrometer zurückkehrte. Seufzend stellte er den Motor ab und stieg wieder aus. Felix, dich hat es schlimm erwischt. Es war das Vierte, was er an diesem Tag lernte: Möglicherweise gab es noch andere Dinge im Leben als gefaltete Moleküle.
Maria parkte vor dem Schuppen neben dem Haus in Wollmatingen, der alles enthielt, was in den wenigen Büros und im Labor der Firma ›Herzog Green Chemicals‹ nicht Platz fand. Die Nachwuchs-Akademiker, die hier ihr Praktikum absolvierten oder etwas Geld fürs Nachdiplomstudium und die Doktorarbeit verdienten, saßen an ihren Computern. Im Labor sah sie nur den Laboranten.
»Wo ist Felix?«
Der junge Mann unterbrach die Arbeit am Spülbecken und zuckte die Achseln.
»An der Uni nehme ich an.«
»Was – immer noch?«
Das Enzym musste eine sehr komplexe Struktur haben. Sie bat den Laboranten, ihr beim Ausladen zu helfen. Stroh war ein leichter Werkstoff, solang man es nicht zu Ballen presste.
Ein feines Stimmchen unterbrach wenig später ihre Arbeit im Schuppen:
»Was machst du?«
Emmas kleiner Sohn Julian stand neben dem Minivan. Er erkannte das rote Auto seiner Tante Maria von Weitem. Sie legte die Baumschere weg, mit der sie das Gebinde des einen Strohballens auftrennen wollte.
»Wo kommst du denn her, mein Großer?«
Er sprang in ihre Arme, um sich sogleich zu befreien, als sie ihm einen herzhaften Kuss auf die Wange drückte. Im nächsten Atemzug saß er auf dem Stroh und fragte:
»Was machst du damit?«
»Weißt du überhaupt, was das ist?«
»Ein Bett.«
Zum Beweis legte er sich darauf und schloss die Augen. Der Junge war schon jetzt nie um eine Antwort verlegen, wie seine Mutter.
»Als Bett kann man es auch brauchen, das stimmt«, gab sie lachend zu. »Früher haben viele Leute auf Stroh geschlafen. Heute tun es meist nur noch Pferde und Ponys.«
»Ponys sind doof«, rief er und sprang auf.
Die Baumschere weckte sein Interesse. Sie war schneller und brachte das gefährliche Werkzeug in Sicherheit. Er ließ nicht locker.
»Was machst du damit?«
»Mit der Schere schneide ich die Schnüre auf, die das Stroh zusammenhalten.«
Sie zeigte es ihm, sorgsam darauf bedacht, ihn auf Abstand zu halten. Der Junge war flink wie ein Wiesel.
»Warum?«
»Ich muss das Stroh auseinandernehmen und dann zerkleinern.«
»Warum?«
»Unsere kleinen Tierchen im Labor können Strohschnipsel besser essen.«
»Die Tierchen im Fernsehen?«
»Ja, die Bakterien, die ich dir auf dem Computerbildschirm gezeigt habe.«
»Die essen das?«
Er kaute auf einem Halm und spuckte ihn angewidert aus.
»Die Bakterien machen aus dem Stroh wertvolle Sachen – wie Rumpelstilzchen.«
Der Vergleich war ihr ungewollt entschlüpft. Statt weiterarbeiten zu können, besaß sie jetzt seine volle Aufmerksamkeit.
»Wer ist Rummelpilzchen?«
»Rumpelstilzchen«, korrigierte Emma lachend.
Julians Mutter trat auf sie zu und drückte beide an die Brust. Maria entschuldigte sich:
»Tut mir leid, Schatz, ich hätte das Märchen nicht erwähnen sollen, zu brutal für Julian.«
Emma lachte sie aus. »Papperlapapp, Julian liebt Märchen, stimmt‘s?«
»Ja – Rummelpilzchen, Rummelpilzchen!«, rief der Kleine und tanzte auf dem Stroh herum wie Rumpelstilzchen vor der Hütte im Wald.
»Da siehst du‘s«, grinste Emma. »Jetzt musst du ihm die Geschichte erzählen. Du hast keine Wahl.«
Tante Maria als Märchentante. Natürlich fehlte ihr die Zeit dazu. Sie wollte aufbegehren, doch Julians große Augen hingen so erwartungsvoll an ihren Lippen, dass sie nur einen Seufzer zustande brachte.
»Also komm her, Großer, setz dich auf meine Knie.«
Während er die bequemste Haltung suchte, lud sie Grimms Märchen vom Rumpelstilzchen vom Internet auf den Handy Bildschirm. Sie erinnerte sich nur an den Kern der Geschichte. Ein Junge wie Julian aber brauchte alle Einzelheiten. Emma schien sich köstlich zu amüsieren.
»Ich bin oben in der Wohnung«, sagte sie mit gemeinem Grinsen auf den Stockzähnen und verschwand.
Nach einem weiteren Seufzer begann Maria zu erzählen:
»Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter …«
Das Märchen vom Wicht, der aus Stroh Gold spinnen konnte, wäre schnell erzählt gewesen, hätte Julian einfach zugehört. Für den Kleinen war alles neu. Nach hundert Exkursen ins Handwerk des Müllers, den Sinn von Spinnrädern und den Wert des Goldes vermochte er immerhin den Zungenbrecher Rumpelstilzchen korrekt auszusprechen. Die Vorlesung dauerte so lange, bis Emma aus der Wohnung zurückkehrte und Julian zum Aufbruch drängte. Die beiden wohnten nicht bei ihr – leider. Andererseits hatte die räumliche Trennung durchaus ihre Vorteile, wenn sie an die Arbeit dachte, die liegengeblieben war. Bevor er ging, sah ihr der Junge tief in die Augen und fragte:
»Kannst du auch aus Stroh Gold machen?«
So klein er war, er hatte den Zweck des Unternehmens ›Herzog Green Chemicals‹ in vier Wörtern zusammengefasst: Aus Stroh Gold machen. Sie konnte die Frage nur mit einem klaren Ja beantworten.
»Dann bist du Rumpelstilzchen!«, rief er und rannte davon.
Emma wollte ihn einfangen, doch sie hielt ihre Lebensgefährtin zurück.
»Warte, Julian geht schon nicht verloren. Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten.«
»Tun wir doch die ganze Zeit.«
»Du weichst aus. Ich merke doch, dass etwas nicht stimmt. Dich bedrückt etwas. Warum sprichst du nicht mit mir?«
Mit mir ist alles in Ordnung – mit uns – glaub mir.
»Hat es mit deiner Arbeit zu tun, mit der Nacht, als du weg warst?«
Emma zögerte. Auf Julians Ruf wandte sie sich ab.
»Wir müssen jetzt … Mach dir keine Sorgen«, sagte sie und ging.
Maria konnte den Spruch nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn Emma das sagte, kletterte ihr Sorgenbarometer einige Stufen höher.
Felix saß an seinem Computer, als sie ins Haus zurückkehrte.
»Wie sieht es aus?«, fragte sie.
Er studierte die Zahlenreihen und Grafiken, die das Spektrometer ausgespuckt hatte. Die Runzeln auf seiner Stirn bedeuteten nichts Gutes. Er zeigte auf eine Falte in der Proteinstruktur.
»Die war vorher nicht so ausgeprägt«, murmelte er. »Da stimmt etwas nicht. Ich dachte erst an ein Artefakt oder einen Messfehler, aber die zweite Probe zeigt die gleiche Anomalie.«
Es sah nicht allzu gut aus für ihren mühsam synthetisierten Katalysator.
»Aber die Endsequenzen mit den neuen Doppelbindungen sind in Ordnung?«, fragte sie.
Er nickte.
»Also, dann lohnt sich ein Versuch.«
Biochemie war eine Wissenschaft, die mindestens zur Hälfte auf der Methode ›Versuch und Irrtum‹ gründete. Man brauchte mitunter eine Engelsgeduld, bis alle Bedingungen für einen Erfolg versprechenden Versuch erfüllt waren.
»Der Reaktor ist vorbereitet«, sagte sie mit aufmunterndem Lächeln. »Nichts wie rein mit dem Enzym. Diesmal schaffen wir die fünfzig Prozent. So nah dran waren wir noch nie.«
Fünfzig Prozent Ausbeute an reiner Bernsteinsäure aus dem Bioreaktor: Damit wäre der Durchbruch geschafft, der Schritt zur industriellen Produktion realistisch.
»Das wäre die Sensation an der Pressekonferenz, was meinst du? Die erste echte Bioraffinerie in unserem bescheidenen Labor in Wollmatingen!«
Er saß gedankenverloren am Computer und starrte am Bildschirm vorbei ins Leere. Sie klopfte ihm auf die Schulter.
»Hallo, Dr. Buchmacher, jemand zu Hause?«
Er schreckte auf. »Wie – was ist los?«
»Das frage ich mich auch gerade. Hast du überhaupt zugehört?«
»Du – willst den Versuch trotzdem wagen?«
»Ja klar, und die Pressekonferenz wird ein Erfolg, habe ich noch gesagt. Die Anleger werden uns die Bude einrennen. Jeder will sich noch günstige Anteile sichern vor dem Gang an die Börse, du wirst sehen.«
Er blickte durch sie hindurch. Begeisterung sah anders aus.
»Bist du krank?«
Im Zeitlupentempo kehrte er zu ihr zurück und murmelte:
»Ja, vielleicht.« Unvermittelt grinste er, leicht errötend. »Eine Art Krankheit – du hast wahrscheinlich recht. Es fühlt sich ziemlich ungesund an.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis der Groschen fiel. Die Diagnose war so offensichtlich wie unerwartet für einen Nerd wie Felix.
»Du bist verliebt!«, rief sie lachend.
Er brauchte nicht zu antworten. Sein Gesichtsausdruck sprach Bände.
»Unsern Felix hat‘s erwischt – ich fasse es nicht.«
Soweit sie sich erinnerte, war dies sein erstes Mal trotz der 27 Jahre.
»Wer ist die Glückliche, wie heißt sie, gibt‘s ein Foto?«
»Du nervst. Ich weiß, wie sie heißt.«
»Sag mal! Aber mir willst du den Namen nicht verraten?«
»Du kennst sie nicht.«
»Wer weiß. Du hast sie an der Uni kennengelernt, stimmt‘s? Klar, wo denn sonst.«
»Wir kennen uns eigentlich gar nicht«, entgegnete er mürrisch. »Sie passt einfach nicht zu den Typen, mit denen sie verkehrt, so ganz Grüne und Soziale im Schlabberlook mit total flachen Schuhen und großer Klappe.«
»Sie trägt Schlabberlook?«
»Nein, eben nicht. Sie ist – nett.«
Dabei schwankte sein Gesichtsausdruck zwischen keuscher Freude und Kummer.
»Warum hängt sie denn mit diesen Typen herum?«
»Sie hängt nicht herum – und überhaupt: Dazu müsste ich sie zuerst fragen.«
Er wich ihrem Blick aus. Es dauerte einen Wimpernschlag, bis sie begriff, was es bedeutete. Sie lachte laut auf.
»Ach so – du hast sie noch gar nicht angesprochen?«
»Du verstehst das nicht. Lass mich in Ruhe.«
Er begann, eifrig auf die Tastatur einzudreschen. Plötzlich hielt er inne und sagte:
»Ich muss morgen früh noch mal an die Uni. Vielleicht habe ich die Lösung für unser Problem.«
Du meinst die Lösung für dein Problem, dachte sie und machte sich kopfschüttelnd auf den Weg ins Labor.