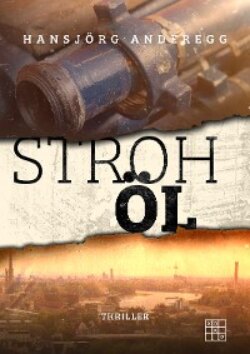Читать книгу Strohöl - Hansjörg Anderegg - Страница 7
ОглавлениеKAPITEL 3
KONSTANZ
Chris steuerte ohne zu zögern auf die Vollversammlung bei der Aula zu. Von allen Seiten strömten junge Leute und vereinzelte ältere Semester zusammen.
»Immer schön bei Mutti bleiben«, ermahnte sie Hinz.
Der Kommissaranwärter wirkte etwas verloren inmitten der aufgeregt diskutierenden Jugend. Von Alter und Gestalt her fiel er wenigstens nicht aus dem Rahmen. Er ging ohne Weiteres als Kommilitone durch, der den Bachelor vielleicht nicht im ersten Anlauf geschafft hatte. Sie selbst gab sich mit Zopf und roter Schleife ein paar Jahre jünger, um nicht allzu sehr aufzufallen.
»Was ist da los?«, fragte Hinz.
»Das werden wir gleich herausfinden.«
Eine junge Frau drückte ihr ein Flugblatt in die Hand, wie um die Frage des Kollegen zu beantworten.
»Den Film müsst ihr euch unbedingt ansehen«, sagte sie, während sie fleißig weiter Flugblätter verteilte.
DIE FRACKING LÜGE DEMO!
stand als Überschrift auf dem Zettel, darunter ein paar Schlagzeilen, die sie nicht zum ersten Mal sah:
Gift im Grundwasser!
Fracking Chemikalien erzeugen Krebs!
Brennendes Trinkwasser!
Wohin mit dem giftigen Rückfluss?
Wollt ihr mehr Erdbeben?
Noch ein Desaster wie die Kernkraft?
Clean Fracking ist eine Lüge!
Fucking statt Fracking!
Demo Freitag 11:00 Uhr
»Ziemlich aufgeheiztes Klima«, flüsterte Hinz ihr zu.
»Gut für uns. Augen auf, Hinz. Uns interessieren die Wortführer und Organisatoren der Demo. Knipsen Sie unauffällig und sammeln Sie Namen. Am besten teilen wir uns auf. Sie folgen der Demo, ich ermittle in der Uni.«
Sie sah ihm an, dass er sich am liebsten augenblicklich in seine dunkle Ecke verkrochen hätte, aber er wagte nicht zu widersprechen. In der Aula lief der Film ›Gasland‹, eine Dokumentation des Amerikaners Josh Fox über die Folgen des Fracking Booms in vier US-Bundesstaaten. Drastische Szenen wie aus einem Katastrophenfilm wurden mit Buhrufen quittiert: explodierende Brunnen und Häuser, Trinkwasser, das so viel Erdgas enthielt, dass es brannte, als hätte jemand Wasser- und Gasleitung vertauscht, Haustiere mit plötzlichem Haarausfall, Klärschlamm als Grundwasser, vom zuständigen Konzern als unbedenklich eingestuft. Sie kannte den Film, hatte selbst erlebt, wie leicht auch ein kritischer Geist durch die drastischen Bilder und Einzelschicksale Augenmaß und Objektivität verlieren konnte. Glaubte man den Bildern auf der Leinwand, musste man unausweichlich zum Schluss kommen, Fracking wäre vom Teufel persönlich erfunden worden, um die Menschheit zugrunde zu richten. Sie las Verwirrung, Abscheu und Entrüstung in vielen Gesichtern. Nur wenige Zuschauer zeigten sich unbeeindruckt. Ein spindeldürrer Typ in flatterndem grünem T-Shirt bemächtigte sich des Mikrofons, kaum war die letzte Abblendung über die Leinwand geflimmert.
»Leute, wir dürfen nicht länger schweigen!«, brüllte er in den Saal, dass es draußen durch die Gänge hallte. »Wir wissen jetzt, was Fracking anrichtet. Wir wollen diese Sauerei vor unserer Haustür unter keinen Umständen zulassen. Probebohrungen nennen sie das, was in Überlingen geschieht, dabei hat die NAPHTAG schon ganze Landstriche unter Kontrolle. Wir sagen: Wehret den Anfängen! Schnappt euch den Flyer mit unsern Schlachtrufen und ein Transparent am Ausgang. Auf dem Parkplatz und bei der Bushaltestelle gibt‘s Mitfahrgelegenheiten. Wir versammeln uns auf der Marktstätte beim Bahnhof. Um elf geht‘s los. Auf in den Kampf!«
»Auf in den Kampf!«, erscholl es vereinzelt aus dem Publikum.
Es war nicht gerade der Sturm auf die Bastille, aber der Hagere hatte doch genügend Wir-Gefühl verbreitet, dass der Großteil der Versammelten dem Aufruf folgte. Sie versuchte vergeblich, den Wortführer abzufangen. Seine Entourage erwies sich als undurchdringlich. Eine junge Frau stand etwas abseits, verächtlich den Kopf schüttelnd angesichts der Aufregung. Chris näherte sich unauffällig und fragte:
»Wer ist der Spinner?«
Die Frau zuckte die Achseln. »Ich kenne ihn nur als ›die Krähe‹.«
»Das passt«, sagte Chris lachend. »Ganz unrecht hat er ja nicht mit seinen Schreckensvisionen.«
»Ja schon, aber wir befinden uns doch nicht im Krieg. Er ist voll überzeugt, sie hätten Barbarossa gekillt.«
»Ich dachte, der wäre schon vor ein paar Hundert Jahren gestorben.«
Sie sagte es nur, um Zeit zu gewinnen. Bis sie begriff, worüber die junge Dame sprach, hatte die sich einem Kommilitonen zugewandt. Chris erinnerte sich: Barbarossa war der Spitzname des Umweltaktivisten Thorsten Kramer.
»Die Krähe ist einer von Kramers Leuten?«, fragte sie hastig.
Sie bekam keine Antwort. Das Pärchen entfernte sich und verschmolz mit der Masse.
Mit Transparenten und Tröten bewaffnet, setzten sich die Fracking Gegner in die Fahrzeuge und fuhren ab Richtung Innenstadt, begleitet von einem ansehnlichen Aufgebot der Stadtpolizei. Sie konnte sich nur wundern über die professionelle Organisation und Vorbereitung der Demo. Wer steckte dahinter? War dies die Handschrift der Gruppe Gaia? Sie rief Hinz an. Nachdem sie ihm die Krähe besonders ans Herz gelegt hatte, entschloss sie sich, ins Hotel zurückzukehren, um die gesammelten Informationen durch den BKA-Computer zu schicken.
Zwei Kollegen der Stadtpolizei standen mit einem älteren Mann im blauen Overall am Eingang. NAPHTAG = KILLER hatte jemand in schwarzer Farbe an die Wand gesprüht. Sie fand den Text nicht so spannend wie die Sonnenblume, dem Gerücht nach das Logo von Gaia. Vielleicht ein Trittbrettfahrer – vielleicht auch nicht. Sie war der geheimnisvollen Gruppe noch nie so nah gewesen, und doch wurde sie das Gefühl nicht los, bei jedem Griff ins Leere zu fassen.
Der Eindruck verstärkte sich während der Arbeit am Computer. Einzig die Identität der Krähe spuckte die BKA-Datenbank nach nervtötender Suche aus. Der Name Markus Hansen sagte ihr nichts, aber der Mann war aktenkundig wegen massiv überhöhter Geschwindigkeit in einem Kölner Vorort, wo er vor dem Studium gewohnt hatte. Also doch nicht so grün, das grüne T-Shirt. Herr Hansen war fällig für ein längeres Gespräch auf dem Präsidium. Sie griff zum Telefon, zögerte und legte es wieder weg. Ein Fanatiker wie Hansen würde nur unter massivem Druck auspacken, und dazu fehlten die rechtlichen Mittel. Es gab eine bessere Möglichkeit, mehr über die Gruppe Gaia und den flüchtigen Kramer alias Barbarossa zu erfahren. Das andere Flugblatt lag immer noch im Instrumentenkoffer. Open Stage in der ›Blechnerei‹, Frei-tagnacht. Der halbe Campus würde sich dort versammeln, und heute war Freitag.
Wegen der musikalischen Qualität der Darbietung auf der offenen Bühne hätte sie sich die Nacht in der ›Blechnerei‹ sparen können. Als Erstes fiel ihr der Mangel an Rhythmusgefühl des Trios auf, als Nächstes der Blasse mit den roten Wangen, dem sie den Flyer verdankte.
»Wo ist dein Saxofon?«, fragte er konsterniert.
»Ich will mich erst umhören.«
»Jammerschade.« Er wiegte ein paar hölzerne Takte mit der Musik. »Cool, was?«
Sie zog es vor, nicht zu antworten. Stattdessen blickte sie sich nach weiteren bekannten Gesichtern um. Hinz hatte ein halbes Dutzend Männer und Frauen abgelichtet, die möglicherweise zu den Organisatoren gehörten und nicht auf der offiziellen Liste der Behörde standen, welche die Demo bewilligt hatte.
»Suchst du jemanden?«
»Die Krähe.«
Er lachte verächtlich. »Was willst du denn von dem? Der linke Spinner würde sich nie hierher verirren, viel zu bourgeois für den. Komm lieber an unsern Tisch.«
Ihre Stimmung sank auf den Nullpunkt. Die Annahme, Hansen und seine Jünger hier zu treffen, erwies sich als Irrtum. Sie hatte um ziemlich genau 180° falsch gedacht. An diesem Abend versammelten sich nicht die Grünen und Linken in der ›Blechnerei‹, sondern die wirtschaftsfreundliche Sektion, BWL- und Jus-Studenten, Ökonomen und allerlei Arrivierte. Enttäuscht wollte sie das Lokal verlassen, als sie eine Bemerkung des Blassen zurückhielt:
»Dieses Gaia Pack geht mir so was von auf den Geist.«
»Was ist Gaia?«
»Das willst du lieber nicht wissen.«
Am Tisch des Blassen war schon reichlich Alkohol geflossen, was die Zungen löste. Das Schlagwort Gaia beschwor eine unerwartet heftige Attacke auf das »grüne Gesindel« herauf.
»Die haben die Demo doch nur organisiert, um den Sprengstoffanschlag zu rechtfertigen«, lallte einer, der sich nicht zwischen zwei Biergläsern entscheiden konnte und deshalb aus beiden trank.
»Du bist besoffen.«
»Recht hat er.«
Chris hörte sich noch ein paar tiefgründige Kommentare an, bevor sie nachhakte:
»Hat die Krähe etwas mit dem Anschlag zu tun?«
Eine Studentin, die sie schon im Stadtgarten gesehen hatte, schüttelte verächtlich den Kopf.
»Große Klappe, nichts dahinter«, fasste sie ihre Einschätzung von Markus Hansen alias die Krähe zusammen. »Die treibende Kraft hinter Gaia ist Barbarossa.«
»Den Namen habe ich schon gehört.«
»Im Geschichtsunterricht«, rief einer.
Er lachte als Einziger über seinen Scherz.
»Der Kerl ist allerdings genauso feige wie die andern – versteckt sich in seinem Stall.«
Chris spürte, wie sich die Nackenhaare sträubten. Bevor sie weiter fragen konnte, befand sich die Studentin auf dem Weg zur Toilette. Schlagartiger Harndrang trieb sie hinterher. Am Waschbecken konnte sie ihre Frage endlich stellen:
»Kann es sein, dass ich die Krähe auch im Stall finde?«
»Gut möglich. Soweit ich weiß, ist der Stall das Nest von Gaia.«
»Und wo finde ich diesen Stall?«
Die Studentin zuckte die Achseln. »Auf der Reichenau, mehr weiß ich nicht.«
Ein Stall auf der Insel Reichenau – eine genauere Adresse der Gruppe Gaia gab es nicht an diesem Abend. Überrascht stellte sie wenig später am Computer fest, dass die spärlichen Angaben genügten. Die Suche nach der Verbindung von Thorsten Kramer zur Insel Reichenau ergab einen eindeutigen Treffer. Die Familie Kramer hatte früher mehrmals Sommerferien auf einem Bauernhof bei Mittelzell verbracht, und auf diesem Hof gab es Wohnungen für Studenten. Zurzeit war dort eine junge Frau gemeldet, deren Foto Hinz an der Demo aufgenommen hatte.
»Na also«, sagte sie, streckte sich und griff zum Telefon.
Sie traute ihren Augen nicht, als sie morgens um vier beim Präsidium vorfuhr. Rappold hatte alles aufgeboten, was an diesem Samstag an Polizeikräften zur Verfügung stand, so schien es. Der sonst nicht eben flinke Kommissar wieselte zwischen den Einsatzwagen, Motorrädern und Technik Trucks hin und her, erteilte Anweisungen und konsultierte zwischendurch die Landkarte, als bereite er die Invasion der Insel Reichenau vor.
»Wo bleibt die Luftwaffe?«, fragte sie mit steinerner Miene.
Hinz hatte sein Gesicht weniger gut unter Kontrolle.
»Was gibt es da zu grinsen?«, fuhr der Kommissar ihn an. »Ich will die ganze Bande auf dem Präsidium. Keiner entwischt uns, verstanden?«
Sie nahm Rappold beiseite, um ungestört mit ihm sprechen zu können.
»Ich fürchte, wir werden die Leute zu früh aufscheuchen mit dieser Generalmobilmachung«, sagte sie nur für seine Ohren.
»Sprechen Sie es ruhig aus: Der Rappold spinnt. Ist mir scheißegal. Wir kassieren die Brüder jetzt!«
»Wie Sie meinen.«
Die Kavallerie setzte sich in Bewegung Richtung Reichenau. Sie bildete das Schlusslicht. Der heilige Pirmin bei der Brücke am Ende des Damms grüßte die Kolonne blinkender Polizeifahrzeuge freundlich, wenn auch etwas skeptisch. Er fragte sich wohl auch, ob es wirklich so viele Autos brauchte, um das kleine Paradies im Untersee einzunehmen. Nebelschwaden flüchteten über die verlassenen Felder. Je näher der einsame Stall bei Mittelzell rückte, desto lächerlicher erschien ihr die Übung. Sie dachte ernsthaft daran, umzukehren und Rappold die Schmach eines missglückten Einsatzes allein zu überlassen, als ihr ein Radfahrer auffiel, der gesenkten Hauptes vom Dorf her an der Kolonne vorbei schoss. Sie kannte die hagere Gestalt, trat hart auf die Bremse, wendete auf der schmalen Straße und nahm die Verfolgung auf. Ein Stück weit fuhr der Flüchtende auf der Mittelzeller Straße nach Süden, bis er in einen Feldweg abbog, auf dem sie ihm nicht folgen konnte. Sie studierte die Karte auf dem Navi. Falls der dürre Herr Hansen die Insel fluchtartig verlassen wollte, gab es in dieser Gegend nur eine Möglichkeit: die Schifflände. Sie bog an der nächsten Kreuzung rechts ab und trat kräftig aufs Gaspedal. Das Blaulicht brauchte sie nicht einzuschalten. Außer einem Bauern, der seinen Kartoffelacker umpflügte, schliefen alle Bewohner zu dieser frühen Stunde.
Er näherte sich dem Bootssteg, als sie auf dem Parkplatz wendete. Sie stieg aus und zückte den Dienstausweis.
»Polizei. Herr Hansen, wir müssen uns unterhalten.«
Er war abgestiegen. Wie hypnotisiert starrte er auf den Ausweis.
»Sie sind zu früh«, sagte sie lächelnd. »Es fährt noch kein Schiff.«
Erst als sie auf ihn zutrat, erinnerte er sich ans verhasste Wort Polizei. Plötzlich ragten Hörner aus ihrem Blondschopf. Er schlug einen Haken und rannte um sein Leben.
»Idiot.«
Sie schwang sich auf sein Rad und folgte ihm durch zwei enge Gassen aufs offene Feld, wo sie ihn schließlich stoppen konnte. Er stürzte. Sie kniete auf seinem Rücken, bog ihm unsanft die Arme nach hinten. Die Handschellen schnappten zu.
»Sie haben ihr Rad vergessen«, keuchte sie.
Ihr Knie musste ihn hart getroffen haben, da ihm die Pufferzone aus Fettgewebe fehlte. Dennoch lag er reglos unter ihr wie ein erlegtes Reh, ohne einen Ton von sich zu geben.
»Kann ich Sie loslassen, ohne dass sie wieder abhauen?«
Ein leises Stöhnen war die Antwort.
»War das ein Ja?«
Sie lockerte den Griff und ließ ihn aufstehen. Sein Blick streifte das Fahrrad, dann erinnerte er sich an die Handschellen und blieb stehen.
»Wo ist Thorsten Kramer alias Barbarossa?«
Er schien die Frage nicht gehört zu haben.
»Ich kann Sie auch gerne in Handschellen aufs Präsidium abführen, wenn Sie hier nicht mit mir sprechen wollen.«
Er blickte sie an wie ein begossener Pudel. Die Kunst der Rhetorik war auf der kurzen Flucht verloren gegangen. Immer noch nach einem Aus-weg suchend, den es nicht gab, bequemte er sich endlich zu fragen:
»Was wollen Sie?«
»Ich will, dass Sie meine Frage beantworten.«
»Welche Frage?«
»Sie haben Humor, Herr Hansen. Das gefällt mir.«
Zu seiner Überraschung löste sie die Handschellen und sagte:
»Nehmen Sie das Fahrrad und stoßen Sie es zum Parkplatz zurück. Wir unterhalten uns dort. Geht es so oder muss ich dem Rad erst die Luft rauslassen?«
Er trottete schweigend neben ihr her. Erst als sie das Fahrrad in den Kofferraum packte, protestierte er:
»Das dürfen Sie nicht!«
»Ist doch bequemer im Auto – und wir sind schneller in Konstanz.«
»Wieso Konstanz? Verdammt, ich will nicht nach Konstanz.«
»Sie sind aber dort gemeldet. Wohnen Sie denn nicht an ihrer Konstanzer Adresse?«
Der Ärger vernebelte sein Gehirn. Es dauerte eine Weile, bis er die Ironie verstand, dann gab er auf.
»Sie wissen ganz genau, wo ich wohne. Ihr Bullen schnüffelt doch jedem hinterher. Für euch gibt‘s so etwas wie ein Privatleben schon lang nicht mehr. Ihr wisst alles über uns.«
Sie schüttelte den Kopf. »Stimmt nicht. Wir wissen zum Beispiel nicht, wo Barbarossa steckt – also?«
Er widerstand ihrem durchdringenden Blick nur eine Sekunde lang, dann zuckte er die Achseln und murmelte:
»Mich brauchen Sie nicht zu fragen.« Nach kurzer Pause fügte er hinzu: »Das haben wir alles dieser verfluchten Judith zu verdanken.«
»Wer ist Judith?«
Er musterte sie misstrauisch.
»Sie wissen es wirklich nicht?«, fragte er zögernd.
»Klären Sie mich auf.«
»Ich kenne sie nur als Judith. Sie hat sich bei uns eingeschlichen, um an die Informationen über die NAPHTAG zu kommen, wenn Sie mich fragen. Sie wollte unbedingt in jener Nacht zur Bohrstelle.«
Chris glaubte, sich verhört zu haben. »In der Nacht des Anschlags?«
»Seither sind beide verschwunden.«
Sein Gesichtsausdruck verriet Ratlosigkeit. Sie würde später nachhaken.
»Um welche Informationen handelte es sich?«
»Nichts Weltbewegendes. Wir haben ein wenig recherchiert. Man muss ja wissen, wogegen man protestiert. Die war ganz scharf auf alles, was wir über das Fracking Projekt gesammelt hatten.«
»Wo ist das Material jetzt? Im Stall?«
Er nickte. »Das Wichtigste haben Sie sicher schon gestern auf den Transparenten gesehen.«
»Wo finde ich Judith?«
»Keine Ahnung, sagte ich doch schon.«
»Wo waren Sie in der Nacht des Anschlags?«
»Wir haben im Stall gepennt – alle außer Barbarossa und Judith. Waren ziemlich breit.«
»Das werden wir überprüfen.«
»Die andern werden es bezeugen. Kann ich jetzt gehen?«
»Sie müssen mit aufs Präsidium kommen, fürs Protokoll.«
Er antwortete mit einem Fluch, stieg aber ohne Widerstand ein.
Rappolds Kavallerie war am Aufbrechen. Der Kopf des Kommissars leuchtete wie der rote Traktor von Bauer Lorenz im Licht der aufgehenden Sonne. Kaum hatte er sie erblickt, rannte er in großen Sätzen auf sie zu. Sie zog es vor, sitzenzubleiben, kurbelte nur das Seitenfenster herunter.
»Himmel Donnerwetter, wo stecken Sie die ganze Zeit?«
Statt zu antworten, deutete sie auf ihren Beifahrer. »Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Das ist Herr Markus …«
»Hansen – die Krähe – ich weiß«, rief er. Sein Gesicht strahlte jetzt mit der Sonne um die Wette. »Der hat uns noch gefehlt.«
»Spinnt der?«, fragte Hansen leise, unruhig auf dem Sitz hin und her rutschend.
»Außer dem verdammten Barbarossa«, fügte Rappold düster hinzu.
»Sie vergessen Judith.«
»Wer ist Judith?«
»Ich glaube, das besprechen wir am besten auf dem Präsidium. Was sagt die Spusi?«
Rappolds Miene verfinsterte sich schlagartig. »Jede Menge Propagandamaterial und Spraydosen aber keine Spur von Sprengstoff.«
»Hinweise auf das Fracking Testgelände?«
»Bisher nur auf Papier.«
Sie hatte so etwas vermutet, hielt aber den Mund. Zudem kannte offenbar niemand den Aufenthaltsort des Hauptverdächtigen Thorsten Kramer.
»Die Damen und Herren der Gruppe Gaia werden schon noch auspa-cken auf dem Präsidium«, schloss Rappold grimmig. Er winkte einen uniformierten Kollegen vom Transporter herbei und zeigte auf den dürren Herrn Hansen. »Abführen!«
»Man sieht sich«, sagte sie zum Abschied.
Hansens Fluch verstand sie nicht, wollte ihn auch nicht verstehen.
ÜBERLINGEN
Pater Raphael erhob sich mit einem schweren Seufzer von seinem Schreibtisch und trat ans schmale Fenster. Der Ausblick auf den Klostergarten und die Felder erfrischte die Seele und belebte den Geist wie die Meditation im stillen Gebet. So hatte er die kurzen Pausen stets empfunden. Der Duft von Rosmarin und Thymian wehte vom Kräutergarten herein. Zwei Brüder zupften wuchernden Klee aus, der die zarte Zitronenmelisse zu verdrängen drohte. In der Ferne zog Bauer Weber, sein Gutsverwalter und treuer Freund, die Furchen für die Aussaat von Winterraps – ein Zeichen für das baldige Ende des Sommers.
Der Prior atmete tief durch, versuchte, sich dem pastoralen Bild ganz hinzugeben. Der innere Frieden aber wollte sich nicht einstellen. So sehr er sich bemühte, den Blick nach draußen zu richten, wanderte er doch wieder zurück zum Schreibtisch. Das offene Buch enthielt keine Psalmen oder Geschichten aus dem Heiligen Land, die Trost und Zuversicht verbreiteten. Es war das genaue Gegenteil der Bibel, eine endlose Reihe von Zahlen und Einzelposten, vor allem auf der Kostenseite. Der Brief der Bank, den ihm Bruder Anselm danebengelegt hatte, besiegelte das weltliche Elend endgültig.
Es klopfte. Bruder Anselm trat ein. Seine Miene verriet, dass ihn der Inhalt des Briefes ebenso bedrückte wie ihn selbst. Vielleicht noch stärker, denn als Cellerar war er der Herr der Zahlen, verantwortlich für die Finanzen des Klosters. Anselm sah den Brief, nickte betrübt und fragte:
»Was meint seine Exzellenz, der Bischof?«
»Die Mittel des Bistums sind ausgeschöpft, sagt er.«
»Gott stehe uns bei!«, rief Anselm entsetzt. »Die Bank stundet die Rückzahlung nicht länger. Wir haben noch einen Monat, nicht einmal ganz.«
»Ich habe den Brief gelesen, Bruder Anselm.«
Er wusste nicht, was er sonst sagen sollte. Rechnen war nie seine Stärke gewesen, aber er konnte sich denken, was es für das Kloster bedeutete, die 450‘000 Euro Schulden nicht zurückzahlen zu können. Der Betrieb müsste eingestellt werden. Das Gut käme unter den Hammer. Ohne weitere Einnahmen müsste das Kloster aufgegeben werden. Mariafeld wäre Geschichte. Er hatte sein halbes Leben hier verbracht, Wurzeln geschlagen wie die Linde im Klostergarten, die er bei der Ankunft gepflanzt hatte. Es war einer der Tage, an denen er die Last des Alters besonders stark spürte. Er fühlte sich matt und leer, am Ende seiner Kraft. Anselms Stimme unterbrach das lange Schweigen:
»Bruder Raphael?«
»Entschuldige, ich war in Gedanken versunken.«
»Du suchst nach einem Ausweg.«
Nicht einmal dazu reichte seine Energie.
»Auch ich habe lange nachgedacht«, fuhr Anselm weiter. »Am Ende sehe ich keinen andern Weg aus der Schuldenfalle als den, über den wir uns schon einmal gestritten haben.«
»Der Verkauf an den Chemiekonzern.«
»Der Verkauf eines Streifens Land an die NAPHTAG«, präzisierte Anselm. »Die 20‘000 Quadratmeter kann unser Gut ohne große Einschränkungen verkraften, und der Preis, den die NAPHTAG dafür zu zahlen bereit ist, würde all unsere finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Mariafeld wäre gerettet. Das ist es doch, was zählt.«
Er blickte seinem Cellerar tief in die Augen, versuchte zu ergründen, was Bruder Anselm sich dabei dachte. Hatte die Aussicht auf den zweifelhaften Geldsegen am Ende den Dämon Gier geweckt? In Anselms Augen lag nichts als bange Hoffnung auf eine Zukunft für das Kloster, ihr Zuhause und das ihrer Brüder.«
»Hundert Euro für den Quadratmeter sind ein fürstlicher Preis für Ackerland«, gab Anselm zu bedenken.
Dieses ungewöhnlich großzügige Angebot der NAPHTAG war nicht zuletzt ein Grund, weshalb er den Verkauf bisher kategorisch abgelehnt hatte. Wenn ein gewinnorientierter Konzern bereit war, zwei Millionen für 20‘000 Quadratmeter zu bezahlen, musste er entschlossen sein, alles aus dem Streifen Land zu pressen, was menschenmöglich war. Maria Herzogs Warnung vor Umweltschäden und giftigen Nebenwirkungen für das Klostergut überschattete für einen Augenblick alle andern Gedanken. Schlimmer noch: Musste er wirklich in letzter Not ausgerechnet mit einem Unternehmen Geschäfte machen, das Marias junge Firma sabotierte?
»Zwei Millionen Euro«, sagte Anselm eindringlich. »Eine solche Gelegenheit, unser Kloster zu retten, gibt es wohl nie wieder. Das sollten wir bedenken.«
Eine lange Pause entstand, bis das Marienglöcklein zur Vesper rief.
»Lass uns eine Nacht darüber schlafen«, sagte er.
»Wir haben nicht mehr viel Zeit.«
»Ich weiß – eine Nacht noch. Morgen werden wir uns mit Gottes Hilfe entscheiden. Gelobt sei Jesus Christus.«
»In Ewigkeit, amen.«
Sie verließen das Arbeitszimmer des Priors, um sich mit den andern Brüdern in die Kapelle zu begeben.
Luc Kaiser beobachtete vom winzigen Fenster seiner Zelle aus, wie die Mönche in die Kapelle strömten, und schüttelte den Kopf. Was zum Geier sollte am Klosterleben weniger strapaziös sein als die Arbeit am Handelspult?, fragte er sich. Die Glocken läuteten ununterbrochen wie sein Telefon, und die Brüder fanden kaum Zeit, richtig zu scheißen zwischen den vielen Gebeten und Gesängen. Um keinen Preis würde er mit denen tauschen, selbst wenn er an all die Märchen und Wunder der Kirche glaubte.
Naserümpfend dachte er ans bevorstehende Mahl im Refektorium, das ihn schon das erste Mal ans einzige Ferienlager auf der schwäbischen Alb erinnert hatte. Die Eltern glaubten damals, sein Interesse an der Natur zu wecken, erreichten allerdings nur, dass er sich mehr denn je nach seinem Computer sehnte, bis er es nicht mehr aushielt, ausbüxte und eine Großfahndung auslöste. Er hatte seinen Punkt gemacht, und der galt bis heute. Die paar Tage als Gast im Kloster Mariafeld waren dennoch seinem kranken Hirn entsprungen. Die drei Kollegen, die er zu diesem Extrem-Urlaub überredet hatte, Aktienhändler verschiedener Banken, mit denen er sonst nur am Computer verkehrte, fanden den Trip in die Steinzeit anfangs ganz unterhaltsam. Nach zwei Tagen ohne Telefon und stummen Essens am langen Holztisch statt vor dem Bildschirm zeigten sich allerdings auch bei ihnen erste Ermüdungserscheinungen. Nein, von Erholung konnte hier keine Rede sein. Das Klosterleben war selbst für Laien wie sie der pure Stress. Sein »Selbstfindungs-Wochenende« war ein Flop, eine ausgewachsene Schnapsidee.
Das Essen verlief in stummer Eintracht, wie es die Brüder offenbar liebten. Die Gäste kommunizierten über ironische Blicke, die ausnahmslos nur eines zum Ausdruck brachten: Wir müssen raus hier. Beim Verdauungsspaziergang im Kreuzgang fiel die Entscheidung.
»Heute Nacht brechen wir aus«, sagte Luc.
Ein Kollege hatte den Fluchtweg über die Lücke in der Mauer des Klostergartens entdeckt.
»Ohne Auto?«, wunderte sich ein anderer.
Luc erläuterte seinen Plan:
»Ich bestelle uns ein Taxi zum Kreisverkehr. Vom Kloster dorthin sind es nicht mehr als 500 Meter. Wir fahren nach Konstanz ins Casino, wo ihr eure Boni unter die Leute bringen könnt. Danach chillen im ›Lulu‹. Ihr seid eingeladen. Guter Plan?«
Der Plan würde ihn einige Tausender kosten aber er war es wert, wie ihm die leuchtenden Augen bestätigten. Einer fand trotzdem einen Einwand.
»Was sagt deine Heike zu einem Puffbesuch?«
»Gar nichts, wir sind ja im Kloster, schon vergessen?«
»Wie könnte ich.«
»Eben – und zudem ist die Heike zwar ein rattenscharfes Luder aber nur meine Anwältin.«
»Ja klar«, war das einstimmige Echo aller Drei.
Auf dem Weg zu den Zellen hielt ihn der Mönch zurück, der ihren Aufenthalt im Kloster organisierte. Bruder Anselm nannte er sich. Er war so etwas wie der CFO des Klosters, der Chief Financial Officer, soweit er verstanden hatte.
»Herr Kaiser, darf ich Sie kurz sprechen?«
Oha, war die Kunde von der geplanten Massenflucht schon bis zu ihm gedrungen? Sie setzten sich auf eine steinerne Bank am Ende des Kreuzgangs.
»Es ist mir etwas peinlich, Sie mit diesem Anliegen zu belästigen, begann der Bruder, schließlich sind Sie ja hergekommen, um Einkehr zu halten und etwas Ruhe und Abstand vom hektischen Alltag zu finden.«
»Das hat bisher ganz gut geklappt«, log er. »Was haben Sie auf dem Herzen, Bruder Anselm?«
Das Problem musste den Mönch sehr aufgewühlt haben, nach seinem Gesicht zu urteilen. Er war es nicht gewohnt, Emotionen hinter einem Pokerface zu verbergen. Es war eine andere Welt hinter diesen Klostermauern.
»Sie sind doch ein Finanzexperte«, sagte Anselm.
Er nickte überrascht.
»Und Sie haben sich auf Aktien im Energiesektor spezialisiert.«
»Sie sind erstaunlich gut über mich informiert. Muss ich mir Sorgen machen?«, fragte er schmunzelnd. »Ich muss allerdings ergänzen, dass diese Aktien nur ein Standbein meiner Firma darstellen. Ich bin ebenso aktiv im Bereich Risikofinanzierung für junge Unternehmen. Das ist sozusagen meine karitative Seite.«
Der Bruder antwortete mit einem ironischen Lächeln. Er konnte sich ausmalen, dass auch sein »karitativer« Hedgefonds satte Gewinne abwarf.
»Es liegt mir fern, Ihre Geschäftstätigkeit zu kommentieren«, versicherte Anselm. »Der Grund, weshalb ich Sie darauf anspreche, ist ein anderer. Ich gehe davon aus, dass Sie sich umfassend informieren, bevor Sie in eine Firma investieren.«
»Stimmt, der Aktienkurs und ein paar Kennzahlen allein sagen nichts aus über die Perspektiven einer Unternehmung.«
»Das dachte ich mir. Damit komme ich zu meinem Punkt. Der Konzern, der die Probebohrung bei Überlingen durchführt, möchte Land vom Klostergut kaufen.«
»Die NAPHTAG?«
Bruder Anselm nickte bedächtig. »Ich muss Sie bitten, diese Information vertraulich zu behandeln. Noch ist nichts entschieden. Sie werden verstehen, dass wir als exponierte Institution der Kirche genau darauf achten, mit wem wir Geschäfte machen.«
Allmählich begriff er, was Anselm von ihm wollte.
»Nun möchten Sie wissen, was ich von der NAPHTAG halte?«, fragte er grinsend.
»Ja.«
Ein Seufzer der Erleichterung entfuhr dem Mönch.
»Mit der NAPHTAG darf auch eine Institution der Kirche bedenkenlos Geschäfte tätigen«, beruhigte er. »Der Konzern ist ein absolut seriöses Unternehmen, das im Übrigen auf soliden finanziellen Füßen steht. Eine uneingeschränkte Kaufempfehlung würde der Fach-mann sagen.«
»Aber der Sprengstoffanschlag, die Verunsicherung über die Auswirkungen der Bohrungen …«
Luc lachte. »Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Nach dem Anschlag aufs Fracking Testgelände ist zwar der Aktienkurs etwas eingebrochen, aber soll ich Ihnen verraten, was das bedeutet?«
Bruder Anselm blickte ihn verwirrt an.
»Das bedeutet, dass der Titel jetzt deutlich unterbewertet ist. Wer jetzt kauft, wird bald einen schönen Gewinn einfahren.« Sibyllinisch fügte er hinzu: »Daran sind natürlich nur wir weltlichen Sünder interessiert.«
Zu seiner Überraschung widersprach der Mönch. Er schüttelte den Kopf und sagte:
»Auch ein Kloster braucht Geld, um zu überleben – leider. Sie würden uns also nicht abraten von einem Landverkauf an die NAPHTAG?«
»Ich wüsste nicht, aus welchem Grund.«
Anselm wirkte dennoch unsicher. »Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Bohrungen ein, wenn das Versuchsgelände auf unser Land ausgedehnt wird? Man hat uns gewarnt.«
»Ach die linken Angstmacher«, entgegnete er lachend. »Da wird meiner Meinung nach maßlos übertrieben. Wissen Sie, meine Schwester Emma befindet sich auch auf diesem Trip. Beweise für erhöhte Erdbebengefahr oder Verschmutzung des Grundwassers durch die hierzulande angewandte Technik hat sie bisher nicht geliefert.«
Bruder Anselm atmete erleichtert auf. Lucs geschultes Auge erkannte auf den ersten Blick: Der Finanzminister des Klosters Mariafeld wollte oder musste unbedingt verkaufen. Ein Plan reifte in Windeseile in ihm, eine Möglichkeit, sein zweifelhaftes Image als profitgieriger Finanzhai aufzupolieren.
»Wenn Sie möchten, kann sich unsere Juristin den Verkaufsvertrag ansehen, bevor Sie etwas unterschreiben. Sie hat große Erfahrung im Umgang mit solchen Konzernen. Das würde Sie natürlich nichts kosten.«
Das unerwartete Angebot erschreckte den braven Mönch. Sein Mund klappte auf und zu. Ihm fehlten die Worte. Luc stand auf.
»Überlegen Sie sich‘s. Ich bin ja noch bis morgen Nachmittag da.«
Damit zog er sich in die Zelle zurück, um den nächtlichen Ausbruch vorzubereiten.
Am nächsten Morgen schritt Pater Raphael unruhig in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Fünf Schritte hin, fünf Schritte her, mehr waren nicht möglich. Jeden Augenblick würde sein Cellerar anklopfen, und er wusste noch immer nicht, wie er entscheiden sollte. Gab es überhaupt eine Alternative? Umschuldung, den teuren Kredit umwandeln – vielleicht war das eine Möglichkeit, die Zeit bis zum Verkauf der Ernte zu überbrücken. Der Gutsverwalter rechnete nach der Missernte im letzten Jahr heuer mit gutem Ertrag. Er dankte dem Herrn für diesen Hoffnungsschimmer.
Bruder Anselm klopfte an und trat ein, leichten Fußes, mit entspanntem Lächeln im Gesicht, wie er es bei ihm seit Langem vermisst hatte.
»Gestern Abend habe ich ein interessantes Gespräch geführt«, platzte er heraus.
»Ich höre.«
»Ich habe mich mit einem unserer Gäste unterhalten, Luc Kaiser. Er ist Finanzspezialist, und es stellte sich heraus, dass er die NAPHTAG sehr gut kennt.«
Der Prior horchte auf. »Rein zufällig nehme ich an.«
»Na ja – ich habe den Konzern wohl erwähnt wegen der Bohrung.«
»Und weiter?«
»Herr Kaiser hat mir bestätigt, dass die NAPHTAG einen makellosen Ruf genießt. Ich schließe daraus, dass wir uns auf die Aussagen und Zusicherungen des Konzerns voll und ganz verlassen können.«
»Können wir uns denn auch auf diesen Herrn Kaiser verlassen?«
Bruder Anselm nickte zuversichtlich. »Er ist ein ausgewiesener Fachmann.« Nach kurzer Pause fügte er an: »Und er macht einen durchaus ehrlichen Eindruck.«
»Hoffen wir, dass du dich nicht täuschst, Bruder Anselm. Du möchtest also verkaufen?«
»Wir würden das Richtige tun.«
Er war noch nicht überzeugt und erwähnte die Idee mit der Umschuldung. Anselm wiegelte sofort ab.
»Ich habe diese Möglichkeit zuallererst durchgerechnet. Wir müssten einen hohen Preis bezahlen und würden trotzdem weiter auf den Schulden sitzen, sollten wir überhaupt einen neuen Kredit erhalten. Und was passiert, wenn die Zinsen wieder anziehen? Nein, das ist leider keine Lösung.«
Die Vorstellung, den Schuldenberg und die Zinslast durch den Verkauf mit einem Schlag loszuwerden, war bestechend. Da musste er dem Cellerar zustimmen. Obwohl er innerlich entschieden hatte, zögerte er mit der Antwort. Schließlich sagte er:
»Ich möchte mir selbst ein Bild über Herrn Kaiser machen, bevor ich dem Verkauf zustimmen kann.«
»Gut, tu das, Bruder, aber du musst dich beeilen. Die Gäste reisen nach dem Mittagessen ab.«
Luc blickte dem Prior verwundert nach. Die Unterredung mit dem alten Herrn hatte keine drei Minuten gedauert und im Wesentlichen aus forschenden Blicken bestanden. Sollte es eine verkappte Standpauke sein wegen des Ausflugs nach Konstanz, obwohl er nichts dergleichen angedeutet hatte? Er wurde nicht schlau aus diesem Heiligen. Es war Zeit zu packen. Auf dem Flur fing ihn Bruder Anselm ab.
»Ich möchte mich bedanken«, sagte er.
»Wofür?«
»Für Ihren Rat gestern Abend. Der Prior hat sich jetzt doch entschlossen, das Stück Land an die NAPHTAG zu verkaufen – vorausgesetzt, seine Exzellenz der Bischof stimmt zu.«
»Rechnen Sie mit der Zustimmung des Bistums?«
»Oh ja, das ist nur eine Formalität. Schließlich geht es um die Zukunft des Klosters.«
»Sie werden also das Geschäft durchziehen?«
Bruder Anselm nickte lächelnd.
»Das freut mich, obwohl es mich eigentlich gar nichts angeht.«
»Ohne Ihren Rat …«
Den Rest sprach der Mönch nicht aus. Luc wollte sich verabschieden, doch Anselm zögerte.
»Darf ich auf Ihr Angebot zurückkommen, Herr Kaiser?«
Luc schmunzelte. »Die Anwältin – selbstverständlich, das Angebot steht.«
Anselm dankte beinahe unterwürfig. »Wir sind manchmal etwas weltfremd hinter den Klostermauern«, gab er zu. »Es wäre in der Tat äußerst hilfreich, wenn uns jemand beraten könnte, der sich auskennt. Zum Beispiel über den fairen Preis.«
Die Anwältin Heike Sommer kannte sich in Land- und Immobilienpreisen, Gesetzen und anderen Dingen aus, die sich der gute Bruder Anselm in seinen wildesten Träumen nicht vorstellen konnte.
»Darf ich fragen, wie viel die NAPHTAG zu zahlen bereit ist?«
Anselm antwortete ohne Zögern:
»Hundert Euro pro Quadratmeter. Es geht um 20‘000 Quadratmeter.«
»Das ist nicht sehr viel.«
Anselm erschrak. »Wie bitte?«
»Land in dieser Gegend für profitable industrielle Nutzung müsste eigentlich teurer sein.«
»Aber …«
Sein Einwand hatte den Bruder sichtlich erschüttert.
»Sie müssen pokern«, sagte er mit ernster Miene. »Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das zuwiderläuft, aber es geht nicht anders. Die NAPHTAG wird es auch tun. Verlangen Sie einen deutlich höheren Preis, sagen wir 120 Euro.«
Bruder Anselm wusste nicht, wohin mit den Augen. Sein Argument stürzte den Gottesmann in einen schier unlösbaren Gewissenskonflikt. Das Kloster brauchte dringend Geld, stand auf seinem Gesicht geschrieben. Feilschen – was für ihn als Händler tägliches Brot war, musste dem Mönch wie ein Elixier des Teufels erscheinen. Plötzlich streifte Luc ein verwegener Gedanke.
»Es könnte natürlich sein, dass die NAPHTAG auf den hundert Euro beharrt«, fuhr er fort. »In diesem Fall rate ich Ihnen, in NAPHTAG Aktien zu investieren.«
Damit hatte er Anselm endgültig überfordert. Bevor der Mönch die Sprache wieder fand, erläuterte er den Plan:
»Ich will damit nicht sagen, sie sollen Aktien kaufen. Es gibt einen viel eleganteren Weg. Vereinbaren Sie ein Paket Gratisoptionen. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick.«
Er ging in seine Zelle, schaltete das Handy ein und hielt es aus dem Fenster, wo ein Empfang möglich war. Nach wenigen Klicks kehrte er zu Anselm zurück, hielt ihm den Bildschirm hin und erklärte die Zahlen:
»Diese Anzahl Kaufoptionen auf NAPHTAG Aktien entsprechen aus heutiger Sicht einem Wert von rund 200‘000 Euro. Die NAPHTAG würde Ihnen also die zwei Millionen Cash bezahlen für das Land plus 200‘000 Euro in Form von Optionsscheinen. Da der Kurs der Aktie unterbewertet ist, wird der Wert der Optionen binnen kurzer Zeit steigen. Sie können ohne Weiteres mit einer Verdoppelung in den nächsten zwei Wochen rechnen. Heißt im Klartext: Sie werden die Optionen für 400‘000 Euro verkaufen oder ausüben können. Insgesamt hätte Ihnen die NAPHTAG also 2.4 statt zwei Millionen bezahlt, was einem Preis von 120 Euro pro Quadratmeter entspricht. Können Sie mir folgen?«
»Rechnerisch schon, aber wo ist der Haken?«
»In diesem Fall gibt es eigentlich keinen. Ihr einziges Risiko ist, dass es bei den zwei Millionen Cash bleibt, die Ihnen der Konzern geboten hat. Die Optionen könnten wertlos verfallen, falls der Aktienpreis wider Erwarten sinkt, aber Sie haben ja auch nichts dafür bezahlt, also verlieren Sie nichts.«
Eine lange Pause entstand, bis Anselm misstrauisch fragte:
»Und Sie glauben, die NAPHTAG lässt sich auf diesen Handel ein?«
»Wenn meine Anwältin verhandelt, bestimmt«, antwortete er grinsend.
KONSTANZ WOLLMATINGEN
Eine neue Nachricht tropfte auf den Bildschirm des Laptops. Das Ge-räusch erinnerte verblüffend an den Wassertropfen aus einem undichten Hahn, der in die Blechwanne fällt und zerplatzt. Maria Herzog fand ihre Wahl des Geräuschs für die Chats mit Emma genial. Der tropfende Hahn war die perfekte akustische Metapher für den stundenlang locker vor sich hin tröpfelnden Austausch kurzer Textmeldungen in den Nächten, die sie nicht zusammen verbringen konnten. Sie steckte die pH-Messsonde auf den Glaszylinder, bevor sie Emmas Text las.
»Julian schläft endlich. Vermisse dich.«
»Solltest du auch – schlafen meine ich«, tippte sie als Antwort. »Morgen gibt es etwas zu feiern.«
Wieder fiel ein Tropfen. »Bist du sicher?«
Sie kontrollierte den pH-Wert. 4.05: Zu sauer, stellte sie fest und wollte korrigieren, doch ein Knacks schreckte sie auf. Sie wähnte sich allein im Haus. Die Kollegen hatten das Labor und die Büros längst verlassen. Außer dem Licht ihrer Tischlampe herrschte stockfinstere Nacht. Das fremdartige Geräusch war vom Flur ins Labor gedrungen. Sie schaltete die Deckenbeleuchtung an.
»Felix, bist du das?«
Wer sonst sollte um diese Zeit im Haus sein? Das Geräusch wiederholte sich, diesmal lauter, gefolgt vom vertrauten Knarren einer Tür. Es kam von draußen. Das Kippfenster zum Hof stand offen. Jemand machte sich an der Tür des Schuppens zu schaffen. Sie rannte ums Haus. Das Schloss des Lagers für Stroh und unbedenkliche Chemikalien wie Alkohol war aufgebrochen. Der Strahl einer Taschenlampe strich über die Regale. Das Licht erlosch sofort, als sie die Tür aufstieß.
»Polizei! Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!«, rief sie, weil ihr im ersten Schreck nichts anderes einfiel.
Ihr Herz wollte aus der Brust springen. Es blieb ruhig. Sie nahm allen Mut zusammen und rief noch einmal:
»Kommen Sie heraus!«
Vorsichtig trat sie in die Öffnung, um den Lichtschalter zu betätigen. Die Tür schlug ihr ins Gesicht und schleuderte sie hinaus. Sie fiel auf den rauen Teer, sah aus den Augenwinkeln, wie eine schwarze Gestalt davonrannte. Sie hörte eine Autotür zuschlagen, Motorengeräusch, dann kehrte unheimliche Stille ein. Ächzend erhob sie sich. Der linke Ellenbogen schmerzte. Als sie darüber strich, spürte sie Blut. Im Licht der Lampe des Schuppens besah sie sich den Schaden. Eine Schürfwunde, nicht weiter schlimm. Trotzdem schmerzte der Arm, als wäre er gebrochen.
Im Schuppen fehlte auf den ersten Blick nichts, aber das Schloss musste ausgetauscht werden. Es gab nichts wirklich Wertvolles im Lager, jedenfalls keine Drogen oder Chemikalien, die man zur Herstellung von Crystal Meth oder Ähnlichem benutzen könnte. Beim Alkohol handelte es sich um Industriesprit. Er war mit Pyridin versetzt und völlig ungenießbar – und alle Flaschen waren noch da. Was wollte der Kerl? Sie hatte einen Mann gesehen, dessen war sie sich ziemlich sicher: kräftige Statur, kein Teenager im Hoodie. Der Gedanke, die Polizei zu rufen, streifte sie nur kurz. Sie hatte den Einbrecher rechtzeitig in die Flucht geschlagen, und für eine Fahndung würden ihre Angaben sowieso nicht reichen. Sie wollte sich und dem Staat das Anlegen einer weiteren sinnlosen Akte ersparen. Dennoch prüfte sie genau, ob der nächtliche Besucher auch Spuren im Haus hinterlassen hatte. Die Schlösser waren alle intakt. Kein Wunder, denn sie ließ die Türen stets unverschlossen, während sie allein im Labor arbeitete. Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Falls ihr wider Erwarten etwas zustieß bei der Arbeit, sollten Feuerwehr und Rettung ungehinderten Zugang haben. Das galt natürlich auch für ungebetene nächtliche Besucher. War der Kerl im Haus gewesen? Hatte er sie heimlich beobachtet?
Fröstelnd setzte sie sich wieder an den Computer. Der virtuelle Wasserhahn tropfte jetzt beinahe ohne Unterlass.
»Was ist los? Schläfst du? Wach auf! Ist alles in Ordnung? Soll ich vorbeikommen? WZTWD?«
Emmas Texte füllten den ganzen Bildschirm. Sie beantwortete die letzte Frage – wo zum Teufel warst du? – nicht, schrieb nur:
»AKLA« – »Alles klar.«
Der Timer am Bioreaktor piepste. Sie stieß eine Verwünschung aus, sprang auf und entnahm mit zittriger Hand eine Probe zur Untersuchung. Hoffnungslos, dachte sie ärgerlich, als sie ein paar Tropfen der gelblichen Flüssigkeit aus dem Reaktor auf den Objektträger des Chromatografen träufelte. Durch das Intermezzo mit dem Einbrecher hatte sie vergessen, den pH-Wert rechtzeitig zu korrigieren. Nur um auch diesen Versuch sauber abzuschließen, schaltete sie das Gerät ein. Das Resultat interessierte sie kaum. Sie wandte sich wieder dem Chat zu, bis ein leises Klingeln das Ende der Analyse ankündigte. Sie drückte automatisch auf die Taste, um die Grafik auszudrucken, die der Chromatograf berechnet hatte. Sie warf einen flüchtigen Blick darauf, und ihr Herz blieb stehen. Dann begann es zu pochen, als stünde sie zwei Einbrechern mit Krummsäbeln gegenüber. Was sie sah, war unmöglich. Es musste ein Irrtum sein.
Hastig überprüfte sie die Versuchsanordnung, kontrollierte Zusammensetzung, Temperatur, chemische und physikalische Eigenschaften des Gemischs aus Nährstoffen, Enzymen und Mikroben im Tank. Sie las die Messwerte ein zweites und drittes Mal ab und fand keinen Fehler außer dem falschen pH-Wert. Es musste am Chromatografen liegen. Sie nahm sich die Zeit, das empfindliche Gerät vollständig neu zu kalibrieren. Die Grafik, die es danach produzierte, war identisch mit der ersten Analyse. Der Gedanke, keinen Fehler zu finden, schmerzte wie ihr Ellenbogen. Vielleicht sollte sie eine Nacht darüber schlafen und das Ganze morgen in Ruhe wiederholen – aber wer wollte schlafen bei diesem Output? Die banale Zeichnung aus farbigen Kurven, die nur Fachleute verstanden, war es wert, einst auf ihrem Grabstein verewigt zu werden wie Diracs Gleichung der Quantenmechanik in der Westminster Abbey. Die Kurven behaupteten nichts Geringeres, als dass ihre programmierten Bakterien das Stroh vom Mariafeld zu 85 Prozent in Bernsteinsäure umgewandelt hatten, also praktisch vollständig. Dieser Wirkungsgrad entsprach dem Doppelten aller bisherigen Versuche – und war zwanzigmal besser als alles, was die Konkurrenz je zustande gebracht hatte.
Obwohl der digitale Hahn des Chats zu tropfen aufgehört hatte, begann sie wie besessen auf die Tastatur zu hämmern. Sie fühlte sich leicht und frei wie nie, befreit, als wäre sie am Ende eines langen Tunnels angelangt, träte zum ersten Mal nach jahrelanger Suche in der Finsternis wieder ins grelle Tageslicht und atmete frische Luft. Die Suche war zu Ende, nichts weniger behauptete das Blatt Papier aus dem Chromatografen. Sie versuchte, die Bedeutung der Entdeckung in Worte zu fassen, die ihre Geliebte verstehen konnte, und war froh, sie nicht am Telefon zu haben. Schreibend konnte sie sich besser konzentrieren, drückte sich präziser aus. Die Erzeugung der wichtigen Grundchemikalie Bernsteinsäure aus nachwachsenden Rohstoffen war nun nicht nur möglich, sondern auch wesentlich kostengünstiger als die klassische Herstellung in der chemischen Industrie. Kunststoffe, Farben und Baumaterialien aus Stroh, unabhängig von Erdöl, Erdgas und Fracking – der Abschied von der Petrochemie begann in dieser Nacht in ihrem Labor.
Kaum war sie fertig mit dem Tippen ihrer Erfolgsgeschichte, fiel der nächste Tropfen.
»Was willst du mir eigentlich sagen?«
»Ach Emma«, seufzte sie, »es gäbe noch so viel zu sagen.«
Lächelnd sandte sie einen letzten Text übers Wasser ins Paradies:
»Schlaf gut, Liebes.«