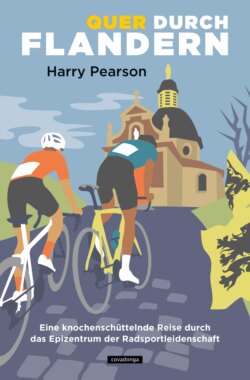Читать книгу Quer durch Flandern - Harry Pearson - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPROLOG
Schornsteine aus Backstein, Männer aus Eisen
»Der Geruch einer frisch geöffneten Flasche Bier ist der Geruch meines Landes«, sagte der große, in Lüttich geborene Schriftsteller Georges Simenon. Wenn der Duft von Belgien der von gutem Bier ist, dann ist der prägende Klang der Nation das Rauschen von Fahrradreifen auf nassen Straßen, das Pfeifen des Windes durch Speichen, das dröhnende Rattern von Stahlrahmen auf Kopfsteinpflaster.
Der Radrennsport ist in ganz Belgien wahnsinnig populär, aber im Norden, in der niederländischsprachigen Hälfte des Landes, geht es weit darüber hinaus. Er ist Teil der nationalen Identität, geliebt von Jung und Alt, Mann und Frau. Gemessen an der Zahl der Fans mag Fußball populärer sein, aber was das Selbstverständnis der Flamen anbelangt, gibt es kaum einen Zweifel, dass Radsport das Maß aller Dinge ist. In kleinen flämischen Städtchen spannen Damen mittleren Alters beim Mittagessen Lotto-Soudal-Schirme auf, kleine Kinder tragen Wollmützen, die ihre Liebe zu Tom Boonen kundtun, und junge Mädchen fertigen Capes aus Flaggen, die mit Fotos des Cyclocross-Genies Sven Nys geschmückt sind, des »Kannibalen aus Baal«. Im Vergleich dazu fallen ein paar KAA-Gent-Schals und der eine oder andere Club-Brügge-Autoaufkleber nicht weiter ins Gewicht.
Flandern ohne Radsport kann man sich ebenso wenig vorstellen wie Frankreich ohne Knoblauch oder Deutschland ohne Würstchen. Selbst die wenigen Flamen, die sich nicht für Radrennen interessieren, können, wenn man sie drängt, die Namen der heroischen Fahrer der Vergangenheit – Buysse, Maes, Van Steenbergen, Schotte, Van Looy, Van Springel, De Vlaeminck, Godefroot, Maertens, Van Impe, Museeuw – so mühelos herunterbeten wie ein Jesuitenpater den Katechismus. Der Radsport ist ein Teil ihrer Seele und ihrer DNA. Er ist so unausweichlich wie das Wetter.
Es gibt nur etwa fünf Millionen Flamen, verteilt über die nordbelgischen Provinzen Ost- und Westflandern, Antwerpen, Limburg und Flämisch-Brabant, doch ihre Radrennfahrer sind seit mehr als einem Jahrhundert eine dominante Macht in einem globalen Sport und heimsen bei Eintagesklassikern und Grand Tours Erfolge in einem Maße ein, das auch Nationen, die zehn- oder fünfzehnmal größer sind, zur Ehre gereichen würde. Flämische Fahrer bringen es auf 18 Siege bei den drei großen Landesrundfahrten, 46 bei Paris–Roubaix (einem Rennen, das kein britischer oder nordamerikanischer Fahrer je gewonnen hat), elf bei Mailand– Sanremo (französische Fahrer haben nur zweimal häufiger gewonnen, spanische sechsmal weniger) und 20 im Straßenrennen der Profis bei UCI-Weltmeisterschaften (einer mehr als Italien und zwölf mehr als Frankreich). Abgesehen von Neuseelands Erfolgsbilanz im Rugby gibt es in der Welt des Sports kaum etwas Vergleichbares.
Dass es dazu kam, liegt in der Persönlichkeit der Flamen begründet. Flamen sind Nordländer. Sie mögen Bier, Fritten und Lamentieren. Sie leben drinnen, verborgen hinter Tüllgardinen und dabei seltsamen Leidenschaften frönend, etwa für Kakteen und Chicorée, Singvögel und Tauben. Wie alle Nordländer hegen sie einen Groll gegen den Süden, der einem tief verwurzelten, jedoch nie eingestandenen Minderwertigkeitsgefühl entstammen mag. In seiner wunderbaren Dokumentation Magnetic North stellt der englische Schriftsteller und Filmemacher Jonathan Meades fest, dass uns Nordländern die Überlegenheit des warmen Südens seit der Geburt eingetrichtert wird. Die mediterrane Lebensart, die Kunst, die Architektur, das Essen, der Sex, das alles ist so viel geschmackvoller und schöner als alles, was wir zuwege bringen. Und so lieben Nordländer den Norden mit der gleichen erbitterten Abwehrhaltung, mit der eine Mutter ein hässliches Kind liebt. Wie der große Jacques Brel (aus Schaarbeek stammend, einem Vorort von Brüssel) in seiner Hymne an den Norden, »La Bière«, sang: »Er ist voller Horizonte / die einen in den Wahnsinn treiben / Aber Alkohol ist blond / Der Teufel ist unser / Und Menschen ohne Hoffnung / brauchen sie beide.« In Flandern brauchten sie außerdem den Radsport, aber darauf fiel wohl selbst Jacques Brel kein passender Reim ein.
Jede Nation nutzt Sport, um die Charaktereigenschaften zu offenbaren, die sie am meisten bewundert. Radsport ist vor allem eine brutale Prüfung der Ausdauer. Es geht um Leiden, Schmerz und Mühsal. Genau wie die Landwirtschaft – über Jahrhunderte der Grundpfeiler der flämischen Ökonomie – wird dieser Sport von der jeweiligen Landschaft bestimmt und ist den Wechselfällen der Witterung anheimgegeben. Es nützt nichts, sich über den beißenden Wind zu beklagen, den speicheldicken Regen, den matschigen, sauren Boden, die eisige Luft, die die Gelenke anschwellen lässt, das Kopfsteinpflaster, das einen durchrüttelt, bis einem die Nase blutet – man geht einfach raus und zieht die Sache durch. Die Flamen mögen Zähigkeit, Starrsinn und Tapferkeit: Schneid, Eier und Rotz. Ihre größten Radrennen – Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen (Quer durch Flandern), E3 Harelbeke, Gent–Wevelgem, Ronde van Vlaanderen (die Flandern-Rundfahrt) und der Scheldeprijs – finden allesamt zwischen Ende Februar und Anfang April statt. Man hätte sie genauso gut im Spätsommer nach den großen Rundfahrten ausrichten können, wenn das Wetter warm und mild ist, so dass sich das Kopfsteinpflaster trocken und vergleichsweise harmlos präsentiert und es keine großen Pfützen gibt, um all die Schlaglöcher zu verbergen, die tief genug wären, um ein Wildschwein darin zu fangen. Aber, hey, wo bliebe da der Spaß?
Die Beziehung zwischen den Flamen und dem Radrennsport ist eine große Romanze, aber wie alle Liebesaffären begann auch diese mit dem Kennenlernen.
Karel Van Wijnendaele kam 1882 in Bakvoorde, einem Dorf zwischen Torhout und Lichtervelde in Westflandern, als Carolus Steyaert zur Welt. Er war das fünfte von 15 Kindern und lernte nie seinen leiblichen Vater kennen, einen Flachsarbeiter, der starb, als Carolus 18 Monate alt war. Seine Mutter heiratete bald wieder, einen Bauern namens Richard Defreyne, und sie zog mit ihren fünf Kindern in sein Haus in Torhout. Nicht weit entfernt befand sich Schloss Wijnendaele, von dem Carolus später sein Pseudonym entlehnte.
Heute ist Torhout eine typische verschlafene flämische Kleinstadt, die Art von Ortschaft, wo alte Damen Kissen auf die Fensterbänke im Obergeschoss legen und, sich hin und wieder ernst den Busen richtend, das Kommen und Gehen der Nachbarn beobachten. Torhout hat seinen eigenen speziellen, feurigen Senf – die Flamen mögen scharfen Senf – und geht man vom Bahnhof in Richtung Zentrum, passiert man die Billardhalle Smoking Cue, das Café Zwarte Leeuw (das sich als Stammkneipe der Fußballfans von Torhout 1992 anpreist) und die Criterium Bar, deren Fenster mit Karikaturen von Peter Van Petegem geschmückt sind, dem »Zwarte van Brakel« (frei übersetzt dem »Schwarzhaarigen aus Brakel«), seines Zeichens zweimaliger Sieger der Ronde van Vlaanderen. Die Gedenktafel, die an die Verbindung der Stadt mit dem Mann erinnert, der dieses Rennen erfand, hängt an einem unscheinbaren Wohnblock neben einer Apotheke, deren Schaufensterauslage vornehmlich aus Abführmitteln besteht.
In einem benachbarten Café, wo im Radio gerade eine niederländischsprachige Version des Country & Western-Hits »Blanket on the Ground« lief, bestellte ich einen Kaffee mit Sahne. Der Kellner war Anfang 20 und trug ein schwarzes Motörhead-T-Shirt. Ich teilte ihm mit, dass ich Brite sei und mich für Radsport interessiere. »Nun«, sagte er, »es gab einen Typen hier aus der Gegend, der mal dieses irre Rennen gewonnen hat, das ihr da drüben habt.« Es stellte sich heraus, dass er Eddy Vanhaerens meinte, der 1978 als erster und einziger Nicht-Brite überhaupt London– Holyhead gewinnen konnte – mit 427 Kilometern das längste Eintagesrennen der Welt. Der Kellner sagte, er interessiere sich nicht besonders für Radsport. Er habe bloß diesen Onkel, der sich ständig darüber unterhalten wollte. »Ich würde lieber über Rock’n’Roll reden, wissen Sie, aber hier ist es, als wäre Tom Boonen Sänger der Foo Fighters oder so«, sagte er. Es stimmte, Boonen war tatsächlich eine überaus präsente Figur in Flanderns Kultur- und Sportlandschaft. Seine Popularität war so groß, dass ich manchmal dachte: Um in England etwas Vergleichbares zu erleben, müsste vermutlich ein hübscher Pop-Barde mit Castingshow-Fame das Siegtor im WM-Finale erzielen und es Prinzessin Diana widmen, während er gleichzeitig ein Kätzchen vor dem Ertrinken rettet. Ich fragte den Kellner, ob er glaube, dass Boonen in diesem Jahr wieder die Ronde van Vlaanderen gewinnen könnte, als erster Fahrer in der Geschichte des Rennens zum vierten Mal. Es war eine Frage, die sich jeder in Flandern stellte, so normal, als würde man sich bei einem Engländer erkundigen, ob er glaube, dass es später regnet. Der Kellner, der sich nicht für Radsport interessierte, zuckte die Achseln. »Ich glaube nicht«, sagte er. »Um die Ronde zu gewinnen, braucht man …«. Er schlug drei-, viermal mit der Faust in die linke Handfläche. »Sie wissen schon, so was wie einen großen Kolben. Doch dafür ist er inzwischen zu alt. Aber vielleicht wird’s was bei Paris–Roubaix.«
Van Wijnendaele ging mit 14 von der Schule in Torhout ab (relativ spät für damalige flämische Verhältnisse, wo die meisten Jungen schon mit zwölf zu arbeiten anfingen) und fand nach einer kurzen Phase, die er auf dem elterlichen Bauernhof zubrachte, Anstellung als Laufbursche für eine Apotheke, als Lieferjunge für eine Bäckerei, als Tellerwäscher, als Programmheft-Verkäufer und schließlich als Anwaltsgehilfe. Es war ein Besuch der Radrennbahn in Ostende im Jahr 1897, der sein Leben veränderte. Den Weltmeister Robert Protin – der aus Wallonien stammte, dem südlichen, französischsprachigen Teil von Belgien – in Aktion zu erleben, spornte ihn an, selbst Radprofi zu werden. Er kaufte sich ein Rad, legte sich den Wettkampfnamen Marc Bolle zu und brachte die nächsten drei Jahre mit vergeblichen Versuchen zu, Radrennen zu gewinnen. Irgendwann sah er ein, dass es offenbar nicht reichte, um jemals Profirennen bestreiten zu können, doch Marc Bolle befand, dass er doch zumindest darüber schreiben könnte. Er begann sich etwas dazuzuverdienen, indem er Texte bei verschiedenen flämischen Zeitungen einreichte, und es dauerte nicht lange, bis er für sie als Reporter über Radrennen berichtete. Nun unter dem Namen Karel Van Wijnendaele.
Zu dem Zeitpunkt war Radfahren in Flandern nur eine Randsportart, die an Beliebtheit weit hinter Fußball rangierte. Dies alles änderte sich mit der Tour de France. Das große mehrwöchige Rennen durchs Nachbarland war erstmals im Jahr 1903 ausgetragen worden und gleich bei der Debütausgabe waren die Flamen dabei gewesen: Julien Lootens aus Wevelgem und Marcel Kerff aus Voeren ganz im Osten der Provinz Limburg hatten beide die 2.428 Kilometer lange Strecke absolviert. Ein paar Jahre lang war der erfolgreichste belgische Fahrer Aloïs Catteau, ein Frankophoner aus Tourcoing gleich nördlich von Roubaix, und es dauerte bis 1909, ehe die Flamen bei der Tour wirklich von sich reden machten. In jenem Jahr führte die erste Etappe von Paris nach Roubaix über das nordfranzösische Kopfsteinpflaster. Das flämische Aufgebot attackierte den ganzen Tag über, trotz oder vielleicht gerade wegen des unsäglich holprigen Untergrunds, und holte in Person von Cyrille Van Hauwaert seinen ersten Etappensieg. Van Hauwaert, der aus Moorslede in Westflandern stammte und dessen fein gezwirbelter Schnurrbart und makellos gebogene Brauen suggerierten, er mochte in Gamaschen gefahren sein, hatte bereits Bordeaux–Paris, Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix gewonnen. 1910 wurde er dann Vierter der Tour de France, womit er mit Fug und Recht für sich beanspruchen konnte, der Erste in der Gilde der großen flämischen Radrennfahrer zu sein.
Es dauerte jedoch bis ins Jahr 1912, als Odiel Defraeye auf der Tour-Bühne erschien, dass die flämische Liebesaffäre mit dem Radsport wirklich Funken schlug. Defraeye kam aus Rumbeke am Rande von Roeselare. Er arbeitete als Botenjunge in einer Bürstenfabrik, für die er mit dem Fahrrad Telegramme und Pakete auslieferte, wobei er bisweilen 200 Kilometer am Tag zurücklegte. Als Amateur heimste er Preise über Preise ein, in einer Manier, die man heute vielleicht merckxianisch nennen würde. Nach seinem Militärdienst zog Defraeye in den Süden und schloss sich der renommierten französischen Alcyon-Mannschaft an, deren Trikots so blau waren wie der Eisvogel, der den Rädern des Unternehmens den Namen gab. So wie viele Flamen sprach Defraeye kaum Französisch, und da Alcyon das kleine Nachbarland Belgien nicht als wichtigen Markt betrachtete, sahen sie wenig Nutzen darin, ihn für die großen Landesrundfahrten zu nominieren. Auch war er nicht gerade ein Musterprofi – nachdem er Mailand– Sanremo gewonnen hatte, verspielte er gleich am nächsten Abend das gesamte Preisgeld. Eines aber stand fest: Rad fahren konnte er.
Die flämischen Fahrer dominierten die Tour 1912. Die Witterungsverhältnisse waren fürchterlich, in den Alpen glichen die Straßen eher Sturzbächen, doch Defraeye, den Alcyon in letzter Minute nominiert hatte, donnerte in rekordverdächtigem Tempo auf ihnen dahin und zermalmte die Konkurrenz wie lästige Käfer. Im strömenden Regen erreichte er Paris mit großem Vorsprung vor seinem schärfsten Verfolger Eugène Christophe, begeistert empfangen von Hunderten belgischen Fans, die ihre Regenschirme niederlegten und ihm zu Ehren die Nationalflagge schwenkten. Auch andere flämische Fahrer wussten zu beeindrucken. Marcel Buysse wurde Vierter, die Nachwuchshoffnung Philippe Thys Sechster und Jules Masselis, ein Amateur aus Legedem, gewann die Etappe nach Dünkirchen.
Als Defraeye nach Roeselare zurückkehrte, säumten 10.000 Menschen die Straßen, um ihn zu empfangen. Zum ersten Mal in der Neuzeit hatte ein Flame gezeigt, dass er es mit den Franzosen aufnehmen und sie schlagen konnte. Mit seinem Preisgeld baute er ein Haus und ein Café mit einer Radrennbahn nebenan. Der Lieferjunge aus der Bürstenfabrik war gerade erst 20. Sein Sieg und die Reichtümer, die er ihm einbrachte, sollten den Radsport in Flandern populär machen – als Chance, der Armut zu entkommen, und als Ausdruck nationaler Identität.
Für den angehenden Radsportjournalisten und engagierten flämischen Patrioten Karel Van Wijnendaele hätte Odiel Defraeyes Triumph zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Der Radsport erlebte nun einen wahren Boom in Belgien, die Zahl der Radsportler mit Rennlizenz stieg von ein paar hundert auf 4.000. Velodrome schossen im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden. Angesichts dieser Zahlen entschied der Verleger August De Maeght aus Brüssel, dass es in Belgien einen hinreichenden Markt für eine Sportzeitung in niederländischer Sprache gebe. Er nannte sie Sportwereld – »Sportwelt« – und einer der Autoren, die er für seine neue Unternehmung anheuerte, war Karel Van Wijnendaele, der nachgewiesen hatte, dass er weitaus besser über Radrennen schreiben konnte, als seine Meriten als Aktiver erahnen ließen.
Sportwereld war ein unmittelbarer Erfolg, die Erscheinungsweise wurde schon bald von zweimal in der Woche auf täglich umgestellt. Und es dauerte nur vier Monate, da war der tatkräftige, unermüdliche Van Wijnendaele zum Herausgeber des Blattes aufgestiegen. Von Beginn an ging es in der Zeitung um mehr als nur Sport. In seinem ersten Editorial versprach das Blatt seinen Lesern, ihnen eine »Welt der Gedanken« zu vermitteln, sie zu unterrichten und zu informieren. Die Zeitung war in einem volkstümlicheren Flämisch geschrieben als die meisten Konkurrenzgazetten, ihre oftmals im schwülstigen Stil jener Zeit verfassten Reportagen waren mit westflämischem Dialekt gewürzt.
Damals führte praktisch jede öffentliche Einrichtung in Belgien ihre Geschäfte noch vorrangig oder sogar ausschließlich auf Französisch. Das Gleiche galt für den nationalen Radsportverband. Sportwereld schrieb sich auf die Fahne, dies ein für alle Mal zu ändern. Es war ein zähes Ringen, aber nach einer zehnjährigen Kampagne lenkten die Funktionäre in Brüssel schließlich ein und fortan arbeitete der belgische Radsportverband zweisprachig. Damit allein gaben sich Van Wijnendaele und Sportwereld aber natürlich nicht zufrieden, und sie machten sich außerdem dafür stark, dass der Unterricht an der Universität Gent auf Niederländisch statt auf Französisch abgehalten würde, und führten eine Literaturseite ein, auf der die neuesten flämischen Romane, Gedichte und Theaterstücke besprochen und beworben wurden – wohl kaum die übliche Domäne einer Sportzeitung, wo in der Regel eher Schaltwerke und Knieverletzungen als neoromantische Verse erörtert werden.
Aber für Van Wijnendaele war Sport nicht bloß ein Spiel, sondern ein Mittel, um politische Veränderungen zu erwirken. Sprache war der Schlüssel. Von George Bernard Shaw stammt der berühmte Ausspruch, dass es einem Engländer unmöglich sei, »den Mund aufzumachen, ohne sich den Hass oder die Verachtung irgendeines anderen Engländers zuzuziehen«. In ähnlicher Weise wird jede Bemerkung über das Flämische Widerspruch aus der einen oder anderen Ecke hervorrufen. Wenn ich zum Beispiel behaupte, dass die Menschen aus Flandern »Vlaams« sprechen, einen Dialekt des Niederländischen, der aus dem Niederfränkischen hervorgegangen ist, weiß ich, dass ich damit den Unmut mancher Flamen errege. »Nein, wir sprechen Niederländisch«, werden sie verärgert sagen. »Die da behaupten nur, es sei ein Dialekt, um uns klein zu machen.« »Die da«, das sind die französischsprachigen Belgier.
Dies mag ein wenig paranoid klingen, aber die Flamen haben guten Grund, sich verfolgt zu fühlen. Belgien wurde erst im Jahr 1831 eine unabhängige Nation, nach einem Aufstand in Brüssel gegen die Niederländer. (Obwohl sie die gleiche Sprache sprechen, ist das Verhältnis zwischen Flandern und den Niederlanden kein leichtes. Flandern ist zutiefst katholisch und konservativ, die Niederlande hingegen sind liberal und protestantisch/agnostisch. Die Niederländer halten die Flamen traditionell für ungebildete Dummköpfe, während die Flamen in ihren nördlichen Nachbarn zugeknöpfte, blasierte Geizhälse sehen.) Die Niederlande hatten – in gewisser Weise gegen ihren Willen – die Regionen Flandern und Wallonien als Teil der Neuordnung nationaler Grenzen im Anschluss an die napoleonischen Kriege erhalten, während derer Frankreich sie von Österreich annektiert hatte, das sie wiederum zuvor von Spanien übernommen hatte… Zunächst weigerten sich die Flamen, Anweisungen von der neuen Regierung in Brüssel entgegenzunehmen, doch schließlich wurden sie mit Hilfe der französischen Armee dazu gezwungen. Die Bevölkerung des neuen Landes (»von den Briten erschaffen, um die Franzosen zu ärgern«, wie Charles de Gaulle es auf den Punkt brachte) bestand also aus zwei Sprachgruppen: den Flamen und den Wallonen. (Nach dem Ersten Weltkrieg kam eine dritte hinzu, die deutschsprachige Minderheit aus der Gegend rund um Eupen im äußersten Nordosten des Landes; sie scheint sich aber nicht sonderlich für Radsport zu interessieren.) Es ist ein gängiges Vorurteil, dass die Wallonen Französisch gesprochen hätten. Tatsächlich sprachen rund 70 Prozent von ihnen Wallonisch, eine eigenständige Sprache, die auf der aus dem Lateinischen hervorgegangenen Lingua Romana des Heiligen Römischen Reichs fußt. Um das Problem zu lösen, dass ihr Land aus zwei Volksgruppen bestand, die die Sprache der jeweils anderen nicht verstanden, fassten die neue belgische Regierung und der König, Leopold I. (der, um die Dinge noch zu verkomplizieren, selbst Deutscher war), einen eher unkonventionellen Entschluss: Sie entschieden, dass sie fortan alle eine dritte Sprache sprechen sollten, nämlich Französisch. Französisch, mit seinen Wurzeln im warmen Mittelmeerraum, wurde seinerzeit noch immer in ganz Europa als eine Sprache der Kultur angesehen. Die meisten gebildeten Belgier sprachen es, und, da sie die herrschende Klasse bildeten, erschien dies eine naheliegende Wahl zu sein, ihnen jedenfalls. Französisch wurde also zur offiziellen Landessprache. Es war die Sprache der Regierung, der Verwaltung, der kommunalen Behörden, der Streitkräfte und des gesamten Bildungswesens.
Wallonien bildete das industrielle Zentrum von Belgien. Hunderttausende Immigranten aus Italien, Portugal und Ost- und Mitteleuropa kamen, um in den Kohlebergwerken, Stahlhütten und Fabriken der Region zu arbeiten. Vielleicht deswegen, vielleicht aber auch, weil Wallonisch der gleichen Sprachfamilie wie das Französische entstammte, waren die kontinuierlichen und in den 1950er Jahren sogar nochmals intensivierten Anstrengungen belgischer Regierungen, sich des Wallonischen zu entledigen, weitgehend erfolgreich. Heute wird es nur noch von rund 300.000 Menschen gesprochen – und manche von ihnen leben in Wisconsin.
Vlaams hingegen erwies sich als weitaus schwieriger zu verdrängen. In Flandern wurde Französisch zur Sprache des Bürgertums. Flämische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts wie Emile Verhaeren (aus Sint-Amands) und Maurice Maeterlinck (aus Gent) schrieben auf Französisch. Flämisch galt als rückständig und ungehobelt, als die Sprache der Bauern und Arbeiter. Die Flämischsprachigen mochten der Welt bedeutende Maler wie Antoon Van Dyck, Jan Van Eyck und die Brueghels beschert haben, aber für die herrschende Klasse in Brüssel waren sie nichts als beschränkte Hinterwäldler, deren Hauptaufgabe im Leben es war, Futterrüben zu ernten. Westflandern galt als eine befremdliche Todeszone aus Matsch, Elend und Runkeln, während die Provinz Limburg für Obstanbau und bodenlose Dummheit bekannt war.
In den 1920er Jahren, als angeregt wurde, einen Teil der Vorlesungen an der Universität Gent auf Flämisch zu halten, erhob sich ein Mitglied des belgischen Parlaments und sagte, wenn man französische durch flämische Kultur ersetzen wolle, sei das so, als würde man anstelle eines Leuchtturms eine Kerze aufstellen. Als der aus Antwerpen stammende Schriftsteller Hendrik Conscience im Jahr 1837 seinen ersten Roman veröffentlichte, war sein Vater so erzürnt darüber, dass sein Sohn sich auf Flämisch zu schreiben entschieden hatte, dass er ihn aus dem Haus warf.
Conscience, dessen Schaffen angesichts seines romantischen Stils und der Wahl historischer Sujets zum Teil von Sir Walter Scott inspiriert zu sein schien, wurde zu einer Schlüsselfigur für die Wiedergeburt des flämischen Nationalismus. Sein Roman Der Löwe von Flandern entfachte eine Stimmung neuen kulturellen Selbstbewusstseins und regte Hippoliet Van Peene zu seinem Lied »De Vlaamse Leeuw« (»Der flämische Löwe«) an, der inoffiziellen Hymne der flämischen Nationalisten, die später auch die offizielle Hymne von Flandern wurde.
Der belgische Staat war schon 50 Jahre alt, ehe im Nationalparlament in Brüssel erstmals eine Rede in flämischer Sprache zu vernehmen war. Befehle in der Armee wurden auf Französisch gebrüllt. 1873 hatte es einen unrühmlichen Mordprozess gegeben, in dem zwei Flamen zu Unrecht zum Tode durch den Strang verurteilt wurden, weil das Gerichtsverfahren ausschließlich in einer Sprache geführt wurde, der beide nicht mächtig waren. Erst nach dieser tragischen Affäre durfte das Flämische auch innerhalb des Justizsystems verwendet werden. Ein paar Jahre später gestattete die belgische Regierung, den Unterricht an Mittelschulen auf Niederländisch abzuhalten, aber erst 1930 wurde die erste ausschließlich flämischsprachige Universität eröffnet und Französisch sollte bis 1967 die einzige offizielle Amtssprache in Belgien bleiben.
Auch wenn die Flamen bisweilen allzu erpicht darauf schienen, sich als »unterdrücktes Volk« zu gerieren, hatten sie zweifellos Gründe, sich benachteiligt zu fühlen. Und in gleicher Weise, wie Nationen innerhalb des britischen Empires Cricket-Länderspiele als Möglichkeit begriffen, um ihre Bereitschaft zur Selbstbestimmung nachzuweisen, sah Karel Van Wijnendaele im Radsport ein Mittel, um soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. Odiel Defraeyes Popularität nach seinem Triumph bei der Tour de France ermunterte Van Wijnendaele zu einer weiteren Entscheidung, von der er glaubte, dass sie sowohl das Ansehen seines geliebten Flandern als auch die verkaufte Auflage seiner Zeitung steigern würde. Belgien hatte bereits ein großes Radrennen, Lüttich–Bastogne–Lüttich (»La Doyenne« genannt und erstmals 1892 ausgetragen), aber dies fand in Wallonien statt. In Flandern gab es nichts außer dem Scheldeprijs, einer recht bescheidenen Angelegenheit, die sich auf Straßen rund um Antwerpen beschränkte. Van Wijnendaele beschloss, diesen Missstand zu korrigieren, indem er die Ronde van Vlaanderen ins Leben rief, ein Rennen, das, wie Sportwereld verkündete, ein Erzeugnis »des flämischen Volkes und des flämischen Bodens« sein werde. Henri Desgrange und seine Zeitung L’Auto hatten ein Jahrzehnt zuvor das Gleiche mit der Tour de France vorexerziert, und der Giro d’Italia war die Erfindung der Gazzetta dello Sport. Es war ein Modell, das augenscheinlich funktionierte.
Die erste Ronde wurde im Mai 1913 ausgetragen. 37 Fahrer traten zu einem Rennen an, das auf dem Korenmarkt von Gent startete, sich seinen Weg durch Sint-Niklaas, Aalst, Oudenaarde, Ypern, Kortrijk, Veurne, Ostende, Roeselare, Brügge und zurück nach Gent bahnte, wo es am Stadtrand im Velodrom von Mariakerke endete. Van Wijnendaele gab später an, das Rennen sei 370 Kilometer lang gewesen, aber das schien eine Übertreibung zu sein und es waren wohl eher um die 320. Fest stand, dass die neue Flandern-Rundfahrt die meisten der größeren Städte in Ost- und Westflandern einbezog, auf Straßen – der Begriff wurde recht weit gefasst –, deren Zustand zwischen schlecht und entsetzlich schwankte. Das Spektrum reichte von Kopfsteinpflaster so löchrig wie das Grinsen eines Dorftrottels über Schotterpisten aus Hochofenschlacke, kaum breit genug für eine Schubkarre, bis hin zu Wegen, die von der täglichen Prozession der Kühe zum Melkstand aufgewühlt waren. Die Strecke war dermaßen gefährlich, dass die französischen Rennställe ihren belgischen Fahrern die Teilnahme untersagten.
Sieger der ersten Ronde wurde Paul Deman, ein Fahrradhändler aus Rekkem bei Menen in Westflandern. Deman hatte sich bereits zuvor Legendenstatus in seiner Heimatgemeinde erworben, als er 1911 die Tour de France auf einem Rad bestritt, das er aus Teilen zusammengeschraubt hatte, die ihm von anderen Händlern geschenkt worden waren (die Reifen musste er allerdings selbst stellen). Sein Rad für die Flandern-Rundfahrt musste Deman nicht selbst zusammenschustern, dennoch brauchte er zwölf zermürbende Stunden, um die Strecke zu bewältigen. Es war der Mühe wert. Das Preisgeld für den Sieger war beträchtlich, der Gegenwert von mehr als einem Jahresgehalt für die meisten Flamen. Leider war es auch etwas mehr, als Sportwereld sich leisten konnte – Van Wijnendaele hatte sich schlichtweg verkalkuliert. Das neue Rennen hatte die Verkaufszahlen der Zeitung nicht in einer Weise angekurbelt, wie er es sich erhofft hatte, und der Ticketverkauf für das große Finale im Velodrom lief ebenfalls schlecht. An der Strecke hatten Zehntausende Zuschauer gestanden, aber das Rennen umsonst zu sehen oder dafür zu bezahlen, waren halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Enttäuscht, aber unverzagt machte Van Wijnendaele weiter und verlegte das Ziel der Ronde im darauffolgenden Jahr ins Velodrom von Evergem. Leider lief der Kartenverkauf, trotz der Teilnahme von Superstar Marcel Buysse aus dem nahen Wontergem, erneut mies und nur ein paar hundert Menschen sahen Buysse als Sieger über den Zielstrich fahren. Die Investoren von Sportwereld zeigten sich recht ungehalten ob dieser Lage der Dinge. Manche von ihnen forderten, die Ronde aufzugeben. Van Wijnendaele hätte womöglich ein zähes Ringen um den Erhalt des Rennens bevorgestanden, doch im August 1914 kam ihm Kaiser Wilhelm dazwischen. Deutschland marschierte über die Grenze im Nordosten in das neutrale Belgien ein.
Die belgische Armee leistete den einfallenden deutschen Truppen tapfer Widerstand, wurde aber rasch zurückgedrängt. Alle größeren Städte wurden überrannt und binnen weniger Monate war nur noch ein winziger Zipfel des kleinen Lands in belgischer Hand – ein Dreieck in Westflandern, dessen eine Grenze von der Kammlinie südöstlich von Ypern zum Fischerhafen Nieuwpoort an der Mündung der Yser verlief. Der belgische König Albert I. (bzw. Albert, König der Belgier, wie er genannt zu werden wünschte) zog sich in ein großes Haus im Küstenort De Panne zurück. Die belgische Armee war, da Wallonien und Brüssel eingenommen worden waren, inzwischen überwiegend flämisch. Und mit dem, was von ihr noch übrig war, bemannte sie die Gräben, die den König schützten. In einer berühmten Rede, in der er sie aufrief, sich an die Schlacht der Goldenen Sporen zu erinnern (einen Sieg, der für die Flamen das ist, was Bannockburn für die Schotten ist), hatte Albert an den Patriotismus der Flamen appelliert, und sie kamen der Aufforderung nach. In den nächsten vier Jahren ließen mehr als 30.000 von ihnen ihr Leben im Kampf, wenigstens einen kleinen Streifen ihrer Heimat zu verteidigen.
Im übrigen Europa gilt König Albert I. als heroische Gestalt, bekannt als Albert der Tapfere. Er ist einer der wenigen Belgier, nach denen in Frankreich Straßen benannt sind. Sogar im fernen Biarritz übernachtete ich mal in einem Hotel, in dessen Lobby eine große Büste von ihm stand. Für die Flamen jedoch ist er alles andere als ein Held, sondern ein Schurke und Verräter. Um sicherzustellen, dass sie weiter für ihn kämpften, hatte er den Flamen alle möglichen sprachlichen und sozialen Reformen versprochen, die er aber schnell wieder vergaß, sobald der Krieg gewonnen und Belgien befreit war. Der Gipfel der Kränkung war jedoch, dass die Gräber der gefallenen Flamen mit der Inschrift »Mort pour la patrie« versehen wurden. Selbst im Tod wurden sie nicht in ihrer eigenen Sprache gewürdigt. Der Monarch schien sich der Kränkung in keiner Weise bewusst zu sein. Als Albert 1934 bei einem Kletterunfall in den Ardennen ums Leben kam, witterte so mancher eine Verschwörung. »Man sagt, es wäre auch denkbar, dass erzürnte flämische Nationalisten ihn umgebracht haben«, erzählen einem die Leute in Flandern. Zwar glauben sie offenkundig nicht daran, aber man spürt, dass ein kleiner Teil von ihnen wünscht, es wäre so gewesen.
Die Ereignisse im Ersten Weltkrieg trugen dazu bei, dass sich eine politische Bewegung formierte, die auf der Ablehnung französischer Kultur und einem neuen Stolz auf Flandern und die flämische Lebensart und Kunst beruhte. Und der Radsport, die flämischste aller Sportarten, wurde zu einem wesentlichen Bestandteil dieser Renaissance.
Sportwereld stellte während des Ersten Weltkriegs den Betrieb ein. Als das Blatt 1919 wieder erschien, war es populärer denn je, die verkaufte Auflage stieg bis auf 200.000 Exemplare. Als »Troubadour flämischer Stärke« gefeiert, wurde Van Wijnendaele zu einer beinahe ebenso großen Berühmtheit wie die Volkshelden, die das von ihm erfundene Rennen bestritten.
Zwischen der ersten Ronde van Vlaanderen und dem Beginn des Ersten Weltkriegs hatten flämische Fahrer ihren Konkurrenten bei der Tour de France weiter das Fürchten gelehrt. 1913 versammelten sich 140 Teilnehmer zum Start der Tour an der Place de la Concorde. Die Straße zwischen Paris und Tours war von einheimischen Fans in heimtückischer Absicht mit Nägeln gespickt worden. Das Resultat war eine wahre Flut von Reifendefekten, die 29 Aufgaben nach sich zogen, aber falls der Gedanke dahinter war, die Belgier aus dem Konzept zu bringen, hatte es nur geringen Effekt. Jules Masselis aus Westflandern beendete den Tag als geteilter Erster, zusammen mit drei seiner Landsleute – Defraeye, Marcel Buysse und Alfons Lauwers. Am nächsten Tag übernahm er mit einem Sprintsieg in Cherbourg die Führung in der Gesamtwertung. Defraeye löste ihn auf der Etappe nach Brest ab. Marcel Buysse gewann tags darauf die Marathonetappe nach La Rochelle, doch Defraeye verteidigte als Zweiter die Gesamtführung. Die Hitze während des ersten Teils der Rundfahrt war schlichtweg mörderisch, und als das Rennen Bayonne erreichte, war das Feld bereits auf 52 Fahrer geschrumpft. Am nächsten Tag, als das Peloton sich auf den Weg in die Ausläufer der Pyrenäen machte, erklärte Defraeye zur allgemeinen Überraschung, dass er nicht weiterfahren könne, und stieg aus dem Rennen aus. Der Franzose Eugène Christophe übernahm die Gesamtführung, doch nachdem er in heroischer Manier den Tourmalet überwunden hatte – nach einem Gabelbruch in der Abfahrt zu guten Teilen zu Fuß –, wurde ihm eine Zeitstrafe aufgebrummt. Denn ein Rennkommissär bemängelte, dass ein kleiner Junge den Blasebalg in der Schmiede bedient hatte, wo Christophe seine gebrochene Gabel repariert hatte – und fremde Hilfe anzunehmen, war seinerzeit nicht regelkonform. Infolgedessen übernahm nun Philippe Thys die Gesamtführung, sein Landsmann Buysse war neuer Zweiter. Buysse überholte Thys auf der Etappe nach Perpignan, wurde dann aber dabei erwischt, wie er sich nach einem Sturz im Auto mitnehmen ließ, und auf den fünften Platz zurückgestuft. Auf einer Monsteretappe nach Grenoble baute Thys seine Führung aus. Buysse gewann einen spektakulären Ritt nach Genf, bei dem es über den Col du Galibier ging, und gewann dann erneut auf der Etappe nach Belfort, was ihm den Spitznamen »die Lokomotive« eintrug, da er wie ein Schnellzug über den Ballon d’Alsace gejagt war. Die Fahrt im Auto kam ihn jedoch teuer zu stehen und trotz seiner bravourösen Leistung war er weiterhin nur Vierter. Buysse gewann noch zwei weitere Etappen, aber Thys sicherte sich den Tour-Sieg mit einem Vorsprung von 8:37 Minuten auf Gustave Garrigou. Buysse wurde Dritter.
Der schlaksige Philippe Thys kam aus Anderlecht, einer Gemeinde, die direkt an die Kernstadt von Brüssel grenzt. Französische Sportjournalisten verpassten ihm den Spitznamen »Le Basset«, weil er sich beim Fahren tief über den Lenker beugte, wie ein Hund, der eine Fährte aufnimmt. Genau wie ein Basset zeichnete Thys sich nicht gerade durch Explosivität aus, aber er war beharrlich und ließ sich weder von körperlichen Strapazen noch von äußeren Einflüssen beirren. Der Spitzname verwies zudem auf eine gewisse trübsinnige Verdrießlichkeit, eine Schwere des Gemüts, die den Flamen von den Franzosen generell gerne nachgesagt wird, ob sie nun gegeben ist oder nicht.
Die Tour de France 1914 startete am gleichen Tag, an dem Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajewo erschossen wurde. Die Rundfahrt begann mit einer mitternächtlichen Parade der Teilnehmer auf den mit Gaslicht beleuchteten Champs-Élysées, begleitet von Zehntausenden jubelnden Zuschauern. Es war ein hart umkämpftes Rennen, in dem sich Thys letztlich erneut durchsetzte. Die entscheidende Etappe trug sich in den Pyrenäen zu, wo der Basset sich am Col d’Aspin an die Fersen des bis dahin Führenden Firmin Lambot heftete, einem Wallonen aus Florennes in der Provinz Namur, und den Pass dann in einem solch halsbrecherischen Tempo hinabjagte, dass er sogar die vorauseilenden Begleitwagen überholte. In der Folge sah er sich ständiger Attacken durch Lambot und die beiden Franzosen Jean Alavoine und Henri Pélissier ausgesetzt, die, vielleicht eingedenk der Art und Weise, wie flämische Fahrer sich in früheren Rennen gegenseitig unterstützt hatten, offensichtlich ein frankophones Bündnis gegen ihn geschmiedet hatten. Dennoch verteidigte Thys auch in den Alpen beharrlich seine Führung. Vor der letzten Etappe nach Paris lag Pélissier nur drei Minuten hinter dem Mann aus Anderlecht. Der Franzose versuchte beherzt, den Rückstand aufzuholen, doch seine enorme Popularität bei der einheimischen Bevölkerung erwies sich letztlich als sein Verderben, denn seine Attacken wurden ein ums andere Mal von Fans vereitelt, die darauf aus waren, ihm auf den Rücken zu klopfen, und so die Strecke blockierten. Thys gewann das Rennen mit etwas weniger als zwei Minuten Vorsprung. Nur fünf Tage später überschritten deutsche Truppen die Grenze zu Belgien…
Paul Deman war an den aufregenden Ereignissen dieser großartigen Tour nicht beteiligt, doch der Sieger der ersten Ronde van Vlaanderen ging als wahrer Held aus dem Krieg hervor. Im besetzten Teil Belgiens lebend, unterstützte Deman den belgischen Widerstand, indem er im Rahmen seines Rennrads versteckte Botschaften in die neutralen Niederlande und zurück nach Belgien schmuggelte. Irgendwann kriegten die Deutschen es spitz. 1918 wurde er verhaftet und in Leuven ins Gefängnis gesteckt. Zum Tod durch Erschießen verurteilt, entging Deman seiner Hinrichtung, weil am Tag, an dem das Urteil vollstreckt werden sollte, der Waffenstillstand unterzeichnet wurde. In Anerkennung seiner Tapferkeit erhielt er von den Franzosen das Croix de Guerre, eine Auszeichnung für heroische Taten, die erstmals 1915 verliehen wurde. Nach dem Krieg fuhr Deman wieder Rennen und gewann 1920 Paris–Roubaix und 1923 Paris–Tours. Nachdem er seine Karriere beendet hatte, nahm er eine Stelle in einem Radgeschäft am Fuße des Kluisbergs an, einem der berühmtesten Anstiege der Ronde.
Die erste Austragung der Ronde van Vlaanderen nach dem Ersten Weltkrieg war eine der erstaunlichsten in der Geschichte des Rennens und trug dazu bei, es endgültig als bedeutendes internationales Ereignis zu etablieren. Henri Van Lerberghe, in Flandern besser bekannt als Ritten bzw. Ritte, der Verkleinerungsform seines Vornamens, hatte mit der belgischen Armee an der Front gekämpft. Er war praktisch direkt aus der Kaserne zur Ronde angereist und borgte sich ein Rad vom Schwager eines anderen Teilnehmers, Jules Masselis, jenes Mannes also, der kurzzeitig die Tour de France 1913 angeführt hatte. In einem ruhigen Moment vor dem Start kündigte Van Lerberghe den übrigen Teilnehmern, darunter unter anderem Marcel Buysse, lautsprecherisch an, dass er sie an diesem Tag »alle in den Dreck fahren« werde. Das sorgte für große Heiterkeit, und sieht man sich Aufnahmen von Van Lerberghe an, versteht man auch warum. Er war ein kleines, schmächtiges Männchen mit dem Schnurrbart und der schiefen Visage einer Gestalt aus einer Slapstick-Komödie. Er sah eher danach aus, als würde er gleich einem Polizisten mit einer Leiter den Helm vom Kopf schlagen, als bei einem Eintagesklassiker zum Sieg zu fahren. Der flämische Champion Jules Vanhevel jedenfalls fand die Ansage sehr amüsant und begann lauthals zu glucksen. Die beiden Männer wären beinahe aneinandergeraten. »Ich werde dich vor deiner eigenen Haustür abhängen«, gellte Van Lerberghe. Er hielt Wort, als er sich 120 Kilometer vor dem Ziel in Ichtegem – Vanhevels Heimatstadt – vom Feld absetzte und sich im Gegenwind allein auf und davon machte. Van Lerberghe war ein zäher Bursche, aber die Meute der Verfolger fühlte sich von seinen Eskapaden weiterhin eher unterhalten als verunsichert. Schon vor dem Krieg hatte Van Lerberghe eine große Leidenschaft dafür an den Tag gelegt, ohne Rücksicht auf Verluste zu attackieren. So fuhr er ein ums andere Mal gewaltige Vorsprünge heraus, nur um dann weit vor dem Ziel völlig erschöpft einzubrechen. Die Zeitungen waren längst dazu übergegangen, ihn wegen seiner selbstmörderischen Fahrweise den »Todesfahrer aus Lichtervelde« zu nennen. Und auch diesmal begann Van Lerberghe zu straucheln. Von Hunger geschwächt stahl er einen Verpflegungsbeutel, der eigentlich für Marcel Buysse bestimmt war, und so gestärkt begann er das Tempo wieder zu erhöhen. Dennoch hätte ihn das Feld womöglich noch gestellt, hätte nicht direkt auf der Strecke ein Zug gehalten. Van Lerberghe schulterte sein Rad und kletterte der Legende zufolge zur einen Seite eines Waggons hinein und zur anderen Seite wieder hinaus, schwang sich wieder auf sein Rad und setzte das Rennen fort. Der Zug rührte sich minutenlang nicht von der Stelle. Doch als das Verfolgerfeld eintraf, legte kein anderer Fahrer die gleiche Initiative an den Tag. Stattdessen warteten alle brav, dass die Strecke frei würde. Als es so weit war, war Van Lerberghe ihnen dermaßen weit enteilt, dass er, als er das Velodrom in Gentbrugge erreichte, wo sich das Ziel des Rennens befand, noch Zeit hatte, sich in ein Café zu begeben und ein Bier zu bestellen. Das erste schmeckte so gut, dass er noch ein zweites orderte. Als der Direktor der Bahn erfuhr, was vor sich ging, schickte er einen Soigneur los, ihn zu holen. Inzwischen hatte Van Lerberghe noch ein paar Bier mehr intus und war so wacklig auf den Beinen, dass er von einem Ordner auf die Bahn geführt werden musste. Müde und emotional bewegt absolvierte er gemächlich seine Ehrenrunde, den Zuschauern genüsslich zurufend, sie sollten lieber nach Hause gehen und morgen wiederkommen, er habe »einen halben Tag Vorsprung vor den anderen«. Das war eine Übertreibung, aber trotz seines Kneipenstopps gewann Van Lerberghe mit fast einer Viertelstunde Vorsprung, dem größten in der Geschichte der Ronde. Viele Historiker hegen Zweifel am letzten Teil dieser Schilderung, aber Van Wijnendaele billigte und verbreitete sie gern. Er wusste, dass solche Legenden für den Sport und insbesondere auch für den Radsport Gold wert waren – es war schließlich noch die Zeit, bevor es Fernsehen gab. Journalisten waren nicht dazu da, Mythen zu widerlegen, sondern sie zu erschaffen. Ihr Job war es, ein wenig Drama in den Alltag ihrer Leser zu bringen. Darüber hinaus hatte Sportwereld die Mission, die Bevölkerung von Flandern zu inspirieren und mit Zuversicht zu erfüllen. Es ging darum, Geschichten zu schreiben, die, in den Worten Van Wijnendaeles, »aus dem Granit des flämischen Volkes gehauen waren«. Die Fabel vom bierseligen Sieg des Todesfahrers aus Lichtervelde auf einem geborgten Rad stand für alles, was Sportwereld sich auf die Fahne geschrieben hatte. Was soll’s, wenn sie nicht stimmte?
Van Lerberghe gewann danach nie wieder ein Rennen, doch das spielte kaum eine Rolle. In seiner Heimatstadt gibt es, angebracht an der Hauswand einer Fleischerei an der langen Hauptstraße, eine Gedenktafel für ihn (nicht weit entfernt von einer weiteren, die den Geburtsort von Charles Joseph Van Depoele kennzeichnet, dem Pionier der elektrischen Straßenbahn, und einem Café mit Karikaturen von Roger De Vlaeminck im Schaufenster, dem viermaligen Sieger von Paris–Roubaix). Der Todesfahrer aus Lichtervelde wird oft als »der erste der Flandriens« bezeichnet. Im flämischen Radsport ist »Flandrien« ein sehr spezifischer Begriff, der Fahrern vorbehalten ist, die jene Eigenschaften verkörpern, die den Flamen besonders teuer sind und die auch Van Wijnendaele stets zu verherrlichen und zu rühmen suchte.
Als sie 1914 die matschigen Schlachtfelder des Ypernbogens hinaufmarschierten, fühlten sich die Männer der Northumberland Fusiliers von den einstöckigen Steinhäusern, die das ländliche Westflandern prägten, bestimmt an die Gegend rund um den Fluss Tyne bei ihnen zu Hause im Nordosten von England erinnert. Zwei Jahrzehnte lang lebte ich in einem Landhaus in Northumberland, das eben dieses Heimweh angeregt haben mochte. Dieses Landhaus war einst deren drei gewesen – achtköpfige Familien lebten jeweils in einem Raum mit eigenem Herd fürs Heizen und Kochen, draußen neben Abort und Kohleschuppen gab es noch ein gemeinsam genutztes Waschhaus. Bevor wir das Haus kauften, bestellten wie einen Gutachter. Er listete die endlosen Mängel auf – den Holzwurm in den Dachbalken, die morschen Dielen, die bröckelnden Fugen und die potenziell explosive Klärgrube. »Was ist mit den Schornsteinen?«, fragte ich. Der Gutachter lachte nur. »Um die müssen Sie sich keine Sorgen machen«, meinte er. »Ich sage Ihnen, falls in Northumberland jemals eine Atombombe einschlägt, wird sie alles dem Erdboden gleichmachen, bis auf die verdammten Schornsteine.« Fotografien vom Ypernbogen während des Ersten Weltkriegs legen die Vermutung nahe, dass die Schornsteine in Westflandern ebenso unverwüstlich waren.
Soweit mir bekannt, gibt es keine präzise Entsprechung des französischen Begriffs Flahute, aber wann immer ich dieses Wort höre, kommt mir das Bild eines dieser grob gemauerten Schornsteine im Tal des Tyne in den Sinn. Flahute war der Name, den die Franzosen einem typischen flämischen Radprofi verpassten. In der Tat weisen beide viele gemeinsame Eigenschaften auf: Sowohl der Tynedale-Schornstein als auch der Flahute ist robust gebaut, hat Ecken und Kanten und ist von geradezu unerbittlicher Funktionalität, ohne jeden Anspruch auf Schönheit.
Die Flahutes verzückten das Radsportpublikum nicht mit ihrer Eleganz, ihrem guten Aussehen oder ihrer Anmut. Während Fahrer wie Fausto Coppi, Louison Bobet oder Luis Ocaña scheinbar mühelos über die Straße schwebten, tuckerten die Flahutes wie Schleppkähne voran. Die Anstrengungen standen ihnen in ihre verschwitzten Mienen geschrieben, ihre stämmigen Schenkel pumpten, ihre verschorften Ellenbogen zuckten, ihre knorrigen Köpfe wackelten. Man konnte beinahe hören, wie ihre Gelenke rasselten und der Dampf ihnen aus den Ohren pfiff. Die Anstiege in Flandern waren kurz, steil und vorwiegend mit grobem Kopfsteinpflaster befestigt. Diese ruppigen Rampen hinaufzufahren, erforderte besondere Fähigkeiten. Herausragende Kletterer wie Charly Gaul, Federico Bahamontes und Julio Jiménez tanzten an den Anstiegen im Hochgebirge leichtfüßig auf den Pedalen, flogen flink wie Bergziegen die Pässe hinauf. In Flandern funktionierte das nicht. In Flandern musste man auf die Pedale einprügeln. Klettern war dort weniger ein Walzer denn ein Holzschuhtanz. Selbst wenn es sonnig und trocken war, kamen die Flahutes von Schlamm bedeckt ins Ziel. Jeder Pedaltritt erschien wie Agonie, doch die Flahutes machten weiter, unerbittlich und schmutzig wie der Winterregen. Wenn alle Welt in Schlamm und Chaos versank und strauchelte, blieben die Flahutes aufrecht. »Wenn ich litt, war ich glücklich, denn wenn ich litt, wusste ich, dass alle anderen tot waren«, sagte Briek Schotte, der 1919 in einem Dorf ein paar Kilometer außerhalb von Kortrijk in Westflandern geboren wurde und von flämischen Radsportfans später als der »Eiserne« verehrt wurde. Um es kurz zu machen: Schotte war der größte aller Flahutes, und nur große Flahutes waren Flandriens.
An einem Sommertag im Jahr 2016 nahm ich den Bus von Kortrijk nach Desselgem. Nachdem mich der Fahrer in der Nähe einer Tankstelle abgesetzt hatte, verirrte ich mich hoffnungslos in einer scheinbar endlosen modernen Wohnsiedlung. Es war glühend heiß und kein Mensch war zu sehen. Ich fragte mich, ob ich eine Meldung in den Nachrichten verpasst hatte, die der Bevölkerung von Westflandern riet, im Haus zu bleiben, weil ein mordlüsterner Irrer herumlief. Allmählich beschlich mich das Gefühl, dass jeden Moment jemand »Das muss er sein!« schreien würde, gefolgt von einem Gewehrschuss und einem brennenden Schmerz in der Brust. Nicht, dass ich melodramatisch veranlagt wäre oder so…
Endlich, ich war längst triefnass vor Schweiß, traf ich auf eine Frau in einem blauen Kittel, die geschäftig den Gehsteig vor ihrem Haus in Ordnung brachte. Die Flamen sind nicht nur stolz auf ihre Häuser, sondern auch auf ihre Gehsteige. Man sieht sie häufig das Unkraut aus den Gehwegplatten zupfen oder den Bordstein vor ihren Häusern fegen. Die Dame im blauen Kittel machte sich mit einer Handgabel aus Blech an ein wenig Gras zu schaffen, das sich erdreistet hatte, aus dem Boden zu schießen und das Gesamtbild zu stören.
Ich erkundigte mich bei ihr nach dem Denkmal für Briek Schotte. »Oh ja«, sagte die Dame, während sie sich aufrichtete und die Brauen wischte. Sie zeigte und gestikulierte mit den Händen, um mir den Weg begreiflich zu machen. »Nicht mehr als ein Kilometer«, sagte sie. Dann lächelte sie und sagte: »Er war der Beste.« Jeder in Flandern bewunderte Briek Schotte, er war für den flämischen Radsport, was Bill Shankly für den englischen Fußball oder Vince Lombardi für American Football war – klein, zäh und erfüllt von mächtiger Weisheit.
Ich fand den Platz, der Briek (eine Kurzform von Albéric) Schotte zu Ehren benannt worden war. Dort gab es eine bronzene Büste, eine eiserne Skulptur, die Schotte auf seinem Rad darstellte, und dazu an der Giebelseite eines Hauses noch ein großes Schwarzweißporträt des Fotografen Stephan Vanfleteren, das den betagten Schotte in Nahaufnahme zeigt. Auf dem Bild hat er dunkle Augen, die fahle Haut schmiegt sich faltig an die harten Gesichtsknochen. Sein Blick ist scharf wie der eines Adlers und ebenso intensiv. Er erinnerte mich an meinen alten Geschichtslehrer, einen Waliser aus den Valleys im Süden, der in den 1950er Jahren als Stand-Off für Cardiff gespielt hatte. »Geh mal in Frankreich spielen«, hatte er gesagt. »Toulouse, Toulon, die Hochburgen des französischen Rugby. Das ist eine Erfahrung, die du nicht vergisst. Große Männer waren das, riesig. Junge, ich sage dir, das wirst du deinen Lebtag nicht mehr los: die Brutalität, die Härte und … den Geruch.« Briek Schotte strahlte die gleiche Intensität aus wie mein walisischer Lehrer. Kein Mann, von dem man dabei erwischt werden möchte, Kaugummi unters Pult zu kleben.
Einen Fahrer wie Briek Schotte hatte man bis dahin nicht gesehen. Er war kein Adonis, besaß weder die Anmut noch das Auftreten eines Athleten, doch er hatte das Charisma, das Härte häufig mit sich bringt, einen gnadenlosen Schneid. Ob es nun stimmte oder nicht, die Leute erzählten sich gern, dass Schotte seine Trinkflaschen mit braunem Bier füllte und seine Verpflegungsbeutel mit Rindergulasch und Stoemp – flämischem Kartoffel- und Gemüsestampf.
Schotte wuchs auf einem Bauernhof vor den Toren von Desselgem auf. Als er mit zehn seine Erstkommunion feierte, sei er anschließend gleich mit allen aus der Kirche geeilt, um die Ronde vorbeifahren zu sehen. »Radsport ist Religion«, sagte er später. Es war unschwer zu erkennen, wie er wohl zu dieser Auffassung gekommen war.
Briek (oder auch Brik, beide Schreibweisen haben ihre Anhänger) war eins von sechs Kindern. Die örtliche Schule war zehn Kilometer entfernt und der junge Briek musste auf dem Oberrohr seines Fahrrads zwei seiner jüngeren Geschwister mit zur Schule nehmen. Derlei Personentransport bescherte ihm enorm kräftige Beine, und dann musste er auch noch morgens, bevor er aufbrach, und später, nachdem er aus der Schule zurück war, auf dem Hof der Familie helfen.
Das Ergebnis war eine typische Flahute-Statur: mächtiger Brustkorb, starke Taille, gewaltige Schenkel. Schotte hatte ein Antlitz so wettergegerbt und zäh wie Erlenrinde. Auf dem Rad zeichnete er sich durch eine Art Anti-Stil aus, ständig hin und her schlingernd, während er mit der Miene immerwährender Pein – ähnlich wie sein Zeitgenosse, der Langstreckenläufer Emil Zátopek – verbissen die Pedale wälzte. Vielleicht war es ein Stück weit ein Bluff, denn später sagte er: »Meine Haltung auf dem Rad erweckte den Anschein, ich würde mehr leiden, als ich es eigentlich tat.«
Für die Flamen ist Briek Schotte eine Legende. Er war der plumpe, ungeschliffene und ungebildete Bauernjunge, der dem schmatzenden flämischen Matsch entstiegen war und es in den 1940er und 1950er Jahren mit den Italienern und Franzosen aufnahm. Mit Männern wie dem eleganten Fausto Coppi mit seiner schicken Sonnenbrille und dem engelsgleichen Lächeln oder Louison Bobet, der selbst auf Fotos einen Hauch von Kölnischwasser und Pomade zu verströmen scheint. Verglichen damit gab es in der flämischen Radsport-Szene nicht einen Hauch von Glamour. Die flämischen Teams waren chronisch unterfinanziert – die Fahrer verdienten im Schnitt nur ein Drittel dessen, was ihre italienischen und französischen Kollegen einstreichen durften. Ihre Räder waren oft minderwertig und ihre Ausrüstung spartanisch. Dieses finanzielle Gefälle bestand über Jahrzehnte fort. Als Dirk De Wolf sich 1992 der italienischen Gatorade-Mannschaft anschloss, erhielt er vor der Saison 22 Radhosen. »In Belgien bekäme ich in fünf Jahren nicht so viele zu sehen!«, rief er begeistert.
Es war wie David gegen Goliath.
In Wahrheit stammten viele große Radrennfahrer aus ähnlichen Verhältnissen wie Schotte. Coppi war der Sohn eines Bauern (als er seiner Mutter einen Kühlschrank schenkte, den er bei einem Rennen gewonnen hatte, benutzte sie ihn, um Brennholz zu verwahren), die Eltern von Jacques Anquetil bauten Erdbeeren an. Der Unterschied war, dass Coppi und Anquetil nicht wie Bauern aussahen. Schotte schon. Man kann ihn sich leicht vorstellen, wie er Heu wendet oder Gänse zum Markt treibt.
Mit 15 bestritt Briek Schotte sein erstes Rennen, einen lokalen Kermiskoers – ein Rennen im Rahmen eines Jahrmarkts oder Festes, buchstäblich ein Kirmesrennen –, auf den sich viele Fahrer, so schien es jedenfalls, mit einem Mittagessen in flüssiger Form eingestimmt hatten. Mit 19 erregte er erstmals größere Aufmerksamkeit, als er beim Grote Prijs van Kortrijk den zweiten Platz belegte, hinter Albert »Bertan« Sercu aus Bornem, einem späteren Gewinner von Het Volk. Im gleichen Jahr holte Schotte seinen ersten größeren Sieg. Es war bei der Tour de l’Ouest, einem Rennen, das vom Einmarsch der Nazis in Frankreich unterbrochen wurde.
Im Jahr darauf nahm er erstmals an der Ronde van Vlaanderen teil – einer verkürzten Variante, ausgetragen mit Genehmigung der deutschen Besatzer und mit ausschließlich flämischen Teilnehmern – und wurde Zweiter hinter Achiel Buysse. Inzwischen war er von der Schule abgegangen und arbeitete auf dem elterlichen Bauernhof. Wie es heißt, machten sich die Dorfbewohner von Desselgem solche Sorgen darum, dass die schwere Maloche seine Fähigkeit schmälern könnte, große Rennen zu gewinnen, dass sie zusammenschmissen, um eine Hilfskraft zu bezahlen, die an seiner statt auf dem Hof arbeitete.
Schotte wurde zweimal Straßenweltmeister der Profis und gewann die Zuneigung der Flamen, als er nach seinem WM-Sieg im Jahr 1948 im niederländischen Valkenburg ein Radiointerview unterbrach, indem er ins Mikrofon krakelte: »Mutter! Mutter! Kannst du mich hören? Ich habe gewonnen und bin Weltmeister!« Zwei Jahre später wiederholte er diesen Erfolg im westflämischen Moorslede, nur 50 Kilometer von seinem Zuhause entfernt.
Briek war ein heller Kopf, der über den Tellerrand hinausschaute. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er weiter auf dem Hof der Familie und gewann ein wenig Geld bei Rennen, die noch stattfinden durften. Danach brachte er sich mithilfe von Sprachkursen auf Langspielplatten in Eigenregie Französisch, Italienisch und Englisch bei – das Peloton bei den größeren Rennen war zunehmend international und es zahlte sich aus, wenn man mitbekam und verstand, was die Konkurrenz sich so erzählte. Es ist nicht leicht, sich Briek vorzustellen, wie er im Sessel sitzt und aufmerksam den Lektionen eines anonymen Sprachlehrers lauscht und Hörbeispiele nachspricht. Schon eher kann man sich ihn bei der Tour de France 1948 vorstellen, einem Rennen von seltener Brutalität, ausgetragen auf den noch vom Krieg verheerten Straßen und bei einem Wetter, das so fürchterlich war, dass es das Ende aller Zeiten anzukündigen schien. Von den 120 Fahrern, die an den Start gingen, schafften es lediglich 44 nach Paris. Schotte wurde Zweiter, hinter dem großen Italiener Gino Bartali.
Schotte nahm 20-mal an der Ronde van Vlaanderen teil, kam 16-mal ins Ziel und gewann das Rennen 1942 und 1948. »Ich war nicht der schnellste Fahrer, aber ich war stark und zäh«, fasste er in typisch bescheidener Manier seine Fähigkeiten zusammen. Er starb am 4. April 2004 im Alter von 84 Jahren, wenige Stunden vor dem Start der Ronde jenes Jahres. Ein Timing, wie es sich selbst Karel Van Wijnendaele nicht besser hätte ausdenken können.
Nachdem sie mir den Weg gewiesen hatte, hielt die Dame im blauen Kittel einen Moment inne, um ihr Englisch zu sammeln. »Es gibt noch eine weitere Statue von Briek Schotte, wissen Sie, in Kanegem, wo er geboren wurde«, sagte sie. »Bevor sie aufgestellt wurde, fragte man ihn, ob das in Ordnung wäre. Er sagte ja, aber unter zwei Bedingungen: Die Statue dürfe höchstens lebensgroß sein und sie dürfe nicht auf einem Sockel stehen.« Sie musterte mich einen Moment, um zu sehen, ob ich verstanden hätte, dann nickte sie entschieden mit dem Kopf und machte sich wieder daran, das Unkraut aus dem Gehsteig zu zupfen.