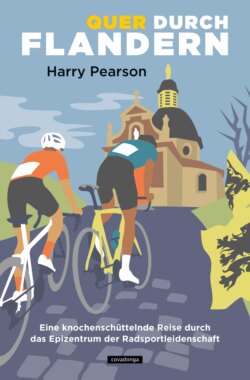Читать книгу Quer durch Flandern - Harry Pearson - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Die letzten 200 Kilometer
Sluitingsprijs Oostmalle, 19. Februar
Mitte Februar 2017 bezog ich eine Wohnung in der Nähe des Bahnhofs Gent-Dampoort, nicht weit entfernt vom Standort des alten Velodroms Gentbrugge, das 1919 Schauplatz der bierseligen Eskapaden des Todesfahrers aus Lichtervelde gewesen war, und nur wenige hundert Meter von einem Café, das einst Vin Denson gehört hatte (einem britischen Fahrer, der in den frühen 1960er Jahren auf das übersiedelte, was Engländer damals »den Kontinent« nannten, um an der Seite von Landsmännern wie Tommy Simpson und Alan Ramsbottom als Radprofi sein Glück zu versuchen). Von den vier Radrennfahrern in der britischen Sportgeschichte, die von der BBC zur »Sportpersönlichkeit des Jahres« gewählt wurden, lebte einer, Tommy Simpson, in Gent, während ein anderer, Sir Bradley Wiggins, dort geboren wurde.
Nachdem ich ausgepackt hatte, unterhielt ich mich mit meinem neuen Vermieter. Der sagte zwar, keinerlei Interesse an Radsport zu haben, kam aber nicht umhin, sogleich seine Befürchtung zum Ausdruck zu bringen, dass die Rennen in Flandern diesmal leider sterbenslangweilig werden würden, da Peter Sagan schlichtweg zu stark sei. »Er wird alles gewinnen, so wie Eddy Merckx.« Als Nächstes machte ich mich auf den Weg zum Trollekelder – einer Kneipe, über die ein flämischer Hotelier einst sagte, sie habe »nie aufgehört, nicht zeitgemäß zu sein« –, um ein Glas Westvleteren Abt zu trinken. Das Bier aus der Trappisten-Abtei Westvleteren, am Rande der flämischen Hopfenanbaugebiete nahe Ypern gelegen, wird bisweilen als »das beste Bier der Welt« bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme, aber bei einem Preis von 13 Euro für 0,33 Liter ist es definitiv eines der teuersten. Als ich mich aufmachte, um zu zahlen, dämmerte mir, dass ich mein erstes Westvleteren hier 1995 am Vorabend von Gent–Wevelgem getrunken hatte. Das Rennen gewann damals der Däne Lars Michaelsen, mir aber blieb vor allem die Nahansicht der Oberschenkel von Dschamolidin Abduschaparow, dem »Terror von Taschkent«, in Erinnerung, die jeder für sich breiter waren als meine Brust.
»Ich komme seit 22 Jahren hierher«, sagte ich zum Barmann, als er mir mein Wechselgeld gab. Er zuckte die Achseln. »Kein Grund, jetzt damit aufzuhören.«
Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg zum Abschlussrennen der belgischen Cyclocross-Saison, dem Sluitingsprijs Oostmalle, der seit 1995 auf einem ehemaligen Luftwaffenstützpunkt nordöstlich von Antwerpen ausgetragen wird.
Während es in einem Großteil der Welt nur eine Randsportart ist, liegt Cyclocross den Flamen sehr am Herzen. Als ich mit Johan Museeuw sprach, dreimaliger Ronde-Sieger und ein Fahrer, der manchmal »der Letzte der Flandriens« genannt wird, chauffierte er gerade seinen Sohn zu einem Querfeldein-Rennen in Westflandern. Als ich ihn nach den Helden seiner Jugend fragte, sagte er: »Freddy Maertens, denn seine Eltern hatten eine Wäscherei nicht weit von uns zu Hause und wir sahen ihn oft beim Training; Eddy Merckx, weil, nun ja, er halt Eddy Merckx war; und Roger De Vlaeminck, denn er fuhr Cyclocross-Rennen, so wie ich.«
Museeuw war Juniorenmeister im Querfeldein-Radsport und begann eigentlich nur auf der Straße zu fahren, um sich für den Winter fit zu halten. Selbst als er als Profi in Diensten der italienischen Mapei-Mannschaft auf der Höhe seines Könnens war, sprach er Journalisten gegenüber wehmütig von dem Tag, an dem er den warmen Straßen der Toskana Lebewohl sagen und sein Rad wieder die nasskalten, bewaldeten Hügel des winterlichen Flanderns hinauftragen dürfte.
Für einen Außenstehenden war es schwer zu begreifen, was Museeuw, der ein echt gescheiter Mann zu sein schien, an diesem Sport so begeisterte. Cyclocross ist eines dieser Dinge, die auf den ersten Blick ein bisschen bescheuert erscheinen, sich bei näherer Betrachtung aber als vollkommen irrsinnig entpuppen. Es ist im Grunde ein Querfeldeinlauf, bei dem man eine schwere, unhandliche Last tragen muss und außerdem die Chance hat, vom Rad zu fallen. Die Flamen lieben außerdem auch Motocross, und zwar so sehr, dass Stefan Everts, ein Fahrer aus Bree in Limburg, fünfmal zu Belgiens Sportler des Jahres gewählt wurde, und damit sogar zweimal öfter als Tom Boonen. Eddy Merckx hat die Auszeichnung selbstverständlich häufiger erhalten als jeder andere.
Alles in allem denke ich, dass es interessant sein könnte, das »Cross«-Element auf andere Sportarten anzuwenden. Ich schätze, Turner sähen nicht ganz so keck aus, wenn sie das Sprungpferd erst einen matschigen Hügel hinauf und über einen Zaun hieven müssten, bevor sie darüber hinweg hopsen. Dass es so etwas nicht gibt, sagt vermutlich einiges über Radsportler aus.
Cyclocross ist ein nasser, kalter und dreckiger Sport, der wie ein Einwegticket ins Tal der Tränen aussieht, was natürlich der Grund ist, warum die Flamen ihn lieben. Und sie lieben ihn inbrünstig. Als 2015 die Weltmeisterschaft in Koksijde ausgetragen wurde, kamen 70.000 zahlende Zuschauer.
Ich ging nicht davon aus, dass die Veranstaltung in Oostmalle ebenso viele Leute anlocken würde, aber um auf der sicheren Seite zu sein, stieg ich bereits zu nachtschlafender Zeit in den Zug nach Antwerpen – die Sonne war gerade erst aufgegangen. Aufgrund der düsteren Februarwolken war allerdings nicht viel von ihr zu sehen, während der Zug nordwärts durch Vororte aus roten und gelben Backsteinhäusern ratterte, in deren länglichen Gärten bemerkenswert viel Viehzeug hauste. Ich entdeckte Hasenställe, Taubenschläge, Zwergziegen, Jakobschafe und, im Garten hinter einer 1970er-Jahre-Doppelhaushälfte inmitten einer Wohnsiedlung, sogar ein paar Shetland-Ponys. Ich war überzeugt, bis zum Ende der Reise wahrscheinlich auch noch ein Alpaka und womöglich ein paar Strauße in Gartenhaltung zu Gesicht zu bekommen, letztendlich aber standen die einzigen Strauße, die ich zu sehen bekam, auf einem Rieselfeld in der Nähe von Aalst.
Die Zugfahrt führte uns weiter raus aufs Land, hinaus in eine Landschaft gestutzter Weidenbäume, das Sonnenlicht kam über flachen Stoppelfeldern durch den Morgennebel zum Vorschein. Es war keine Menschenseele zu sehen außer einem Mann, der zwischen gepflügten Äckern einen Pfad entlanglief und dabei weniger wie ein Jogger aussah als wie jemand, der aus einer Strafkolonie entkommen war.
Im flachen, sumpfigen Waasland kamen wir an gepflegten, von schmalen Deichen flankierten Dorffußballplätzen mit Flutlichtmasten vorbei. Auf den Feldern sah man endlose Reihen von Polytunneln, wahre Phalangen von Treibhäusern, lang gezogene Aluminium-Schweineställe und Ansammlungen neu gebauter Einfamilienhäuser, manche davon in seltsamen Bauformen der Sorte, die den Anstoß für die populäre Website »Ugly Belgian Houses« gegeben haben. Der Fairness halber sollte ich anmerken, dass nicht alle Neubauten unansehnlich waren. Manche waren sogar überaus schick und elegant. Der große irische Radrennfahrer Sean Kelly, der den Großteil seiner Profikarriere in Vilvoorde bei Brüssel lebte, war so angetan von modernen belgischen Häusern, dass er durch ganz Flandern reiste, um Fotos zu schießen und sich Notizen zu machen, bevor er sein eigenes Haus im County Tipperary baute.
Wir kamen durch Bornem, am Ufer der Schelde gelegen, wo es haufenweise Ferienhütten gab, die alle ihren eigenen kleinen Anlegesteg hatten, und einen großen Teich, an dem Angler darauf warteten, dass etwas anbiss. Kurz hinter Niel überquerte eine Gruppe von 40 Radfahrern eine Stahlbrücke über die Schelde. Die Gruppe schwenkte in Formation nach links, fließend wie ein Schwarm tropischer Fische. Ich musste an die Eingangsszenen des großartigen deutschen Dokumentarfilms Die härteste Show der Welt denken, in denen sich das Peloton des Giro d’Italia die Serpentinen hinab nach Sorrento windet, ein wunderbares Stück Filmgeschichte, das die Schönheit des Sports so vortrefflich einfing wie kaum etwas anderes, was ich je gesehen habe.
Um nach Oostmalle zu gelangen, musste ich ab Antwerpen den Bus Nummer 417 in Richtung Herentals nehmen. Herentals ist ein Ort von ziemlicher Bedeutung für den flämischen Radsport. Er war die Heimat des großen Rik Van Looy, der in den 1950er und 1960er Jahren die Eintagesklassiker dominierte. Von den Fans erhielt er den Spitznamen »Kaiser von Herentals«. Geboren wurde er jedoch im nahe gelegenen Dorf Grobbendonk, was zugegebenermaßen nicht ganz so majestätisch klingt.
Als ich auf den Bus wartete, wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, wie Oostmalle aussah oder wo ich aussteigen müsste, wenn ich dort eintreffen würde. Zum Glück war der Bus vollgepackt mit Leuten auf dem Weg zum Cyclocross. Ich unterhielt mich mit zwei jungen Burschen mir gegenüber, die in Antwerpen lebten, ursprünglich aber aus der Gegend um Westmalle stammten, der Heimat einer weiteren berühmten Trappisten-Brauerei. Einer der beiden erkundigte sich, ob Querfeldein-Radsport auch in Großbritannien populär sei. Ich antwortete, dass dem nicht wirklich so sei und dass es nicht im terrestrischen Fernsehen liefe, was für mich aus irgendeinem altmodischen Grund noch immer das Maß aller Dinge war. Die Jungs aus Westmalle und ich plauderten über die Radsport-Fernsehberichterstattung in Belgien und Großbritannien. Einer der beiden meinte: »Ja, ich war mal in England, als die Tour de France lief, und sie zeigten nur die letzte Stunde des Rennens. Hier in Flandern ist es anders – bei uns zeigen sie nur die letzten 200 Kilometer.«
Er sagte, er würde sich vor allem deswegen auf das heutige Rennen freuen, weil er gehört hatte, dass in den Bars an der Strecke Bier aus Westmalle ausgeschenkt würde. Ich fragte ihn, ob er deswegen einen Apfel esse. Er lachte: »Ja, erst das hier und danach Bier – alle Nährstoffe, die ein Mann braucht.«
Das Picheln beim Cyclocross ist mehr oder weniger legendär. Mein Freund Jimmy fuhr mal zur Weltmeisterschaft in Koksijde und kehrte anschließend kopfschüttelnd zurück. »Mann, ich sage dir, die Belgier trinken ganz schön was weg«, meinte er, einen Mann mimend, der ein mit reichlich Pints beladenes Tablett trägt. Und wenn es ums Trinken geht, ist es gar nicht so einfach, einen Burschen aus Newcastle zu beeindrucken.
Ich war ohne jegliche Notizbücher in Gent eingetroffen. Ich fand welche in einem Laden namens Hema, der so ähnlich wie Woolworth ist und ein sonderbares Sortiment an Krimskrams feilbietet, von Koffern über Schlüpfer bis hin zu Schreibwaren und Wattestäbchen. Die Notizbücher gab es im Dreierpack und sie waren sehr preisgünstig. Erst als ich im Shuttlebus zur Cyclocross-Strecke eines aus meiner Tasche hervorholte, bemerkte ich, dass auf der Umschlagvorderseite in silbern glitzernden Lettern die Worte »Sei immer ein Einhorn« standen. Es war mir ein wenig peinlich, damit gesehen zu werden. Zum Glück schien es keiner zu bemerken, vielleicht abgelenkt von dem pinkfarbenen Glitzerstift, mit dem ich hineinschrieb.
Als ich meine zehn Euro Eintritt zahlte, kam ein Mädchen im Teenageralter vorbei, das einen Rauhaardackel an der Leine führte. Sie war in eine Fahne gehüllt, mit der sie ihre Zuneigung zu Wout Van Aert kundtat. Der ebenfalls in Herentals geborene Van Aert war erst 22 Jahre alt, aber bereits zweifacher Cyclocross-Weltmeister. Er war zudem schon zweimal belgischer Meister geworden und hatte zweimal den Gesamt-Weltcup und einmal die Superprestige-Wertung gewonnen. 2016 nahm Van Aert an seinem ersten großen Straßenrennen bei den Profis teil und gewann sogleich das Zeitfahren zum Auftakt der Belgien-Rundfahrt, immerhin vor Spezialisten wie dem Deutschen Tony Martin. Er war jung, hungrig, kraftvoll und schnell. Man verglich ihn bereits mit Roger De Vlaeminck und Johan Museeuw. Die flämischen Fans gingen davon aus, dass er noch eine letzte Cyclocross-Saison absolvieren und dann 2018 auf die Straße wechseln würde (was er dann auch tat, mit starken Leistungen gleich im ersten Frühjahr, darunter einer Podiumsplatzierung bei Strade Bianche, an einem Tag, an dem die Toskana standesgemäß von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht wurde). Fahrer wie Roger De Vlaeminck pflegten noch im Sommer auf der Straße und im Winter bei Querfeldein-Rennen anzutreten, aber heutzutage ist das nicht mehr möglich. Die Straßenteams lassen es nicht zu. Warum eine Verletzung riskieren, wenn die Fahrer auch im warmen Fitnessstudio auf dem Indoortrainer strampeln oder im Nahen Osten bei Sonnenschein und auf leeren Asphaltstraßen die Marke bewerben können? Van Aert war so gut, dass er enorme Erwartungen weckte. »Er wird ein Großer, ganz klar«, sagte der Apfelesser, bevor er auf typisch flämische Weise zurückruderte: »Auf jeden Fall… Naja, wahrscheinlich… Vielleicht.«
Ich zog los, um mir das Rennen der Junioren anzusehen, bei dem gerade ungefähr Halbzeit war. Die Strecke durch den Wald war nicht ganz das Schlammbad, das ich erwartet hatte. Der Parcous führte durch sandiges Heideland und wenngleich es ein paar kleinere steile Anstiege gab, war keiner mehr als 50 oder 60 Meter lang. Der Sand war allerdings tief und überall lugten diese biegsamen Wurzeln aus dem Boden hervor, die man sieht und denkt: »Oh, zum Glück bin ich nicht daran hängen geblieben, sonst hätte ich mich langgemacht.« Sie waren wie geschaffen dafür, Fahrer geradewegs über den Lenker oder mit einem verhakten Pedal in den Dreck zu befördern.
Ich fand eine nette Stelle nicht weit vom ersten bewaldeten Abschnitt. Die physische Stärke der jungen Teilnehmer war beeindruckend – an den steilsten Stellen sah man, wie sie Arme und Schultern einsetzten, um das Rad über die letzte Kuppe zu wuchten, und dabei die Muskulatur entwickelten, die einen Flahute ausmacht. Es waren aber vor allem die technischen Fähigkeiten, die ins Auge stachen: Die Kurven waren eng, es gab wenig Platz zum Manövrieren und zahlreiche Hindernisse, denen es auszuweichen galt, die Wechsel von flachen Passagen zu Anstiegen und von Geraden zu Kehren folgten Schlag auf Schlag. Es war nicht schwer zu erkennen, warum sich viele der besten Straßencracks – einschließlich des vermeintlich Merckx-mäßig siegeshungrigen Slowaken Peter Sagan – ihre Sporen beim Cyclocross verdient hatten.
Nach dem Ende des Rennens begab ich mich dorthin, wo die Team- und Fanbusse geparkt waren. Viele Zuschauer waren mit dem Rad gekommen. Ein paar Grundschüler in voller belgischer Nationalmannschaftsmontur sausten zwischen den Kiefern und am Ufer eines abgestanden aussehenden Teichs herum, in dem Jagdhunde tollten. Ich wich ein paar nassen Labradors aus und fand die Stände, an denen Schals, T-Shirts und Flaggen verkauft wurden, die Fahrern und Teams gewidmet waren. Mathieu van der Poel, genannt »Sniper« – »der Scharfschütze« –, hatte einen kompletten Stand für sich. Van der Poel, Cyclocross-Weltmeister von 2015, kam im nahen Kapellen zur Welt, also in Belgien, tritt aber für die Niederlande an. Sein Vater Adrie ist Niederländer. Adrie war seinerzeit ebenfalls Querfeldein-Weltmeister. Der Radrennsport hat auf beiden Seiten der Familie Tradition. Mathieus Großvater mütterlicherseits war kein Geringerer als Raymond Poulidor, einer der besten französischen Fahrer der 1960er Jahre.
Ich kaufte eine riesige Pudelmütze in den belgischen Nationalfarben, 30 Euro für etwas hinblätternd, von dem ich wusste, dass ich zu feige wäre, es jemals in der Öffentlichkeit zu tragen (dafür vielleicht im Bett beim Fußballgucken, wer weiß). Dann ging ich los, um mir etwas zu essen und zu trinken zu holen. Leider schien das versprochene Westmalle nur für diejenigen erhältlich zu sein, die für den VIP-Bereich bezahlt hatten, der aus einer Reihe weißer Partyzelte entlang der Zielgeraden bestand. Für das einfache Volk gab es nur Pilsner und Genever. Es ist umstritten, wer den Gin erfunden hat (»Genever« ist das Niederländische Wort für Wacholder, von dem sich der Name Gin ableitet). Es waren entweder die Niederländer oder die Flamen. Kaum jemand bestreitet aber, dass das in Flandern destillierte Zeug das Beste ist. Ich kaufte mir ausreichend Wertmarken, um ein Gläschen Genever zu bekommen, der warm und pur serviert wurde und schmeckte, als könnte er jegliche Magenbeschwerden kurieren (und auch ein paar Lungen- und Rachenprobleme), dazu kaufte ich eine große Tüte Fritten mit Samurai-Sauce. Selbst hier beim Cyclocross wurden die Pommes auf Bestellung frisch zubereitet, das Öl in den Fritteusen blubberte wie ein Kessel voller Aale. Ich habe im Laufe der Jahre jede einzelne Sauce probiert, die in belgischen Frittenbuden angeboten wird, und mich irgendwann auf Samurai festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Art rötliche Mayonnaise, die ungefähr wie diese Grillwürstchen schmeckt, die Vati mal aus Versehen in Spiritus getränkt hat, weil er eine Dose Bier zu viel intus hatte und genervt war, dass die Kohle nicht ordentlich brannte.
Während ich großzügig Sauce über meine Stiefel verteilte, rollte Jelle Camps, der Sieger des Juniorenrennens, mit einem riesigen Blumenstrauß in der rechten Hand vorbei. In der Rückentasche seiner Aufwärmjacke steckte eine 0,75-Liter-Flasche Westmalle Tripel. Als er sich den Weg durch die Menge bahnte, machten mehrere ältere Kerle, zur allmählich nachlassenden Erheiterung der Frauen um sie herum, scherzhaft Anstalten, sie ihm zu stibitzen.
Abgesehen vielleicht von Wimbledon oder britischem Wrestling in den 1970er Jahren, war ich, glaube ich, bei keinem hochrangigen sportlichen Ereignis, das so viele Frauen anlockte. Wenn auch nicht ganz 50:50, so ist das Verhältnis bei flämischen Cyclocross-Rennen gewiss 40:60. Und den Gedanken, diese Frauen würden von ihren Ehemännern und Freunden hergeschleppt werden, kann man rasch verwerfen. Es gibt jede Menge Gruppen von einem halben Dutzend Frauen ohne männliche Begleitung – die Sorte ausgelassener Cliquen, die man abends in jeder englischen Stadt um die Häuser ziehen sieht. Auch sind alle Altersklassen vertreten, von Grundschülerinnen bis zu weißhaarigen Omas. Radsport ist in Flandern für alle da, nicht nur für Kerle.
Man sieht Dutzende Menschen in speziellen Anoraks, die ihre Unterstützung für diesen oder jenen Fahrer kundtun. Auch selbstgemachte Banner sind in riesiger Zahl zu entdecken. »Sweeck – You Never Walk Alone« stand auf einem, der mir insbesondere deshalb auffiel, weil mir die Frau, die das Teil herumschwenkte, damit gegen den Kopf schlug. Sie konnte nichts dafür. Sie versuchte nur zu verfolgen, wie Laurens Sweeck sich durch ein Gelände wühlte, das wie ein Beachvolleyball-Feld aussah. Als sie es zum zweiten Mal tat, beschloss ich, weiterzuziehen.
Zwischen den Rennen dröhnte gnadenlos Musik aus den Lautsprechern. Es war die Art grauenhafter, wummernder Europop, von der man meint, sie sei vor zehn Jahren aus der Mode gekommen, was überall sonst auf der Welt vermutlich auch der Fall war. Man muss sagen, dass es viele liebenswerte Dinge an Flandern gibt, aber die Musik, die an öffentlichen Orten gespielt wird, zählt nicht dazu. Falls Sie zu den Menschen gehören, die behaupten, sich umzubringen, wenn sie noch einmal »The Ketchup Song« hören müssen, rate ich Ihnen, nicht ohne Waffe nach Belgien zu reisen. Selbst in Hipster-Cafés werden Sie, während Sie einen gegrillten Seitan-Burger im Sauerteigbrötchen an handgepflücktem Bio-Mizuna essen, Eric Claptons »Wonderful Tonight« ertragen müssen.
Beim Cyclocross hätte Clapton allerdings keine Chance. Dafür ist er zu trendy. Hier sind die Ansager eher erpicht darauf, die Menschen zu erinnern, dass Belgien das Land ist, das uns Patrick Hernandez’ »Born to Be Alive« geschenkt hat, einen Song, über den das Beste, was man sagen kann, ist, dass die schwedische Version noch grauenhafter ist.
Zwischen dem Junioren- und dem Frauenrennen hatten Hobbyfahrer die Gelegenheit, sich auf der Strecke zu versuchen. Ich vermutete, dass der eigentliche Zweck darin bestand, das Gelände ein bisschen aufzuwühlen, um es den Elite-Fahrern schwerer zu machen. Vor allem aber verdeutlichte es mir, wie hart der Parcours war und wie leicht es die Profis aussehen ließen. Selbst Kerle in hautengem Elastan, die wie Windhunde gebaut waren, mussten absteigen und ihre Räder Anstiege hinauftragen oder -schieben, die zuvor von den Junioren noch scheinbar mühelos hinaufgepflügt worden waren, wobei die besten Fahrer kaum in Verlegenheit gebracht wurden von den steilen, sandigen Rampen, die den etwas minder talentierten Kontrahenten jegliche Energie aus Waden und Oberschenkeln zu saugen schienen. Ein älterer Bursche in voller Rennmontur und mit dem Gesicht und Körperbau des späten Les Dawson schob sein Rad praktisch über den gesamten Parcours und erhielt dafür Applaus und Anfeuerungen von jedem, den er passierte. Das Picheln wurde seinem Ruf vollauf gerecht.
Ich habe ein Alter erreicht, in dem ich nicht mehr so lange stehen kann wie früher. Als das Rennen der Frauen bevorstand, hatte ich bereits angefangen, recht neidisch auf die Leute zu blicken, die Jagdsitze mitgebracht hatten. Ich machte mich auf den Weg in einen der bewaldeten Abschnitte und entdeckte schließlich einen Baum, an dem noch kein anderer alter Knacker lehnte. Er stand zuoberst einer engen Schneise, in der der Sand tief genug war, um jemanden darin zu begraben.
Zwei ältere Männer, die mit ihren blassen Teints und blauen Skimützen wie invertierte Schlümpfe aussahen, hatten eine strategisch günstige Position an einer engen Kehre etwa auf halber Höhe des Anstiegs bezogen. Jedes Mal, wenn ein Fahrer zu Fall kam oder von der Steilheit des Geländes zum Stillstand gebracht wurde, reagierten sie, als wäre es ein persönlicher Triumph, klatschten in die Hände und klopften sich gegenseitig auf den Rücken. Sportreporter mochten sich ja vielleicht von müheloser Anmut beeindrucken lassen, diese flämischen Veteranen aber wollten die Fahrer leiden sehen.
Sanne Cant aus Antwerpen war mehrfache belgische Meisterin und hatte auch bereits mehrere Male die EM gewonnen, aber sie hatte bis zu dieser Saison warten müssen, um sich erstmals den Weltmeistertitel sichern zu können. Der Weg zum Regenbogentrikot war ihr lange von der besten Cyclocross-Fahrerin aller Zeiten versperrt worden, Marianne Vos aus den Niederlanden. Nachdem sie Vos endlich besiegt hatte, schien die 26-jährige Belgierin nun nicht mehr zu stoppen. Sie war an diesem Tag so viel besser als alle anderen Starterinnen, dass es eher einem Triumphzug als einem Rennen glich. Hinter ihr folgten ihre flämische Landsfrau Laura Verdonschot und die Niederländerin Maud Kaptheijns, aber beide lagen schon zur Halbzeit weit zurück. Cant fuhr die ganze Zeit über mit einem breiten Grinsen im Gesicht, aus purer Freude an ihrem eigenen meisterhaften Können.
Sobald das Eliterennen der Männer gestartet wurde, war klar, dass es noch weniger umkämpft sein würde als die Frauenkonkurrenz. Van Aert brauchte nicht mal eine Runde, um das Feld in seine Einzelteile zu zerlegen. Als er zum ersten Mal den asphaltierten Abschnitt erreichte, lag er bereits 20 Sekunden vor dem nächsten Verfolger; bis zum Ende der zweiten Runde war der Vorsprung auf 30 Sekunden angewachsen.
Ich hatte mich inzwischen von den niederträchtigen Zelebranten des Unglücks entfernt und befand mich an der Stelle, wo die Fahrer den Wald verließen, nachdem sie zwei über die Strecke gelegte Holzbretter überwunden hatten. Die Hindernisse waren ungefähr einen halben Meter hoch. Van Aert stieg ab, schulterte sein Rad und trug es mit einer spielerischen Leichtigkeit über sie hinweg, die ihm jahrelanges Training abverlangt haben musste. Sein Hauptkonkurrent, David van der Poel (der jüngere Bruder des Snipers), hopste derweil eher wie ein Hase über die Zäune, was zwar cooler aussah und einer Horde Teenager Ausrufe der Bewunderung entlockte, ihn aber eher zu bremsen schien.
Ich stand dort, wo die Sandpiste auf den Asphalt traf, was mir einen guten Blick auf den letzten bewaldeten Abschnitt und die Zielgerade erlaubte. Wie es der Zufall wollte, stand ich außerdem neben dem Streckenposten, der die Aufgabe hatte, die Nachzügler auszusortieren, die aus dem Zeitlimit gefallen fahren. Er war ein stämmiger älterer Herr mit einer Lotto-Baseballkappe, einem dichten Walross-Schnauzbart und dem behäbig gutmütigen Aussehen eines Bernhardiners. Er hatte ein Klemmbrett, eine Stoppuhr und eine Assistentin, eine blonde Frau in einer dicken Jacke. Sobald die beiden die Zeiten berechnet hatten, trat der große Mann auf die Strecke und winkte die Fahrer, die zu weit zurücklagen, durch eine Lücke in der Umzäunung hinaus. Er tat dies mit einem konzilianten Lächeln, das vermitteln sollte, wie sehr ihn seine Aufgabe schmerzte – wie ein Tierarzt, der einem mitteilt, dass es der Hamster der Kinder leider nicht schaffen wird. Die Fahrer schienen es ihm zu danken, schenkten ihm ein reumütiges Schmunzeln und zuckten die Achseln, als wollten sie sagen, dass ihnen klar ist, dass er nur seinen Job machte.
Als der erste Fahrer durch die Umzäunung gewinkt wurde, hielt er an und wurde sofort von zwei kleinen Jungen bestürmt, dem Aussehen nach Brüder, die aufgeregt anfingen, ihn etwas auf Flämisch zu fragen. Der Fahrer war ein drahtiger Bursche mit hellem Haar. Er sah die Jungen freundlich an und versuchte, zu verstehen, was sie sagten. Wie sich herausstellte, war er Engländer. »Die beiden hätten gern Ihre Startnummern als Souvenir«, erklärte der Vater der Jungen.
»Ah, okay«, sagte der Fahrer, löste die Nummern vom Trikot und reichte sie ihnen. »Ich weiß allerdings nicht, ob man sich unbedingt an mich erinnern muss.«
»Hey, Sie sind früh gestürzt«, sagte der Vater. »Schwer, sich davon zu erholen.«
»Auch ohne das schwer genug«, antwortete der Engländer. »Sie werden es nicht glauben, aber drüben in England gewinne ich sogar Rennen. Doch hier…« Er hob die Brauen. Das war die Sorte Selbstironie, die man in Flandern zu schätzen weiß.
»Hat es Ihnen trotzdem Spaß gemacht?«, fragte der Vater.
»Klar, war ein Riesenspaß«, antwortete der Fahrer mit aufrichtiger Überzeugung. »Um die Wahrheit zu sagen, bin ich südenglischer Meister. Südbelgischer Meister wäre allerdings um einiges schwerer.«
Der Vater dankte ihm für seine Zeit und die Startnummern, und der Fahrer rollte langsam in Richtung Parkplatz zu dem Van, in dem er sich vermutlich umgezogen hatte. Weitere Fahrer wurden aus dem Rennen genommen und ich sah zu, wie sie in Empfang genommen wurden – die jüngeren von Freundinnen, die ihretwegen untröstlich schienen, die älteren von Ehefrauen, die geduldig den Erklärungen für das jeweilige Scheitern lauschten und dabei eine Miene zogen, als würden sie darüber nachdenken, dass sie heute Morgen echt die Bettwäsche hätten wechseln sollen. Mütter waren bekümmert und bisweilen erbost über andere Fahrer, die ihren Sprösslingen in die Quere gekommen waren; Väter waren strenger und erteilten gute Ratschläge: »Also, da hättest du besser… Worauf es ankommt, ist, dass du die Kurven triffst…«
Van Aert flog derweil über die Strecke wie eine unaufhaltsame Naturgewalt. Er war so viel besser als alle anderen, dass es für die Menge kaum etwas gab, über das sie hätte in Wallung geraten können, allerdings beschloss ein Fan mit einer riesigen flämischen Flagge für seine eigene Unterhaltung zu sorgen, indem er sie absichtlich senkte, so dass sie van der Poel ins Gesicht schlug. »Bitte schwenken Sie keine Fahnen über der Strecke, vielen Dank«, tadelte der Ansager auf Niederländisch, Französisch und Englisch. Es hätte schlimmer kommen können. Bei den Weltmeisterschaften 2016 in Heusden-Zolder hatten belgische Fans den Niederländer Lars van der Haar mit Bierbechern beworfen, von denen manche noch voll waren.
Van Aert gewann mit fast einer Runde Vorsprung vor Tom Meeusen aus Brasschaat, einer äußerst wohlhabenden kleinen Stadt unweit von Antwerpen. Van der Poel wurde Dritter. Ich ging zurück zum Shuttlebus. Vor mir begann eine Gruppe Frauen in roten Anoraks, die ihre Treue zu Toon Aerts kundtaten, zu den Klängen von »Hands Up (Give Me Your Heart)« von Ottawan zu tanzen, indem sie mit den Hüften kreisten und pantomimisch andeuteten, sie würden reihenweise Biere kippen. Ein Mann mittleren Alters mit Lodenmantel und ledernem Cowboyhut schwankte an ihnen vorbei. Er trug das schelmische Grinsen eines Mannes zur Schau, der so sturzbesoffen ist, dass er glaubt, niemand sonst würde es bemerken. Alle hatten ihren Spaß gehabt.
Die Anfänge des Querfeldein-Radsports sind unklar, die meisten Leute schreiben seine Erfindung jedoch dem Franzosen Daniel Gousseau zu. Eins der Dinge über das Fahrrad, das man leicht vergisst, ist, dass bis zu seinem Aufkommen das Pferd das populärste Transportmittel war. Pferde sind teuer in der Anschaffung und Haltung und waren für die meisten einfachen Leute nicht erschwinglich. Das Fahrrad veränderte die Lage. Es war vergleichsweise billig zu haben und günstig in der Instandhaltung. Man könnte sagen, es war das Ross des arbeitenden Mannes. Gousseau jedenfalls schien dieser Ansicht zu sein. Als Gefreiter der Armee gewöhnte er sich an, die Läufe durchs Gelände, die die Offiziere zu Pferde absolvierten, auf dem Fahrrad zu bewältigen. Bald hatten sich etliche Nachahmer gefunden. Für die Radhersteller war die Vorstellung, dass das, was sie produzierten, ein für jegliches Gelände taugliches Vehikel war, ohne Frage ein Bonus. Gousseau richtete die ersten offiziellen Cyclocross-Rennen aus und rief 1902 die französischen Meisterschaften ins Leben.
Belgien war das nächste Land, das den neuen Sport für sich entdeckte, und organisierte erstmals 1910 eine eigene nationale Meisterschaft. Der damalige Sieger war der Basset, Philippe Thys. Wer Zweiter und Dritter wurde, ist nicht überliefert, was womöglich das berühmte Bonmot aufkommen ließ, demzufolge im Radsport und insbesondere im flämischen Radsport eine einfache Regel gelte: Entweder du gewinnst das Rennen oder du bist Letzter.
Die Popularität des Cyclocross breitete sich nach und nach in ganz Europa aus, gefördert durch die Tatsache, dass der Sieger der Tour de France von 1910, Octave Lapize, seinen Erfolg dem Umstand zuschrieb, sich den Winter über durch den Morast gewühlt zu haben. Das erste »Critérium international de cross cyclo-pédestre« – der Vorläufer der heutigen UCI-Weltmeisterschaft im Querfeldein-Radsport – wurde 1924 vor den Toren von Paris ausgetragen. Gewonnen wurde das Rennen vom Franzosen Gaston Degy. Die beiden Flamen Henri Moerenhout und Theo Van Eetvelde belegten die Plätze zwei und drei. Im darauffolgenden Jahr setzte Moerenhout einen drauf und sicherte sich den ersten Platz; mit Jos Van Dam holte ein weiterer flämischer Fahrer Silber.
Im Großen und Ganzen dominierten die Franzosen weiter das Rennen, gleichwohl wurde der Belgier Georges Ronsse 1928 und 1930 Zweiter sowie 1931 noch mal Dritter. Ronsse hatte den verträumten Blick und die große ebenmäßige Nase der Muminfiguren von Tove Jansson. Er kam aus Antwerpen und war zweifacher belgischer Cyclocross-Meister. Zudem war er 1928 und 1929 Straßenweltmeister der Profis, gewann zweimal Paris–Roubaix, dreimal Bordeaux–Paris und war außerdem Sieger von Lüttich–Bastogne–Lüttich, Paris–Brüssel und beim Scheldeprijs, Fünfter der Tour de France und dreifacher belgischer Meister auf der Bahn. Ronsse fuhr für die starke französische Automoto-Mannschaft.
Der große Sylveer Maes – zweimaliger Sieger der Tour de France – war der nächste flämische Cyclocross-Fahrer, der das »Critérium international« gewann, als er 1933 zum Sieg stürmte. Im Jahr darauf sicherte sich Maurice Seynaeve aus Westflandern den obersten Platz auf dem Podium, Maes wurde Zweiter. Seynaeve, der von 1934 bis 1937 belgischer Meister im Cyclocross war, gewann 1936 erneut. Anders als Ronsse und Maes war er kein Allrounder und nahm nur selten an Straßenrennen teil, dennoch war er gut genug, um 1928 Dritter der Ronde van Vlaanderen zu werden. Fotos von Seynaeve vermitteln einen recht exzentrischen Eindruck von den Anfangstagen des Querfeldein-Radsports. Auf einem sieht man ihn beim Training in dickem Wollpullover und Kniebundhosen, auf einem anderen ist er praktischer gekleidet, in langärmeligem Polohemd und Shorts, dazu trägt er einen Helm, der aussieht wie eine lederne Melone mit Ohrenschützern. Bei einer Siegerehrung schützt sich der Champion gegen die winterliche Kälte mit etwas, das wie ein Morgenmantel für Damen aussieht, bei einer anderen trägt er ellenbogenlange Stulpenhandschuhe.
Nach Seynaeve übernahmen wieder die Franzosen das Kommando. Selbst der tapfere Jef Demuysere, belgischer Cyclocross-Meister des Jahres 1932, konnte sie nicht bezwingen. Robert Oubron, Roger Rondeaux und André Dufraisse dominierten die Rennszene von den späten 1930er Jahren bis in die 1950er hinein.
1950 wurde dann die erste Cyclocross-Weltmeisterschaft ausgetragen. Es gewann der Franzose Jean Robic. Die Flamen schienen den Anschluss verloren zu haben, und während Italiener, Schweizer und Westdeutsche Titel gewannen, holten sie bei den ersten 13 Austragungen der WM gerade mal einen Podiumsplatz, in Person von Firmin Van Kerrebroeck, der 1957 Zweiter wurde. Die Durststrecke endete 1966, als Erik De Vlaeminck, der Bruder von Roger, Gold gewann. Er holte den Titel noch fünf weitere Male und da auch sein Bruder Roger sowie Berten Van Damme (bekannt als »Löwe von Laarne«) erfolgreich waren, übernahmen die Flamen die fast vollständige Kontrolle über den Wettbewerb. Seit Einführung der Welttitelkämpfe im Cyclocross hatten die Flamen bis zum Zeitpunkt meines Besuchs in Oostmalle 68 WM-Medaillen im Eliterennen der Männer geholt, doppelt so viele wie jede andere Nation. Fahrer aus Flandern hatten allein in diesem Jahrhundert bereits zwölfmal den Weltmeister gestellt und in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005 und 2012 die ersten drei Plätze belegt. Mario De Clercq aus Oudenaarde (Weltmeister 1998, 1999 und 2002), Erwin Vervecken aus Herentals (2001, 2006, 2007) und Sven Nys, »der Kannibale aus Baal« (2005, 2013), wurden zu Nationalhelden, und es gab kaum einen Flamen, der nicht eine Schwäche für den bedauernswerten Kevin Pauwels aus Ekeren gehabt hätte, der es fertigbrachte, zwischen 2011 und 2017 fünfmal Dritter zu werden.
Der vielleicht größte Cyclocross-Fahrer von allen aber war Roland Liboton aus Rillar unweit der bedeutenden Universitätsstadt Leuven in Flämisch-Brabant. Liboton war belgischer Meister von 1980 bis 1989, gewann viermal den WM-Titel und wurde einmal Zweiter. Es sagt einiges über sein Können aus, dass die meisten flämischen Radsportfans trotz dieser Erfolge bei der Erwähnung seines Namens eher wehmütig lächeln, etwas über Enttäuschungen murmeln und die Frage in den Raum stellen, was hätte sein können.
Liboton war schon in jungen Jahren als Ausnahmetalent erkannt worden. Er war 1976 belgischer Cyclocross-Meister der Junioren, gewann 1977 die Militär-Weltmeisterschaft und 1978 den WM-Titel der U21-Kategorie. Gemeinhin unter der Kurzform Roel bekannt, fuhr Liboton anschließend bei den Senioren dreimal in Folge souverän den Sieg ein, den ersten mit gerade mal 22 Jahren. Er war überragend in den Bergauf-Passagen, unschlagbar in den Abfahrten und uneinholbar im Flachen. Er konnte sprinten und klettern, technisch war er ebenso geschickt wie brillant. Er hatte Mut und Schneid. In der Saison 1983/84 ging er bei 30 Rennen an den Start und gewann davon 28, inklusive der WM, ein Sieg, den er trotz der Einmischung eines niederländischen Fans einfuhr, der auf die Strecke sprang und ihn in den Magen boxte. Kein Wunder, dass die Leute von ihm als dem Eddy Merckx des Querfeldein-Radsports sprachen.
Aber dann ging plötzlich alles schief. 1985, bei der WM in München, wo er als derart haushoher Favorit an den Start ging, dass man sich fragte, warum die anderen überhaupt antraten, quälte sich Liboton, der unbeständig und weit unter seinen Möglichkeiten fuhr, auf den zehnten Platz. 1986 erwartete man, dass er sich seinen Titel zurückholen und die Konkurrenz auf einem matschigen Kurs in Lembeek, der wie auf ihn zugeschnitten zu sein schien – und es wahrscheinlich auch war –, nach allen Regeln der Kunst vorführen würde. Doch statt seine Rivalen in Merckx-Manier zu vernichten, fuhr Liboton, als würde er das Schlimmste befürchten, und gab bereits in der zweiten Runde auf. 1988 schaffte er es nicht einmal an den Start, als er in letzter Minute wegen einer vorgeblichen Erkrankung seine Teilnahme zurückzog. Ich weiß nicht, ob es im Radsport so etwas wie Yips oder Lampenfieber gibt, aber falls doch, so schien Liboton darunter zu leiden. Flämische Radsportjournalisten schrieben diesen Kollaps einer lähmenden Angst vor dem Scheitern zu, Liboton selbst aber wies diesen Gedanken später von sich und meinte, seine Kritiker würden seinen Kontrahenten nicht den Respekt erweisen, den diese verdienten.
Obwohl er in Belgien weiterhin dominierte, waren seine Tage als internationaler Champion gezählt. Als er 1990 auch den belgischen Meistertitel verlor, gab er den Radsport praktisch auf. Liboton hatte zwar vier WM-Titel gewonnen, doch sein Potenzial blieb unerfüllt, zumindest in den Augen der Fans.
Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, sich über die jüngere Fahrergeneration auszulassen. In seinem späteren Leben wurde er zu einem dieser Sportsleute im Ruhestand, die alle, die nach ihnen kommen, bei jeder Gelegenheit als charakterlose, verwöhnte Weichlinge abkanzeln. 2015 feuerte ihn der belgische Radsportverband als Trainer, nachdem er die Fahrer der Nationalmannschaft – darunter Wout Van Aert und Sven Nys – dafür zur Schnecke gemacht hatte, dem Niederländer Mathieu van der Poel den Sieg quasi geschenkt zu haben und anschließend um die Häuser gezogen zu sein. »Sie haben alle versagt und dann tanzen sie oben ohne wie Frauen um eine Stange, einfach widerlich«, ereiferte er sich in der Presse. Später meinte er, die aktuellen Fahrer hätten »nicht die Eier« seiner Generation. Wout Van Aert mochte ja der nächste große flämische Radrennfahrer sein, aber in Libotons eifersüchtigen Augen war er kein Flandrien.