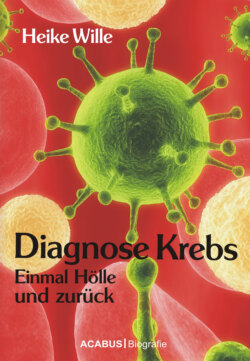Читать книгу Diagnose Krebs. Einmal Hölle und zurück - Heike Wille - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel
Die Diagnose
Оглавление1
Mein Leben ist gewiss nicht arm an Schicksalsschlägen. Weder an eigenen noch an solchen, die sich in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis zugetragen haben.
So kam 1988 unser Sohn Marcel als Siebenmonatskind zur Welt und musste die ersten sechs Wochen seines Lebens im Brutkasten auf der Intensivstation verbringen. Mitte 1990 musste ich mich wegen massiver Rückenprobleme einer Brustverkleinerung unterziehen. Direkt im Anschluss an diese OP wurde ich lungenkrank: Ich bekam eine Sarkoidose. Bei dieser Krankheit bilden sich in den betroffenen Organgeweben mikroskopisch kleine Knötchen, sogenannte Granulome. Es können praktisch alle Organe betroffen sein, bei mir beschränkte sich die Erkrankung auf die Lunge. Meine Lymphdrüsen waren geschwollen, ich war chronisch müde und hatte Husten und Atemnot. Die Krankheit wurde mit hoch dosiertem Kortison behandelt. Infolge der Behandlung nahm ich enorm zu, bis ich am Ende bei einer Körpergröße von 178 cm 120 Kilo wog. Meine Nerven lagen blank und der Neurologe, zu dem mich mein Hausarzt schickte, verschrieb mir starke Beruhigungsmittel, die mir auf Dauer das Gefühl gaben, neben mir herzulaufen.
Zwei Jahre ging das so, bis ich mich selbst am eigenen Schopf aus diesem Sumpf herausgezogen habe. Doch 1992 wurde die Brust wieder dick und am Bauch hatte sich eine Fettschürze gebildet.
Erneut suchte ich den Arzt auf, einen Chirurgen, der damals im Marienhospital in Osnabrück tätig war, heute ein bekannter Spezialist für Brustkrebspatienten ist und mir schon beim ersten Mal geholfen hatte. Er sah sofort die Notwendigkeit einer OP. „Allerdings”, hatte er mit bedenklicher Miene hinzugefügt, „muss die Krankenkasse einwilligen.“
Das dürfte ja kein Problem sein, dachte ich – und hatte nicht damit gerechnet, dass der mich begutachtende MDK mir unterstellen könnte, ich hätte mir meine Polster angefressen. Entgegen diverser Bescheinigungen, die ich als Belege dafür eingereicht hatte, dass mein Übergewicht die Folge der medikamentösen Behandlung war, musste ich mir sagen lassen: „Nimm erst mal 30 Kilo ab, dann werden wir weitersehen!”
Wochenlang musste ich die Krankenkasse mit Anrufen belästigen, bis sie endlich ein Einsehen hatte und die OP als medizinisch notwendig einstufte.
Zu all diesen persönlichen gesundheitlichen Katastrophen kamen noch jene, die sich in meinem Umfeld ereigneten. Die mit Abstand schlimmste geschah im Februar 2002. In diesem Monat verlor ich meine beste Freundin Steffi. Sie hatte Eierstockkrebs und starb an einem grauen, eisigen Abend im Franziskus-Hospital zu Osnabrück. Erst am nächsten Morgen erfuhr ich von ihrem Tod.
Ich war gerade aufgestanden, als das Telefon klingelte. Als ich die Stimme ihrer Mutter hörte, wusste ich intuitiv, was geschehen war, noch bevor sie es mir erklärte. Ihre Worte hörte ich kaum noch und nur wie durch Watte gedämpft. Die schlagartige Erkenntnis, dass ein geliebter Mensch für immer aufgehört hatte zu atmen, versetzte mir einen Schock, der mich sprachlos machte.
Ich bin mir sicher: Hätte ich meinen lieben Mann Horst in diesen schweren Zeiten nicht an meiner Seite gehabt, und hätte es unseren Sohn Marcel nicht gegeben – ich hätte mich in meine Trauer ergeben und nur Gott allein weiß, wohin sie mich gespült hätte.
Doch so kräftezehrend und belastend all diese Ereignisse auch gewesen sein mögen, was sich zum Jahresende 2004 ankündigte, sollte alles Vorangegangene in den Schatten stellen und mich bis an den Rand der Selbstaufgabe führen.
Angefangen hatte alles ganz harmlos mit der jährlichen Vorsorgeuntersuchung bei meiner Gynäkologin. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, diese wichtigen Untersuchungen jeweils im September durchführen zu lassen, damit ich einen Monat darauf, am 17. Oktober, beruhigt meinen Geburtstag feiern und danach mit neuen Kräften ins nächste Jahr starten konnte.
So sollte es auch 2004 sein. Allerdings hatte ich mich schon seit einiger Zeit matt und abgeschlagen gefühlt. Ich führte das auf meine Arbeit zurück, denn ich war damals als Teilzeitkraft in der Tagespflege bei den Westerfeld Sozialeinrichtungen in Belm tätig. Gelernt habe ich ursprünglich Arzthelferin. Ich habe in diesem Beruf mehrere Jahre gearbeitet, unter anderem in einer gynäkologischen Praxis, bin dann aber aus persönlichen Gründen in die Pflege gewechselt, da mir der unmittelbare Umgang mit Menschen einfach mehr liegt als das Verwalten ihrer Krankenakten. Doch so groß die Freude und die Befriedigung auch waren, die ich in meiner Arbeit fand, so war sie auch kräftezehrend und anstrengend. Da kam eine derartige Erschöpfungsphase nicht gerade überraschend.
Meine Gynäkologin ist eine supernette, ruhige Frau von Mitte fünfzig, die sich noch Zeit für ihre Patienten lässt und niemals auf die Uhr schaut. Das mag für den einen oder anderen Patienten, der in ihrem Wartezimmer sitzt, schon mal ein kleines Problem darstellen. Aber sobald man selbst von ihr behandelt wird, ist man ihr dankbar für die Zeit.
Sie führte bei mir die üblichen Untersuchungen durch, machte einen Abstrich und eine Vaginalsonografie. Während der Untersuchung bemerkte ich plötzlich ein Zögern.
„Stimmt was nicht?“ Ich versuchte aus meiner liegenden Position einen Blick auf den Monitor zu werfen.
„Sie haben da …“, murmelte meine Gynäkologin, während sie weiter untersuchte, was für mich auf dem Monitor nur ein grünes Schattenspiel war, „ …eine Zyste am linken Eierstock.”
Ich war beunruhigt und gerade auch durch den Verlust von Steffi noch zusätzlich alarmiert.
Obwohl ich durch meinen Beruf wusste, dass ich auf meine nächste Frage seriöserweise keine eindeutige Antwort erhalten konnte, stellte ich sie trotzdem: „Ist sie bösartig?”
„Das kann ich so nicht beurteilen. Die Zyste ist schon ziemlich groß. Das bedeutet, es besteht eine gewisse Hoffnung, dass sie noch platzt und sich das Problem auf diese Weise von selbst löst. Aber ob das tatsächlich geschieht, ist fraglich.” Sie lächelte mich beruhigend an. „Ich schicke Sie lieber nach oben ins Krankenhaus.” Damit meinte sie das Franziskus-Hospital Harderberg nahe Osnabrück. „Die sollen das mal abklären. Ich mache gleich einen Termin in der Gynäkologie für Sie.” Sie sah mich aufmunternd an. „Nun machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Wille”, redete sie mir gut zu, „das ist alles nur Routine.”
Wenn ich daran denke, wie oft ich diesen Satz noch hören sollte …
Emotional saß ich zwischen allen Stühlen: Angst wechselte sich mit Hoffnung ab, Verzweiflung mit Zuversicht. Vor Horst und insbesondere vor unserem Sohn Marcel versuchte ich, mich zusammenzureißen und mir nichts von meiner inneren Anspannung anmerken zu lassen.
2
Der mich untersuchende Oberarzt war ein sehr angenehmer, souverän wirkender Mann. Er hatte eine tiefe, sonore Stimme, die sofort Vertrauen einflößte.
„Ja, Frau Wille”, kam er dann auch gleich nach der Vaginalsonografie auf den Punkt, „Sie sind ja nun auch schon 43 Jahre alt. Beginnende Wechseljahre und so weiter, wie das so ist …“ Er lächelte vor sich hin und sah auf. „Die Zyste kann platzen und dann wäre das Problem gelöst.”
Auf meine zaghafte Frage, ob sich womöglich etwas Schlimmeres dahinter verbergen könne, winkte er nur ab.
„Da kann ich Sie beruhigen, das ist nichts weiter als eine etwas zu groß geratene Zyste. Hoffen wir, dass sie in den nächsten sechs Wochen von selbst platzt, dann können Sie sich eine OP ersparen. Andernfalls müssten wir einen Termin vereinbaren.”
So verblieben wir.
„Und?”, erkundigte sich Horst, der mich begleitet hatte und im Wartezimmer auf mich wartete. „Was hat die Untersuchung ergeben?”
„Der Doktor hat mir im Grunde dasselbe gesagt wie meine Gynäkologin“, berichtete ich ihm.
„Wir können also nichts weiter tun, als abzuwarten?“, fragte Horst.
„So sieht’s leider aus“, seufzte ich, indem ich mir ein Lächeln abrang, das Horst tapfer erwiderte. Aber ich kannte ihn viel zu gut, um durch sein Lächeln hindurch nicht die Besorgnis zu bemerken, und ihm mochte es mit mir nicht anders gegangen sein.
Im Vorzimmer bekam ich einen weiteren Termin zum Nachschauen in sechs Wochen und dann ging es auch schon wieder nach draußen. Aber irgendwie begleitete mich auf meinem Weg ein mehr als ungutes Gefühl. Während ich an Horsts Seite über das Klinikgelände zu unserem Auto ging, war es plötzlich ganz stark da, wie Wolkenschatten, die plötzlich drohend über mir standen und alles um mich herum in einem eigentümlich und seltsam veränderten Licht erscheinen ließen.
Angefangen hatte es wohl schon in der Praxis meiner Gynäkologin, nur hatte ich es da noch nicht so deutlich wahrgenommen. Irgendwo in einem versteckten Winkel meines Hinterkopfes hatte es damals schon Klick gemacht. Aber erst jetzt, als ich schweigend neben meinem Mann ging, begann es, sich in mir auszubreiten. Zwar noch undeutlich und unklar empfand ich jedoch schon jetzt ein deutliches Gefühl der Bedrohung, das ich nicht näher beschreiben konnte.
Mit diesem Gefühl stieg ich ins Auto. Horst mochte instinktiv spüren, was mit mir los war, denn er sagte kein Wort und wir fuhren schweigend nach Hause, wo die zermürbende Warterei in die nächste Runde ging. Während der gesamten sechs Wochen folterten mich die Gedanken an dieses Ding, das da in mir war.
Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass diese verdammte Zyste einfach platzen und sich in Nichts auflösen würde. Schließlich war es ja auch nur ein mit Wasser gefülltes Nichts. Die Ärzte hatten es mir doch gesagt!
3
Nach Ablauf der Frist nahm ich meinen Krankenhaustermin wahr. Wieder war es ein Montagmorgen. Ich hatte eine unruhige Nacht hinter mir und entsprechend übermüdet kam ich in der Klinik an.
Leider ergab die erneute Überprüfung die schon von mir befürchtete Diagnose: Die Zyste war noch immer da.
Mein mulmiges Gefühl war stärker denn je. Trotzdem ließ ich mir nichts anmerken. Zumindest versuchte ich es. Ich ließ mir einen OP-Termin für den 21. März 2005 geben, eine Woche vor Ostern. Nach drei Tagen stationären Aufenthaltes sollte ich, wenn alles gut ginge, wieder entlassen werden. Mit meiner Chefin hatte ich bereits im Vorfeld alles abgeklärt, denn ich hegte trotz aller Befürchtungen doch die Hoffnung, dass ich nach Ostern wieder fit wäre und weiterarbeiten könnte.
Die Entfernung einer solchen Zyste, auch wenn sie größer ist als üblich, stellt einen Routineeingriff dar, den die Ärzte normalerweise quasi im Vorbeigehen durchführen. Es war geplant, die Zyste mit einem minimalinvasiven Eingriff, einer sogenannten Laparoskopie, zu entfernen. Bei dieser Art von Eingriff, die auch als Schlüssellochtechnik bekannt ist, wird durch ein Loch in der Bauchdecke mit einem Endoskop gearbeitet. Im Gegensatz zur diagnostischen, also zur untersuchenden Laparoskopie, bei denen die Patienten nur eine örtliche Betäubung erhalten, werden OPs wie die, die mir bevorstand, üblicherweise bei Patienten unter Vollnarkose gemacht.
Mein Gefühlshaushalt war dermaßen durcheinander, dass ich diese OP mit dem deutlichen Gefühl antrat: Heike, jetzt bist du fällig! Von außen betrachtet gab es keinerlei nachvollziehbaren Grund dafür, doch ich war ein reines Nervenbündel – schon jetzt! Es war furchtbar.
Nach den Vorbereitungen für die OP, wie Blutentnahme, Vorstellung beim Operateur und der Anästhesistin, kam der Tag der Operation. Ich musste sehr früh auf der Station sein. Horst brachte mich vor seinem Arbeitsbeginn in die Klinik.
Wir hatten vereinbart, dass er wie üblich seinen beruflichen Verpflichtungen nachgehen und mich nachmittags besuchen kommen sollte. Schließlich war es ja nur ein kleiner Eingriff, wie gebetsmühlenartig immer wieder betont wurde, „reine Routine” eben.
Auf der Station angekommen, wurde ich ohne weitere Umschweife zur OP vorbereitet. Ich bekam eine der berühmten „Scheißegal-Pillen”, um zur Ruhe zu kommen, und wartete in meinem Zimmer darauf, dass die Schwester mich in den OP-Saal brachte.
Nach einer mir unendlich lang erscheinenden Zeit von vermutlich nur wenigen Minuten war es dann so weit. Die Pille hatte ihre dämpfende Wirkung entfaltet und ich nahm den Transport nur wie eine unbeteiligte Beobachterin wahr; die dumpfe Angst, die in meinem Bauch kauerte, konnte sie mir indessen nicht nehmen.
Im OP wurde ich dem Team übergeben. Mir wurde ein EKG angelegt, Zugänge für die Narkose eingerichtet und schon konnte es losgehen. Im OP gab es oben über der Tür eine große Bahnhofsuhr. Ich habe die Uhr genau beobachtet, um zu sehen, wie spät es ist und wie lange die OP dauern würde. Ich war durch meine Beruhigungstablette zu beduselt, um noch genau sagen zu können, wie spät es war, aber es musste so gegen halb elf gewesen sein.
Nun ging es los. Ich schlief langsam ein und die Ärzte konnten ihre Arbeit tun.
*
Im Aufwachraum langsam zu mir kommend, war das Erste, was ich tat, einen Blick auf die Uhr zu werfen, die ich von meinem Bett aus gut sehen konnte. Komisch, dachte ich, das ging aber schnell!, als ich feststellte, dass gerade mal eine gute halbe Stunde vergangen war. Ich wunderte mich, dass ich nach so kurzer Zeit wieder so fit war.
Ein wenig später hörte ich von irgendwoher, dass Frau Wille auf eine andere Station verlegt werden sollte. Warum das denn?, schoss es mir durch den Kopf. Das ungute Gefühl hatte mich sofort wieder im Griff und ich fragte eine Schwester, was denn passiert sei, dass ich auf eine andere Station kommen sollte. Die Schwester versuchte, mich zu beruhigen, und gab mir zu verstehen, dass sich gleich ein Arzt mit mir unterhalten würde, sobald ich auf der Station angekommen wäre.
So wurde ich verlegt.
Die neue Station kannte ich nur zu gut – es war die gynäkologische Station, auf der der Chefarzt, der mich untersucht hatte, tätig war. Diese Station lag mir schwer im Magen, denn hier war Steffi vor drei Jahren an Eierstockkrebs gestorben. Ich hatte sie damals fast täglich besucht, um ihr Kraft und Stärke zu geben, aber im Endeffekt hatte ich ihr nicht helfen können. Sie war nach ihrer Krebs-Diagnose innerhalb eines halben Jahres verstorben. Und nun lag ich hier! Warum? Was war passiert? Auf eine Antwort auf diese Frage musste ich nicht lange warten, denn noch am selben Tag ging die Krankenzimmertür auf und eine Ärztin bat mich, sie ins Ärztezimmer zu begleiten. Es war früher Nachmittag und mein Mann war noch nicht da, sodass ich alleine mitging, mich setzte und wartete. Mir war total schlecht vor Aufregung angesichts dessen, was jetzt auf mich zukommen würde. Denn dass es nichts Gutes sein konnte, war mir klar.
Nach kurzer Zeit kam eine junge Ärztin herein und setzte sich mir gegenüber an den Schreibtisch. Sie trug einen weißen Kittel, eine weiße Hose, hatte kurze, blondierte Haare und ein schmales, hartes, slawisch geschnittenes Gesicht mit hohen Wangenknochen. In gebrochenem Deutsch sagte sie zu mir, kaum dass wir uns begrüßt hatten: „Frau Wille, ich hab’ schlechte Nachricht für Sie, Sie haben Krebs.”
Ich hatte es gewusst! Ich hatte gewusst, dass irgendetwas nicht in Ordnung war! Dennoch traf mich die Diagnose wie ein Keulenschlag. Dass es so schlimm sein würde, damit hatte ich nicht gerechnet. Die Tränen schossen mir in die Augen.
Wie betäubt fragte ich: „Was für einen Krebs?”
„Ja”, sagte die Ärztin, „das ist Frage …” Sie beugte sich vor und faltete die Hände auf der Tischplatte. „Wir haben gefunden viele Metastasen in Ihrem Bauch …” Es war offensichtlich, dass sie sich hinter ihrem Gefasel nur versteckte: Sie wusste nur, dass es Krebs war, aber nicht, welche Art. Dennoch probierte sie es aufs Geratewohl mit der Vermutung: „Wahrscheinlich Eierstockkrebs …”
„Den hab’ ich nicht!”, rief ich panisch aus und jetzt fing ich richtig an zu weinen. Denn instinktiv wusste ich: Eierstockkrebs überlebst du nicht! Meine beste Freundin war an dieser Art Krebs gestorben – hier in dieser Klinik!
„Naja”, fuhr sie in langsam murmelndem Tonfall fort, indem sie nochmals die Untersuchungsberichte durchsah und sich dabei durch meinen Zustand in keiner Weise stören ließ, „Gebärmutterkrebs können Sie nicht haben, weil Sie ja keine Gebärmutter mehr haben … Darmkrebs … Wissen wir nicht genau … Der Appendix sah auch schon so befallen aus …” Sie blickte auf. „Das Problem ist: Wir finden den Primärtumor nicht.”
So hilflos wie in diesem Moment habe ich mich in meinem ganzen Leben nicht gefühlt; ich konnte nur sagen: „Ja, und nun?”
Die Ärztin erklärte mir, dass sie mich noch in derselben Woche erneut operieren müssten. Es würde eine große OP werden, die der Chef selbst durchführen würde, da sie nicht abschätzen konnten, wie weit sich der Krebs schon ausgebreitet hatte. Dafür waren noch diverse Voruntersuchungen notwendig. Das bedeutete, dass ich mich dem vollen Programm unterziehen musste, mit dem die moderne Medizin in einem solchen Fall aufwarten kann: Magenspiegelung, Darmspiegelung, Mamasonografie, Punktion der Mammae, und, und, und.
Ich war wie in Trance, dachte nur daran, meinen Mann anzurufen. Meine Gedanken waren nicht mehr klar. War dies das Ende für mich? Wie sollte es weitergehen? Ich hatte unglaubliche Angst. Warum nur musste mir so etwas Schreckliches passieren?
Nachdem das Gespräch mit der Ärztin beendet war, ging ich zum Pförtner nach unten in die Lobby. Ich war nicht einmal mehr in der Lage, eine Telefonkarte zu kaufen.
In diesem Moment kam mein Mann und sah mich verwirrt an. Ich sank in seine Arme, weinte bitterlich und erzählte ihm von der Diagnose. Ich konnte mich kaum beruhigen. Einander umarmend und festhaltend gingen wir zusammen ins Krankenzimmer. Horst hielt mich ganz fest und flüsterte nur immer wieder: „Das schaffen wir schon! Wir beide schaffen das!”
Wie es in diesem Augenblick in ihm aussah, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur eines: Er hat vor meinen Augen nicht geweint. Er gab mir den Trost, den ich brauchte, und versuchte, mich zu beruhigen.
Nach einiger Zeit hatte ich mich etwas gefasst, sofern man es so nennen konnte. Wir überlegten, wie wir diese Nachricht unseren Familien mitteilen konnten. Als ganz besonders schlimm empfand ich es, die Diagnose unserem Sohn beibringen zu müssen. Wieder liefen mir die Tränen wie Wasserfälle die Wangen hinunter. Würde Marcel damit klarkommen, dass seine Mutter so schlimm erkrankt war? Bis heute bin ich der Meinung, dass er meine Erkrankung nicht verkraftet hat. Denn das, was auf mich zukommen sollte, ist für einen heranwachsenden Pubertierenden nicht einfach mitzuerleben.
Gegen Abend verließ mich Horst und fuhr zu seinen Eltern, um ihnen die Diagnose persönlich mitzuteilen. Ich hingegen hatte mich entschlossen, meine Eltern telefonisch zu informieren. Das Telefon in meinem Krankenzimmer war inzwischen angemeldet.
Beide Elternpaare waren darauf nicht gefasst und völlig schockiert. Auch meine Art der Nachrichtenübermittlung kam für meine Eltern absolut überraschend. Nachdem mein Vater den Hörer abgehoben hatte, platzte ich gleich nach der kurzen Begrüßung damit heraus: „Papa, ich habe eine schlimme Nachricht für euch.” Er wartete die Diagnose gar nicht ab, sondern gab meiner Mutter den Hörer in die Hand, und ich sagte nur: „Mama, ich habe Krebs!”
Meine Mutter war völlig fertig und sagte nur weinend: „Heike, mein Kind, kämpfe, kämpfe, kämpfe!” Damit war das Gespräch beendet, denn im Moment konnten weder sie noch mein Vater weiter mit mir telefonieren; sie waren starr vor Schock.
Dann das zweite Telefonat. Ich war noch sehr stabil und habe während des ersten Telefonats nicht geweint. Es muss noch der Schock gewesen sein. Mein zweiter Anruf galt Susanne, meiner Chefin. Sie freute sich zunächst über den Anruf, denn ich hatte versprochen, mich zu melden, sobald ich die OP überstanden hatte. Leider war dieses Gespräch dann aber nicht so erfreulich, wie wir beide es uns erhofft hatten. Sie vernahm die Diagnose und fragte, ob sie noch am selben Tag zu mir ins Krankenhaus kommen dürfe. Ich fing bitterlich an zu weinen und stimmte zu.
Kurze Zeit später, nach ihrem Dienstschluss, stand Susanne an meinem Bett und tröstete mich. Wir unterhielten uns lange darüber, wie es operativ weitergehen würde. Gegen Abend verließ sie mich dann und ich lag allein in meinem Krankenzimmer, allein mit all den grüblerischen, selbstquälerischen Gedanken, die einem in einer solchen Lage kommen können: Wie soll es nur weitergehen? Was wird mit meiner Arbeit? Und Horst? Und Marcel? Und … und … und … Abends bat ich die Schwester um ein Beruhigungsmittel, um in den Schlaf zu finden.
Inzwischen war Horst zu Hause angekommen und hatte seiner Familie von meiner Krankheit erzählt. Nun kam die nächste schwere Aufgabe für ihn: Er musste unserem Sohn die Diagnose beibringen. Wie er das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Eines aber ist gewiss: Beide haben sich in den Armen gelegen und geweint.