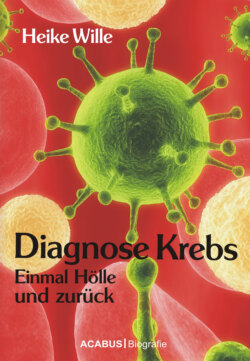Читать книгу Diagnose Krebs. Einmal Hölle und zurück - Heike Wille - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
Letzte Vorbereitungen
Оглавление1
Einige der Nonnen, die in einem dem Franziskus-Hospital angeschlossenen Wohnheim lebten, waren Marcels Lehrerinnen an der hauswirtschaftlichen Schule in Sutthausen, die er für zwei Jahre besuchte. Bei ihnen wusste ich ihn in den besten Händen. Eine dieser Ordensschwestern hatte ich im Krankenhaus getroffen, sie beiseite genommen und auf Marcel angesprochen. Ich erzählte ihr von meiner Erkrankung und bat sie und ihre Kolleginnen, sich in besonderer Weise um meinen Sohn in dieser auch für ihn so schweren Zeit zu kümmern. Und das haben sie in vorbildlicher Weise getan.
Die Schule hat Marcel trotzdem nicht geschafft, er hat hingeschmissen. Er hat zwar seinen Hauptschulabschluss, hätte aber gerne noch den Realschulabschluss gemacht. Doch die emotionalen Belastungen, die mit meiner Krebserkrankung einhergingen, gepaart mit der Erinnerung an Steffis sechsmonatiges Sterben just in dem Krankenhaus, in dem nun seine eigene Mutter lag – und das wiederum mit Krebs! –, waren zu groß. Seine Seele konnte das alles nicht verkraften, auch wenn Steffis Tod zu diesem Zeitpunkt bereits drei Jahre zurücklag.
Marcel war praktisch mit Steffi und ihrer Tochter aufgewachsen, Steffi war so etwas wie seine Ersatzmama gewesen und ihre Tochter war wie eine Schwester für ihn. Die psychologischen und emotionalen Verwirrungen müssen ihn extrem belastet haben. Nach außen kapselte er sich immer mehr ab, bis er niemanden mehr an sich heran ließ.
Selbstverständlich habe ich wegen dieser Abkapselungsproblematik mit Marcels Kinderarzt gesprochen, doch der meinte nur, dass seine Reaktion kein Wunder sei. Er sagte: „Marcel baut eine Säule um sich auf, die immer dicker wird. Er will aus Selbstschutz nichts von der ganzen Sache wissen, weil er unbewusst befürchtet, dass Sie auch in sechs Monaten unter der Erde liegen. Sie kommen an dieses Kind nicht heran.”
Tja, eine super Hilfe, zu diesen Überlegungen war ich auch ohne ihn schon gekommen!
Zur Ehrenrettung des Kinderarztes muss ich allerdings sagen, dass er mir eine Therapie für Marcel empfahl. Ich besprach das auch mit meinem Sohn – soweit das möglich war –, doch Marcel blockte das ab mit den Worten: „Was soll ich da? Was wollen die mir erzählen, was ich nicht eh schon längst weiß?”
Im Grunde war mir Marcels Reaktion von vornherein klar gewesen. Ich wollte nur einfach nichts auslassen, um mir im Nachhinein keine Vorwürfe machen zu müssen. Nicht zuletzt durch die schlechten Erfahrungen mit Therapeuten in seiner frühen Kindheit hatte er Mauern um sich herum errichtet. Er hatte einfach die Nase voll von dem Herumgezerre an seiner Seele.
2
Während meiner Ausbildung zur Arzthelferin hatte ich unsere neue Krankenschwester Veronika kennengelernt. Aus dieser Bekanntschaft entwickelte sich im Lauf der Zeit eine enge Freundschaft. Ihr habe ich zu verdanken, dass ich damals meine Brust-OP habe machen lassen: „Komm, Mädchen, jetzt spring endlich mal über deinen Schatten”, hatte sie mich seinerzeit ermuntert, „und stell’ dich dem Chefarzt vor!” Später entband Veronika in ebenjener Klinik, in der ich mich hatte operieren lassen.
Wir waren damals die besten Freundinnen.
In den ersten Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, haben wir uns sehr oft gesehen und dazwischen häufig miteinander telefoniert.
Doch es gab auch einen Störfaktor in unserer Freundschaft, und dieser Störfaktor hieß Werner. Werner war Veronikas Ehemann. So sehr ich mit Veronika befreundet war, so wenig wusste ich über ihren Ehemann. Veronika sprach kaum über ihn, und ich selbst hatte lediglich zwei-, dreimal das zweifelhafte Vergnügen gehabt, ihn bei meinen Besuchen zu treffen. Bei diesen Gelegenheiten hatte er sich als unsympathischer, eigentümlich verstockter Mensch dargestellt, der offenbar am liebsten seine Ruhe hatte. Dem wenigen, was Veronika mir über ihn erzählt hatte, konnte ich entnehmen, dass er wohl zu Depressionen neigte. Veronika liebte ihn über alles und ich nahm es pragmatisch: Jeder wie er – oder sie – mag.
Aber dann irgendwann verschwand Veronika plötzlich und ohne ersichtlichen Grund aus meinem Leben. Buchstäblich von einem Tag auf den anderen meldete sie sich nicht mehr. Ich rief bei ihr an, schrieb Briefe – nichts, keine Reaktion.
Wir waren damals beide ganz schön moppelig gewesen, weswegen Veronika sich entsprechend große Schlafanzüge gekauft hatte, die sie mir später für meine Krankenhausaufenthalte lieh. Die benutzte ich für mich selbst als Vorwand, um zu ihrem Haus zu fahren. Bei diesen Gelegenheiten versuchte ich auch immer durch eines der Fenster einen Blick ins Innere des Hauses zu werfen. Tatsächlich habe ich sie auch das eine oder andere Mal dort sitzen sehen, aber eigenartigerweise habe ich mich nie getraut hineinzugehen. Ich hatte so eine dunkle Ahnung, dass ihr Verhalten irgendetwas mit diesem unangenehmen Werner zu tun haben musste …
Ich traf Freunde von ihr, denen es ebenso erging wie mir, und erfuhr so immerhin, dass ihr Rückzug nicht an uns, also an Horst und mir, lag – das war dann aber auch alles.
Als ich dann sehr viel später am Vorabend der Laparoskopie im Franziskus-Hospital lag, machte Horst mir den Vorschlag, Veronika doch einfach mal anzurufen und ihr zu sagen, wie es mir geht.
„Wer weiß”, meinte er, „vielleicht ergibt sich ja etwas.”
„Aber nur, wenn du anrufst!”
Gesagt, getan. Er hatte sie auch gleich selbst am Telefon, was sehr gut war, denn wir hatten schon die Befürchtung gehabt, dass ihr Mann das Gespräch entgegennehmen und es womöglich nicht weitergeben könnte. Veronika war geschockt und hat mich noch in derselben Woche im Krankenhaus besucht.
Dieses erste Wiedersehen nach circa zwei Jahren war sehr emotional. Auf beiden Seiten hatte sich ein seelischer Druck aufgebaut, den wir beide nicht einmal hatten erahnen können, und so haben wir einander in den Armen gelegen und geweint.
„Krebs ist kein Todesurteil”, sagte Veronika, nachdem wir uns beruhigt hatten. „Das weißt du, du bist vom Fach.”
„Du hast gut reden”, sagte ich. „Wer von uns beiden hat es denn, du oder ich?”
Veronika schenkte mir ein Buch, das noch heute in meinem Bücherschrank steht, und wir sprachen sogar miteinander über die geradezu unerträgliche Situation, die durch ihr langes und hartnäckiges Schweigen entstanden war.
„Haben wir dir irgendetwas getan oder woran liegt’s, dass du so gar nichts mehr von dir hast hören lassen?”
„Nein”, beruhigte sie mich, „das hat definitiv weder mit dir noch mit Horst etwas zu tun, sondern ausschließlich mit meinem Mann und mir. Aber ich verspreche dir in die Hand”, fügte sie ernst hinzu, „sobald du alles hier mit der Chemo usw. überstanden hast, treffen wir uns mal in der Stadt und trinken Kaffee miteinander.”
„Genau”, sagte ich, „dafür brauchen wir ja auch deinen Mann nicht!”
Als sie ging und mir noch von der Tür zum Abschied zuwinkte, konnte ich nicht wissen, dass dies das Letzte sein würde, was ich für lange Jahre von einer meiner besten Freundinnen sehen würde.
3
Ich hatte mir bewusst ein Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft ausgesucht, da ich mich bei den Nonnen immer schon gut aufgehoben fühlte. Die Schwestern und Ärzte waren ebenfalls alle sehr nett zu mir und so konnte ich mich ihnen guten Gewissens anvertrauen.
Aber ich hatte gar nicht die Ruhe zur Besinnung zu kommen und über meinen Zustand nachzudenken. Nachdem ich den ersten Schock verdaut und mit den engsten Freunden und Vertrauten gesprochen hatte, ging es weiter mit den Vorbereitungen für die nächste große OP. Die Darmspiegelung lag vor mir. Auf dem Weg zur Untersuchung war ich sehr schlecht zufrieden. Im Untersuchungszimmer angekommen, musste ich mich umziehen und auf den Behandlungstisch legen. Wieder völlig fertig mit den Nerven, bat ich darum, mich „abzuschießen”, das heißt, mir ein Medikament zu spritzen, das mich ruhigstellt. Dieses wurde mir verabreicht und so ließ ich die Untersuchung über mich ergehen. Gerade in den Fällen, in denen man selbst betroffen ist, ist es nicht gerade von Vorteil, wenn man, wie ich als Arzthelferin, medizinische Kenntnisse besitzt und genau weiß, was mit einem passiert und was noch alles auf einen zukommt.
Das Ergebnis der Darmspiegelung war zufriedenstellend: Der Darm war unauffällig, was mich doch sehr beruhigte. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen konnte: Der Krebs befand sich nicht im Darm, sondern lag wie ein durchsichtiger Gallert-Teppich auf den Organen.
Tags darauf wurde die zweite Spiegelung fällig, diesmal die des Magens. Davor hatte ich besonders große Angst. Mir wurde schon allein von der Vorstellung schlecht, mir einen dicken Gummischlauch durch die Speiseröhre bis in den Magen hinunterschieben zu lassen. Dementsprechend war ich wieder völlig daneben und fing auf dem Weg zur Spiegelung auch prompt an zu weinen. Ich konnte mich einfach nicht mehr beruhigen. Auch diesmal musste ich medikamentös „ruhiggestellt” werden. Nach der Untersuchung wachte ich im Krankenzimmer auf, und ich hatte keine Ahnung, wie ich dorthin gelangt war. Das war mir auch völlig egal, Hauptsache überstanden. Auch dieser Befund fiel zufriedenstellend für mich aus.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich Horst gebeten, dass ich erst Besuch empfangen wollte, wenn ich die zweite Operation, eine Bauch-OP, in deren Verlauf größere Tumorherde entfernt werden sollten, überstanden hätte. Mittwoch vor der OP bekam ich dennoch überraschenden Besuch von meiner Tante und meiner Cousine. Sie standen einfach wie durch einen Bühnentrick hingezaubert vor mir. Sie wussten noch nicht, dass ich ein weiteres Mal operiert werden musste, und als ich ihnen meine Diagnose sagte, brachte sie dies völlig aus der Fassung. Sie wünschten mir alles Gute für die OP und verabschiedeten sich rasch.
Mittlerweile wussten alle Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen von der schrecklichen Diagnose. Horst kam jeden Abend zu mir und gab mir Kraft und Zuversicht. Inzwischen standen auch alle Untersuchungsergebnisse fest und so wurde die Operation auf den frühen Morgen des Gründonnerstags festgelegt.
Der Chefarzt war ein sehr kompetenter Arzt, der sein Handwerk verstand. Er erklärte mir umfassend meine Situation. Mittlerweile stand auch die Tumorart fest, da eine Probe bei der ersten Operation entnommen worden war. Es handelte sich um einen sogenannten gallertartigen Tumor. Das bedeutet, dass seine Konsistenz geleeartig und durchsichtig wie Wasser ist, weswegen er weder im CT noch im Ultraschall zu sehen war. Bereits zu diesem Zeitpunkt bestand der Verdacht, dass es sich bei dem Primärtumor um ein sogenanntes Appendix-CA, ein Krebsgeschwür am Blinddarm, handeln könnte. Da aber mein Körper dermaßen mit Metastasen durchsetzt war, war es den Ärzten unmöglich nachzuvollziehen, welcher Tumor als der eigentliche Krebsherd anzusehen sei und welcher eine seiner Tochtergeschwulsten war.
Eines aber ist sicher: Wäre die Zyste geplatzt, wie ich es mir so inständig gewünscht hatte, wäre die Krebserkrankung nicht festgestellt worden – man hätte mich ja nicht operieren müssen – und ich wäre daran gestorben.
Manchmal ist es ganz gut, wenn sich Wünsche nicht erfüllen …
4
Im OP-Saal angekommen, fing ich wieder an, sehr unruhig zu werden. Tränen flossen mir übers Gesicht, dann weinte ich fürchterlich. Am liebsten wäre ich aus meinem Bett gesprungen und abgehauen. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Somit hatte auch das OP-Team Mühe, mir eine Braunüle und das EKG anzulegen. Mein Herz sprang mir fast aus der Brust, so schnell pochte es. Da trat überraschend der Chefarzt aus einem anderen OP-Saal, sah mich dort liegen und kam sofort zu mir, um mich zu beruhigen. Seine genauen Worte kann ich nicht mehr wiedergeben, aber sinngemäß sagte er, ich solle jetzt tapfer sein, alles über mich ergehen lassen und danach werde man weitersehen. Da ich keine andere Wahl hatte, folgte die Operation. Ich schlief ein und das Team konnte seine Arbeit beginnen.
Später fand ich mich in meinem Krankenzimmer auf der Station wieder. Mein Mann saß neben mir und freute sich, mich wiederzusehen. Noch benommen von der Narkose nahm ich alles nur schemenhaft wahr und schlief kurze Zeit später ein.
Die Nacht verlief ruhig und so wachte ich am Karfreitagmorgen einigermaßen fit auf – was man so „fit” nennen kann angesichts des hinter mir Liegenden. Ich erschrak dann aber doch sehr, als ich sah, dass mein Bauch gleich mit mehreren Drainagen bestückt war, die die Aufgabe hatten, den Wundfluss aus meinem Bauch in Beuteln, die an meinem Bett hingen, aufzufangen. In meine Bauchdecke hatten die Operateure ein Kreuz geschnitten, und dann hatten sie herausgenommen, was sie verantworten konnten. Und sie konnten enorm viel verantworten! In meinem Fall bedeutete das, dass mir das gesamte große Bauchnetz komplett entfernt worden war. Das kleine wie das große Bauchnetz sind Teile des Bauchfells. Das große Bauchnetz besteht aus der schürzenartig vor dem Darm hängenden Bauchfellfalte, während das kleine Bauchnetz aus der Bauchfellfalte zwischen Magen und unterem Leberrand besteht. Vereinfacht ausgedrückt bedecken die Bauchnetze die inneren Organe wie eine schützende Hülle. Wegen seines Reichtums an Makrophagen und Lymphozyten kann das große Netz Entzündungen in der Bauchhöhle verhindern, indem es sich auf die entzündete Stelle legt und diese abdichtet. Außerdem verfügt das große Bauchnetz über zahlreiche Lymphgefäße, die ebenfalls für die Immunabwehr von großer Bedeutung sind. Ausgerechnet diese Häufung an Lymphknoten macht die Bauchnetze aber auch für die Ausbreitung von Krebserkrankungen so bedeutsam, da Krebszellen hauptsächlich durch das Lymphsystem im Körper verteilt werden. Trotz dieser großen OP waren, wie ich später erfuhr, „stecknadelkopfgroße Metastasen” im Bauchraum verblieben. An die hatte sich der Operateur nicht herangewagt bzw. sie waren zu klein und wohl auch zu zahlreich, als dass sie operativ zuverlässig hätten entfernt werden können. Deswegen sollte eine Chemotherapie folgen.
Nach dieser schweren OP setzte sich der Arzt zu mir aufs Bett und sagte: „Frau Wille, geben Sie nicht auf. Machen Sie alles, was man Ihnen sagt. Denn … unser Leben liegt nun einmal in Gottes Hand. Stellen Sie sich vor: Bei Ihrer Geburt wird Ihre Lebenskerze angezündet und niemand weiß, wann sie erlischt.”
Diese Worte taten mir gut. Der Arzt versprach mir, immer wenn er eine Visite auf der Station hielte, bei mir vorbeizuschauen.
Er sollte Wort halten.
5
Nach den Ostertagen – ich hatte mich gerade ein wenig von meiner OP erholt, konnte mich anziehen und ein wenig herumgehen – bekam ich eine Zimmergenossin. Leider war sie nicht in meinem Alter, wie ich gehofft hatte. Sie war vielmehr über 80 und hatte Brustkrebs, wie ihre Tochter mir anvertraute. „Deswegen”, fügte sie auch gleich hinzu, „möchte ich Sie bitten, liebe Frau Wille, ob Sie sich nicht ein wenig um meine Mutter kümmern könnten? Wir, also mein Mann und ich, wir können nämlich nicht jeden Tag kommen und da dachte ich …”
Ich sah sie für zwei, drei Sekunden lang nur schweigend an. Ich war völlig fassungslos. Dann sagte ich: „Wissen Sie was, gute Frau? Um Ihre Mutter kümmern Sie sich mal schön selber! Ich habe gerade meine Krebsdiagnose bekommen. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich mich jetzt um Ihre Mutter kümmern kann? Bei aller Liebe, ich glaube, das kriege ich nicht hin!”
Die gute Frau prallte bei meinen Worten förmlich zurück. Aber in dieser mehr als angespannten Situation konnte ich einfach nicht anders reagieren. Das Bisschen, was mir noch an Kraft geblieben war, brauchte ich für mich selbst.
6
Am Franziskus-Hospital gibt es, wie an jeder größeren Klinik, die eine onkologische Abteilung hat, eine sogenannte interdisziplinäre „Tumorkonferenz”. Auf diesen Tumorkonferenzen werden, jeweils entsprechend der vorliegenden Operations- und Untersuchungsergebnisse, individuelle Therapieempfehlungen erarbeitet. Diese Empfehlungen werden in einem sogenannten „Tumorkonferenzprotokoll” festgehalten, welches als Grundlage für ein anschließendes ausführliches Aufklärungs- und Beratungsgespräch mit dem Patienten dient. Ein solches Protokoll wurde jetzt auch für meinen „Fall” erstellt.