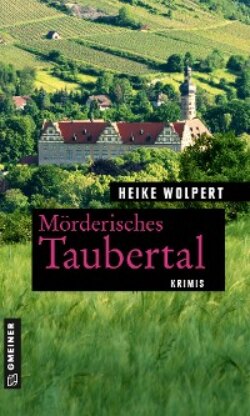Читать книгу Mörderisches Taubertal - Heike Wolpert - Страница 8
03 – Es lebe die Freundschaft
(Tauberbischofsheim;
Kurmainzisches Schloss)
Оглавление»Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich gerade zugeschaltet haben. Sie hören Radio Te-Be-Be auf UKW, die frische Welle aus dem Taubertal. Heute feiern wir den Tag der Freundschaft. Und da habe ich auch gleich einen ganz besonderen Ohrwurm für Sie: ›Friends Will Be Friends‹ von Queen.«
Er schaltete das Radio aus. Freunde! Dass er nicht lachte! Wenn man einen brauchte, war eh keiner da. Das hatte er in den letzten Monaten schmerzlich erfahren müssen. Als sein Vater gestorben war und er plötzlich allein mit dem Laden dastand.
Ein guter Geschäftsmann war er nie gewesen und auch das Handwerkliche lag ihm nicht besonders. Letzteres hatte immer sein Vater erledigt, für die Buchführung war seine eigene Frau zuständig gewesen. Seine Ex-Frau, um genau zu sein. Sie hatte ihn verlassen, nachdem es mit dem Geschäft immer schlechter gelaufen war. Ihm selber lag eher die künstlerische Seite des Juwelierberufs, und eben leider nur die. Er entwarf exquisite Einzelstücke. Bedauerlicherweise waren die solventen Käufer dafür dünn gesät und würden nicht ausreichen, um ihn vor der drohenden Insolvenz zu bewahren. Die Tage seines Juwelierladens waren gezählt. Nicht mehr lange und er würde ein letztes Mal aus dessen Tür treten, sie abschließen und darauf warten, dass sich endlich das Gitter vor dem Eingang gesenkt hatte. Und dabei würde er ganz allein sein … Von wegen Freunde!
*
»Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt …«, schallte es aus dem Autoradio. Paul-Friedrich Osterwald sang dröhnend und vor allem falsch mit.
»Mach das Gedudel aus und halt die Fresse, das kann man ja nicht mit anhören!«, blaffte sein Kumpel Alfred Haberstroh vom Rücksitz.
»Och, Alfi!«
Der bullige Mittdreißiger hasste es, »Alfi« genannt zu werden. Wenn man seinen Namen schon abkürzen musste, dann »Fred« oder seinetwegen auch »Alf«, aber keinesfalls, unter keinen Umständen »Alfi«! Da hörte die Freundschaft auf, die sein Kumpel Paul und die Comedian Harmonists weiterhin lautstark und unermüdlich besangen.
»… und biiist du auch betrübt, weil dein Schatz dich nicht mehr liebt …«
Sehnsüchtig betrachtete Alfred die beiden Waffen in dem aufgeklappten Aktenkoffer auf dem Rücksitz neben sich. Zwei Walther P5. Es juckte ihn in den Fingern, Paul eine davon an die spärlich behaarte Schläfe zu halten und ihn damit zur Ruhe zu zwingen. Aber er beherrschte sich. Paul-Friedrich war sowieso schon nicht der beste Autofahrer, da wollte er ihn nicht noch weiter aus dem Konzept bringen. Wie zur Bestätigung seiner Gedanken machte der Wagen einen unkontrollierten Schlenker auf die Gegenfahrbahn. Ein sich nähernder Lkw reagierte mit Lichtzeichen.
»Ups!« Paul steuerte gegen und holperte kurz über den Grünstreifen neben dem rechten Fahrbahnrand. Beinahe hätte er einen Leitpfosten mitgenommen.
Alfred Haberstrohs Hand fuhr unwillkürlich an den Haltegriff über der Seitenscheibe. »Pass doch auf!«
Der Lastwagenfahrer passierte sie mit kreischender Hupe. Der Wagen schlingerte.
»Und mach endlich das Gedudel aus!« Inzwischen umklammerte Fred den Griff mit beiden Händen.
»Gute Freunde kann niemand trennen …«, verkündete Franz Beckenbauer derweil aus dem Rundfunkgerät.
»Die haben heute das Thema Freundschaft auf Radio Te-Be-Be«, erklärte Paul. Überflüssigerweise. Anders war die eigenwillige Musikmischung seines Lieblingssenders nicht zu erklären.
Fred stöhnte.
»… gute Freunde sind nie allein …«, wusste der »Kaiser« weiter.
Paul brachte den in die Jahre gekommenen Golf endlich wieder in die Spur und gab sogleich erneut Gas.
Sie näherten sich dem Ortsschild von Tauberbischofsheim.
»Fahr nicht so schnell! 50 sind hier erlaubt«, nörgelte Fred.
Abrupt trat Paul auf die Bremse. Hinter ihnen setzte augenblicklich ein weiteres Hupkonzert ein.
»… füreinander da zu sein!«, pries Beckenbauer unbeeindruckt die Vorteile der Freundschaft.
Bei Alfred war es mit derselben gleich vorbei. »Jetzt stell endlich das Gejammere ab. Das grenzt ja an Körperverletzung!« Seine Hände, die er gerade vorsichtig vom Haltegriff zurückgezogen hatte, zuckten nun wieder in Richtung der beiden Handfeuerwaffen neben sich. Warum hatte er sich auch nicht beherrschen können? Er hatte es immer gewusst, dass Rauchen ungesund war. Trotzdem war er vorletzten Samstag noch mal spätabends losgefahren, um Zigaretten zu holen. Eigentlich hatte er schon lange damit aufgehört, also mit dem Rauchen. Aber nach ein paar Bierchen war er schwach geworden. Und dann hatte er es auf dem Rückweg gar nicht abwarten können: Er hatte sich gleich eine anzustecken versucht. Dabei war er ins Schlingern gekommen, hatte das Polizeifahrzeug zu spät gesehen und … jetzt hatte er keinen Führerschein mehr. Er ärgerte sich über seine Unbeherrschtheit, das hatte er nun davon. »Halt! Siehst du nicht, es ist rot!«, brüllte er seine Wut heraus.
Mit quietschenden Reifen kamen sie zum Stehen. Der Motor erstarb.
»… und scheiß auf ›Freunde bleiben‹«, zog im Radio Revolverheld jetzt andere Saiten auf, bevor Paul endlich ausschaltete.
»Eine bunte Mischung, da ist für jeden was dabei«, lobte er den lokalen Sender unbeirrt.
Die Ampel schaltete auf Grün. Paul nestelte am Zündschlüssel und würgte erneut den Motor ab. Hinter ihnen begann schon wieder jemand zu hupen.
Endlich setzten sie sich in Bewegung. Im Schneckentempo fuhren sie nun durch die Straßen von Tauberbischofsheim. Der ungeduldige Verkehrsteilnehmer von eben zog, immer noch hupend, bei der nächsten Gelegenheit an ihnen vorbei und drohte mit der Faust.
Fred ballte die seinen gleichfalls, allerdings im Schoß. »Was ist, findest du den zweiten Gang nicht?«, knirschte er.
»Äh, ich dachte …«
»Überlass das Denken mir!«, fuhr Fred ihm über den Mund. »Hier, jetzt rechts«, dirigierte er kurz darauf.
Munter setzte Paul den Blinker und bog zügig nach links ab.
Sein Kumpel schnaufte mühsam beherrscht durch. »Ich hätt’ es mir denken können«, murmelte er vor sich hin. »Das andere rechts«, sagte er laut. »Und jetzt mach hinne. Die schließen um sechs.«
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Paul endlich gewendet hatte. Glücklicherweise war in dieser Gegend kein Verkehr mehr. Es waren Sommerferien, die Leute waren verreist oder tummelten sich in der Innenstadt. Die Grundschule, die sie kurz darauf passierten, lag wie ausgestorben da.
»Weißt du noch, damals?«, schwelgte Paul-Friedrich mit Blick auf das Schulgebäude in Erinnerungen.
»Hm«, brummte Alfred Haberstroh. Er wollte lieber nicht daran denken. Sie waren beide Außenseiter gewesen. Er als Wiederholer und Paul als der Neue mit dem komischen Dialekt, zugezogen aus Norddeutschland. Dabei war es geblieben, der vierschrötige Alfred legte keinen Wert auf den Kinderkram der anderen und Paul machte sich durch seine Tollpatschigkeit genauso wenig beliebt. Er ließ kein Fettnäpfchen aus und verriet, wenn auch zumeist unabsichtlich, jedes Geheimnis. Trotzdem hatte Fred ihn immer wieder für seine Zwecke eingespannt. Einfach deshalb, weil er der Einzige war, der seine Betrügereien mitmachte. So hatten sie sich mit vereinten Kräften durch die Schulzeit geschlagen, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest was Alfred betraf.
Danach waren gemeinsame Aktivitäten seltener geworden. Paul gelang es, einen Ausbildungsplatz zum Landschaftsgärtner zu ergattern. Fred hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Man traf sich manchmal freitagnachts in der Kneipe. Paul berichtete dann immer von seinen diversen weiblichen Internetbekanntschaften. Keiner dieser Flirts hielt lange. Früher oder später kamen die Frauen dahinter, mit was für einem Chaoten sie ausgegangen waren, und beendeten die Beziehung. Und es dauerte ebenfalls nicht allzu lange, bis Pauls Arbeitgeber herausfand, dass der neue Azubi statt über einen grünen Daumen leider nur über zwei linke Hände verfügte, und sich deshalb nach Beendigung der Lehrzeit von ihm trennte.
Die Treffen in der Kneipe nahmen daraufhin zu und Alfred bezog Paul wieder öfter in seine, zum Großteil kriminellen, Machenschaften mit ein. Der war willig, aber nach wie vor geschwätzig. Das brachte Fred schließlich einen sechsmonatigen Gefängnisaufenthalt, aber auch neue Kontakte ein. Und einer dieser neuen Bekannten hatte ihm den Tipp mit dem Juwelier am Schlossplatz gegeben. Der fertigte nämlich in seiner Werkstatt ausgesuchte Einzelstücke an und das Material dazu wurde jeweils montagnachmittags geliefert. Montags war der Inhaber außerdem allein im Laden und der Schlossplatz kaum besucht, da das namensgebende Kurmainzische Schloss samt des darin befindlichen Tauberfränkischen Landschaftsmuseums an diesem Tag für Besucher geschlossen war. Ebenso wie der anliegende Türmersturm, ein weiterer Bestandteil der ehemaligen Wasserburg.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, plapperte Paul los: »Schade, dass heute Ruhetag ist. Warst du schon mal auf dem Turm? Man soll da eine ganz fantastische Sicht über die Stadt haben.«
Ging es noch? Fred glaubte, nicht recht zu hören. Sie planten gerade einen Überfall und sein Komplize ließ sich über Sehenswürdigkeiten aus. Hatte der den Schuss noch gehört? Apropos. Es war wohl besser, diesem Unglücksvogel keine geladene Waffe in die Hand zu geben. Schnell entfernte er die Magazine aus den beiden Walther P5. »Da vorne kannst du anhalten«, unterbrach er dann die Lobeshymnen seines Begleiters auf den im 13. Jahrhundert errichteten Wehrturm.
»28 Meter ist er hoch.« Schob Paul ein letztes Detail nach und unterstrich seine Aussage, indem er den Arm entsprechend anhob. Der Wagen machte einen weiteren Schlenker und holperte mit dem rechten Vorderreifen über den Bordstein.
Alfred sah auf die Munition in seiner Hand, bevor er sie fest zur Faust schloss. »Da vorne hältst du an.«
Paul hätte sowieso keine andere Möglichkeit gehabt, wenn er nicht zwischen zwei Pfeilern hindurch in die beginnende Fußgängerzone fahren wollte. Bei ihm konnte man da allerdings nicht sicher sein.
Während Fred noch die Patronen verstaute und dabei zumindest versuchte, seinem Kumpel die geplante Vorgehensweise ins Gedächtnis zu brennen, staffierte der sich schon mit Schiebermütze, Sonnenbrille und einem albernen künstlichen Schnurrbart, die er zuvor im Handschuhfach deponiert hatte, aus. Fred legte ebenfalls Brille und Mütze an. Als sie auf diese Weise kostümiert aus dem Wagen gestiegen waren, baute sich Paul neben ihm auf und salutierte. Die Handfeuerwaffe hatte er sich vorne in den Hosenbund geschoben. Alfred verkniff sich einen Kommentar über die Gefahr, die diese Art der Aufbewahrung mit sich brachte, pries insgeheim seine Weitsichtigkeit, die Munition entfernt zu haben, und sah auf die Uhr.
17.45 Uhr. Es wurde Zeit.
*
Dreiviertel sechs. Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr. Ekkehard Klotz beschleunigte seinen Schritt und blickte unwillkürlich auf sein linkes Handgelenk. Aber da war nur ein Streifen etwas blasserer Haut statt seiner geliebten Stimmgabeluhr, die er sonst nie ablegte. Vor sieben Tagen war sie plötzlich stehen geblieben und der Juwelier am Schlossplatz, zu dem er sie umgehend gebracht hatte, hatte das ungewöhnliche Modell mit einer Mischung aus Faszination und Ratlosigkeit betrachtet. »Die muss ich einschicken«, hatte er ihm dann beschieden und hinzugefügt: »Das kann ein paar Tage dauern.« Was war ihm also anderes übrig geblieben, als seinen Augapfel den Händen der Experten zu überlassen?
Seither fühlte er sich irgendwie nackt. Immer wieder wanderte sein Blick zu seinem verwaisten Handgelenk. Er brachte es nicht übers Herz, sein Schätzchen für die Dauer der Reparatur durch ein billiges digitales Modell zu ersetzen.
Als ihn am heutigen Nachmittag endlich der erlösende Anruf aus dem Juwelierladen erreicht hatte, hatte er sich gar nicht schnell genug auf den Weg machen können. Warum rief der erst um kurz vor fünf am Nachmittag an? Wenn die Uhr heute gekommen war, musste sie doch bereits am Morgen angeliefert worden sein, überlegte Ekkehard ärgerlich. Solche Zustellungen kamen doch nicht kurz vor Feierabend. Je länger er darüber nachdachte, desto wütender wurde er. Wahrscheinlich war seine Uhr, wie ursprünglich avisiert, bereits am vergangenen Freitag angekommen und dieser Kretin von einem Juwelier hatte schlicht versäumt, ihn über deren Eintreffen zu informieren. Na, der konnte was erleben! Ohne einen Blick für die schöne Fachwerkfassade des einstigen Kurmainzischen Schlosses zu erübrigen, stürmte er auf die Eingangstür des Juweliers »Mattenzwirn« zu.
Mattenzwirn hat kein Hirn!, dachte er an die Schmähsprüche aus Jugendtagen, mit denen er und seine Freunde den Sohn des ortsansässigen Geschäftsmannes bedacht hatten. Seine und die Clique um Matthias Mattenzwirn waren damals erbitterte Feinde gewesen. Natürlich war das lange her und sie waren schließlich beide erwachsen und vernünftig, wie man meinen konnte. Und immerhin war Ekkehard mit seiner defekten Uhr ja auch zu dem ehemaligen Schulkollegen gegangen. Nun ja, hauptsächlich deshalb, weil sein Opa – Gott hab ihn selig – das gute Stück damals in dem Laden am Schlossplatz erworben hatte. Beim alten Mattenzwirn, dem Großvater von Matthias und einem Uhrmacher-Spezialisten. Dessen Ruf war weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gewesen. Sein Enkel hatte scheinbar nichts von der Fertigkeit seines Urahnen geerbt. Musste seine kaputte Uhr an irgendwelche Spezialisten weiterschicken. Kein Wunder, dass sein Geschäft, wie man munkelte, vor der Pleite stand, dachte Ekkehard gehässig.
Das war das letzte Mal, dass er diesen Laden betreten würde, nahm er sich vor, als er vor dessen Eingangstür stand, und ahnte nicht, in welch fataler Weise sich dieser Vorsatz erfüllen würde.
Zunächst ärgerte er sich über die respektlose Begrüßung des »hirnlosen Mattenzwirns«.
»Ekke, die Zecke!«
Der Laden war leer, aber trotzdem war die Anrede einem Kunden gegenüber nicht angemessen.
Was der konnte, konnte Ekkehard schon lange: »Matze, du Fratze!«, konterte er.
»Na, wer gleich eine Fratze zieht, werden wir ja sehen.« Matthias lachte höhnisch und wedelte mit einer Plastiktüte vor seiner Nase herum. »Die Experten konnten deinem Schätzchen leider nicht mehr helfen.«
Ekkehard erkannte seine geliebte Uhr in dem durchsichtigen Beutel. Er sah ein bisschen so aus wie diese Tüten, in denen die Fernsehkommissare im »Tatort« ihre Beweisstücke sicherten. Er wollte danach greifen, aber der Juwelier entzog ihm das begehrte Objekt. »Erst bekomme ich 97,80 von dir.«
»Spinnst du?«
»Na, na, wie redest du denn mit mir? Das ist nicht klug. Ganz und gar nicht klug!« Er fuchtelte weiter mit der Tüte vor ihm herum.
Plötzlich war Ekkehard wieder 16 Jahre alt und betrachtete wütend die Kratzer in Form eines männlichen Geschlechtsorgans am Tank seines nagelneuen Mopeds. Er hatte sofort seinen Erzfeind, Matthias Mattenzwirn, in Verdacht gehabt und daraufhin kurzen Prozess gemacht: Im Sportunterricht hatte er die protzige Uhr des Juwelierssohns geklaut, mit deren diversen Spezialfunktionen jener noch am Morgen angegeben hatte.
Als er den Verlust bemerkt hatte, hatte sein Rivale einen Riesenaufstand angezettelt. Mit seinen Schergen hatte er die ganze Umkleidekabine durchsucht, aber Ekkehard war mit dem guten Stück schon über alle Berge gewesen. Oder besser gesagt auf dem Türmersturm, wo er auf seinen Widersacher wartete. Es war ein regnerischer Tag gewesen, deshalb hatten sich nur wenige Besucher auf dem Wahrzeichen Tauberbischofsheims befunden. Ekkehard war also fast alleine in den Genuss des herrlichen Rundumblicks auf die Kreisstadt gekommen.
Endlich hatte er Matthias den Schlossplatz betreten und auf den elterlichen Laden zusteuern sehen. Jetzt! Mit einem gezielten Wurf war der Zeitmesser direkt vor den Füßen seines Kontrahenten gelandet. Nicht umsonst war Ekkehard Kreisläufer in der Handball-Schulmannschaft gewesen. Zielgenau werfen war eine seiner Stärken. Die Uhr hatte den Sturz nicht überstanden und sein Widersacher hatte genau gewusst, wem er es zu verdanken hatte, dass fortan wieder eine »einfache« Swatch sein Handgelenk zierte.
»Eins zu Eins«, hatte ihm Ekkehard am nächsten Tag im Vorbeigehen zugeraunt. Viele weitere »Streiche« zwischen den befeindeten Cliquen waren gefolgt. Verschwundene Schulhefte, kompromittierende Fotos und einmal sogar eine gebrochene Nase, allerdings nicht die von Ekkehard oder Matthias, sondern die des Mathelehrers, der bei einer Rangelei hatte dazwischengehen wollen.
Das alles war lange Vergangenheit. Nach dem Abitur hatten sich ihre Wege getrennt. Soweit Ekkehard sich erinnerte, waren sie zu diesem Zeitpunkt auch quitt gewesen, was die gegenseitigen Seitenhiebe anging.
Doch Matthias’ hasserfülltem Blick nach zu urteilen, den er ihm nun zuwarf, schien der das anders zu sehen. Ekkehard wurde wütend. Das Leben hatte sich dem Juwelierssohn nicht eben von seiner Schokoladenseite gezeigt, doch war das Ekkehards Schuld? Wie armselig war es, das bisschen Macht, das er mit der Stimmgabeluhr in der Hand hielt, gegen ihn auszuspielen?
»Kein Wunder, dass du vor der Pleite stehst, wenn du so mit deinen Kunden umspringst!«, schleuderte Ekkehard ihm wutschnaubend entgegen. »Viele scheinen es ja ohnehin nicht mehr zu sein.«
In dem Moment erklang das altmodische Türglöckchen in seinem Rücken. Matthias sah ihm über die Schulter und seine Augen weiteten sich vor Schreck.
*
So viel Betrieb herrschte selten an einem Montagabend auf dem Schlossplatz von Tauberbischofsheim. Mehrere Polizeiwagen mit und ohne blinkende Blaulichter, einige Privatfahrzeuge, zwei Kranken- und ein Leichenwagen standen kreuz und quer vor der Eingangstür des Juweliers »Mattenzwirn«. Hinter dem Absperrband hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt, die versuchten, einen Blick auf das Innere des Ladens zu erhaschen. In Windeseile hatte es sich herumgesprochen, dass es beim Mattenzwirn am Schloss einen Schusswechsel gegeben hatte. Von mindestens einem Toten war die Rede.
Der Notarzt erhob sich und machte dem Kollegen von der Gerichtsmedizin Platz. »Schussverletzung im oberen Bauchraum«, erklärte er, »ein Zeuge hat versucht, ihm zu helfen, wie er sagt. Dabei hat er«, er deutete mit dem Kinn auf den Toten, »leider viel Blut und vor allem Zeit verloren.« Er überließ die Leiche dem Rechtsmediziner und ging ins Hinterzimmer, wo zwei weitere Sanitäter den unter Schock stehenden Zeugen untersucht hatten.
Matthias Mattenzwirn saß auf einem Hocker. Um seine Schultern lag eine Wärmedecke. Ein Polizeibeamter war bereits dabei, ihn zu vernehmen.
Flüsternd teilten die Kollegen dem Notarzt mit, dass der Patient stabil sei und auf eine weitere Behandlung verzichten wolle.
Der junge Uniformierte, der dem ermittelnden Hauptkommissar assistierte, machte sich eifrig Notizen: Zwei Männer, mittelgroß, beide kräftige Statur, Alter unbekannt. Durch Mützen, Sonnenbrillen und, wie der Zeuge behauptete, unechte Bärte war eine nähere Beschreibung nahezu unmöglich.
»Es ging alles so schnell«, seufzte Matthias Mattenzwirn.
»Haben die zwei etwas gesagt? Ist Ihnen da vielleicht was aufgefallen? Stimmlage, Dialekt, Sprachfehler?«
Der Zeuge schüttelte den Kopf. »Geredet hat nur der eine, der mich aufgefordert hat, den Tresor zu öffnen.« Er atmete tief durch. »Er hat mich mit seiner Waffe bedroht, also habe ich mich nicht weiter auf eine Diskussion eingelassen. An seiner Stimme ist mir nichts Außergewöhnliches aufgefallen.« Er zuckte bedauernd mit den Schultern. »Der andere hat Ekkehard in Schach gehalten. Ekkehard ist der …«, er schluckte, »das ist der Tote. Er wollte seine Uhr abholen. Der Blödmann hat auf den Räuber eingeredet. Ihn provoziert. Ich habe mehr auf ihn geachtet und immer gedacht: Warum hält der nicht die Klappe?, während ich den Tresor geöffnet habe und alles dem anderen in die Tasche gepackt habe. Die hatten übrigens beide so Einmalhandschuhe an.«
»Hm.« Der Kommissar nickte. »Wir brauchen trotzdem eine Liste ihrer Kunden, wegen der Fingerabdrücke.«
Der Juwelier reagierte nicht auf seinen Einwurf, sondern redete weiter: »Und dann hat der plötzlich geschossen. Wahrscheinlich wollte er Ekke einfach zum Schweigen bringen …«
*
»Sind das Diamanten?«, fragte Paul aufgeregt.
»Nein, Kieselsteine«, brummte Alfred Haberstroh.
»Kiesel? Die sind aber klein und …«
»Natürlich sind das Diamanten«, fuhr Alfred ungehalten dazwischen und fügte leise hinzu: »Das hoffe ich zumindest.« Er konnte es immer noch nicht glauben, wie reibungslos alles geklappt hatte. Der Juwelier hatte ohne große Widerworte den Tresor geöffnet und ihm dessen Inhalt in die mitgebrachte Tasche geleert, während Paul, ausnahmsweise kommentarlos, den Kunden mit seiner ungeladenen Waffe in Schach gehalten hatte. Das Ganze hatte keine zehn Minuten gedauert. Niemand hatte ein überflüssiges Wort gesagt, keiner hatte versucht, den Helden zu spielen. Einen Moment lang war ihm beinahe das Herz stehen geblieben, als er im Tresor neben den Diamanten, dem Gold und einigen Papieren eine Waffe erkannt hatte. Aber der Juwelier ließ sie links liegen. Vielleicht dachte er nicht daran oder er traute sich einfach nicht, sie zu benutzen. Mit zitternden Händen hatte er Alfred kurz darauf den gefüllten Jutebeutel übergeben und dann konnten sie sich ohne Zwischenfälle zurückziehen.
»Der hat sich beinahe in die Hose gemacht«, freute sich Paul und nahm nun endlich die Mütze ab.
Alfred durchfuhr ein Schreck und er deutete auf die Kopfbedeckung. »Hattest du die die ganze Zeit auf?«
»Klar! Ich wollte doch nicht, dass die mich an meiner Frisur erkennen.«
»Dass die lesen können, daran hast du nicht gedacht, was?«, brüllte Alfred. »Ich hab dir doch ne Mütze gegeben, die du aufsetzen sollst. Warum hast du eine andere genommen?«
»Die von dir hat mir nicht gefallen, da war so ein ekelhafter Totenkopf drauf.« Sein Kumpel besah sich die eigene Kappe und lachte unsicher auf. »Ups! Das habe ich gar nicht gemerkt. Da habe ich wohl die Falsche erwischt.« Auf dem Schild der schwarzen Mütze war in giftgrüner Farbe das Logo der Gartenbaufirma eingestickt, bei der Paul seine Ausbildung absolviert hatte. Aber damit nicht genug. Unter dem Schriftzug des Unternehmens stand, ebenfalls in grünen Lettern: »Es bedient sie: Paul-Friedrich Osterwald«.
*
Endlich war er allein. Das Spurensicherungsteam hatte seinen Laden versiegelt. Der Kommissar und sein Gehilfe hatten keine weiteren Fragen gehabt und waren abgezogen. Und die Leiche hatte man abtransportiert.
Er war über sich selbst erstaunt, dass sein Blutdruck bei der Untersuchung durch den Notarzt im Normbereich gewesen war. Sein Puls war etwas erhöht gewesen, aber das hatte niemand als beunruhigend empfunden. Am wenigsten er selber. Immerhin hatte er gerade seinen Erzfeind umgebracht.
Ja, es hatte ihn schon erstaunt, wie ruhig er dabei geblieben war. Die beiden Ganoven waren kaum aus der Tür gewesen, da hatte er selbst zur Waffe gegriffen und ohne mit der Wimper zu zucken Ekkehard Klotz erschossen. So schnell hatte der gar nicht reagieren können. Er hatte noch nicht einmal mehr ein »Spinnst du?« über seine Lippen gebracht, bevor er wie ein nasser Sack umgekippt war.
Matthias hatte sich die eigene Position gemerkt und später der Polizei erzählt, da habe Paul-Friedrich Osterwald gestanden. Ohne natürlich dessen Namen zu nennen.
Er erinnerte sich an den Schüler, der die Klasse zwei Stufen unter ihm selbst besucht hatte. Osterwald und sein Kumpel waren immer wieder wegen irgendwelcher Betrügereien aufgefallen. Dabei war er schon damals »dümmer, als die Polizei erlaubt«. Keiner hatte sich gewundert, dass dieser Trottel nach der neunten Klasse die Schule verlassen hatte. Genau wie sein Kumpan, dieser grobschlächtige Typ. Wie hatte der noch gleich geheißen? Haberstroh. Matthias lachte vor sich hin. Dank der schicken Mütze von diesem Osterwald hatte er die beiden Männer sofort erkannt. Und jetzt hatte er sie in der Hand. Kein Mensch würde seine Version des Überfalls, die er gerade bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte, anzweifeln. Von der Versicherung bekäme er das Geld für die gestohlene Ware wieder und den Rest würde er sich von den Ganoven zurückholen. Ob Haberstroh wohl schon gemerkt hatte, was sein Kumpel sich da geleistet hatte?
Er schenkte sich zur Belohnung einen Drink ein und setzte sich in seinen Lieblingssessel, während er das Radio einschaltete. »Hallo und guten Abend, Sie hören immer noch Radio Te-Be-Be auf UKW, die frische Welle aus dem Taubertal«, erklärte der Sprecher gerade. »Wir feiern heute schon den ganzen Tag die Freundschaft. Jetzt kommt Marilyn Monroe zu diesem Thema zu Wort und sie findet: ›Diamonds are a girl’s best friend …‹«