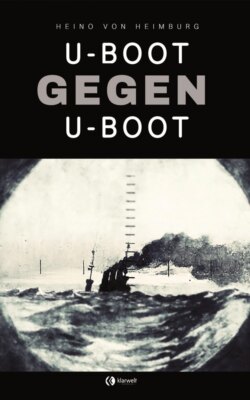Читать книгу U-Boot gegen U-Boot - Heino von Heimburg - Страница 6
Das Stelldichein
ОглавлениеUnunterbrochen noch tobte der Sturm. Hatten wir ursprünglich beabsichtigt, schon am nächsten Tage weiterzufahren, so kamen wir bald von unserem Plan ab. Eine Fallbö nach der andern brach aus den Tälern von Land hervor. Und jedes Mal, wenn sie auf See anlangte, bot sich das gleiche merkwürdige Schauspiel, dass sich das Wasser, als begänne es zu kochen, in Gischt verwandelte und die ganze Luft wie mit Regenböen erfüllte. Der Seegang dicht unter Land war aber so mäßig, dass wir ihn kaum fühlten. Draußen sah es allerdings böse aus.
So lagen wir also stillvergnügt hinter unserer Insel, erholten uns von den gehabten Anstrengungen und warteten auf besseres Wetter. Als dann der nächste Tag heraufkam, schien die See etwas ruhiger geworden zu sein, so dass wir unseren Schlupfwinkel verlassen und losfahren konnten. Langsam ging es vorwärts, so dass wir nach sechs Stunden ungefähr an der Ostecke Kretas standen. Jetzt allerdings wurde es ungemütlich. Der Seegang traf uns hier wieder mit voller Kraft, und U . . . begann seine alten „Zicken“. Bald kletterte es, sprang in die Abgründe, warf sich nach Steuer-, nach Backbord über, als müsste das so sein, fauchte wie ein Königstiger mit der Schraube in der Luft herum und triefte im Innern vor Nässe und Feuchtigkeit. Warten konnte ich aber nicht mehr. Wollte ich doch in der Nähe einen Kameraden treffen, der schon seit längerer Zeit hier weilte, um mich mit ihm, bevor ich mich in mein Jagdrevier begab, zu besprechen, damit nicht etwa einer dem andern ins Gehege käme. Auch würde er mir sagen können, ob es viel Wild gäbe und wo die begangensten Wechsel wären.
Von einer Stunde zur anderen war die See plötzlich wieder ganz ruhig geworden. Noch stand eine kleine Dünung, aber auch die schien von Minute zu Minute schwächer zu werden. Wir hatten verabredet, uns in einer kleinen, menschenleeren Bucht zu treffen. Es war dunkel geworden, bald aber kam der Mond hoch, so dass ich schon von ferne Land und Berge ausmachen konnte. Leider aber auch noch etwas anderes, das dringend zur Vorsicht mahnte: Feindliche Wachtboote, die in der Gegend kreuzten. Langsam strichen wir unter Land dahin. Da war eine Bucht, die wohl der Treffpunkt sein konnte. Alles starrte nach der Küste hinüber. Nichts. Das einfachste wäre ja wohl ein Lichtsignal gewesen, wie wir es verabredet hatten. Damit aber hätte ich nur die Boote draußen, die ununterbrochen herumsausten, darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns hier befanden. Und dass uns daran nur sehr wenig lag, ist wohl klar. Also hieß es weiter.
Jetzt waren wir am Ende der Bucht angelangt, wollten wenden und langsam zurückgehen, als mein Blick voraus fiel. Da öffnete sich tatsächlich eine zweite, noch kleinere und verstecktere Bucht, von der die Karte anscheinend nichts wusste. Also los! Wenn er hier nicht war, konnte ich wenigstens an diesem versteckten Platze, wo mich sicherlich niemand vermuten würde, ruhig warten. Bald waren wir an Land und hatten geankert.
So viel Frieden und Ruhe atmete die ganze Gegend, als sei hier noch nie ein Mensch gewesen. Meilenweit zog sich anscheinend dichter Wald mit üppigem Unterholz längs des Strandes hin. Die Heimchen zirpten, irgendwo in der Nähe murmelte eine Quelle. Wo aber war mein Kamerad, und wie sollte ich ihn finden?
Vorsichtig, die entsicherte Pistole in der Hand, schlich ich am Strande hin. Die ganze Bucht lag vor mir. Das ruhige Wasser, das unter dem Mond silbern zuckte und leuchtete; der weiße Sand, der grell aus dem Dunkel zu mir herüberschimmerte; aber von einem U-Boot war nichts zu sehen. Bald musste ich die Bucht abgeschritten haben, ohne Verdächtiges zu bemerken. Dicht vor mir schnitt noch die See mit einem schmalen Arm ins Land ein, uralte Bäume deckten den natürlichen Kanal. Hier musste ein idealer Liegeplatz sein.
Gerade als ich wendete, um zu meinem Boot zurückzukehren, tönte aus dem dichten Gebüsch hinter mir ein leise- Zischen. „Nanu“?“ Im nächsten Augenblick halte ich die Pistole hoch, ließ sie aber rasch wieder sinken, als gleich daraus der gemütliche Bass meines so sehnlich herbeigewünschten Kameraden ertönte:
„Mensch, Heimburg, bist du endlich da?“
Gleich darauf kam er breit und behäbig, wie ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, aus seinem grünen Urwald heraus, und wir schüttelten uns in ehrlicher Freude die Hände. Den Kerls zum Trotz, die draußen wie die Schweißhunde herumschnüffelten.
Er hatte sein Boot wirklich in ganz genialer Weise festgemacht, so dass man ihn, wenn man den Platz nicht wusste, sicherlich nicht gefunden hätte. In fünfzehn Minuten lag ich neben ihm fest, kletterte in seine Messe hinunter und erprobte zuerst mal ausgiebig, ob sein Brioniwein, den er noch an Bord hatte, nicht durch den schweren Seegang gelitten hätte. Es war aber wirklich nicht der Fall.
Ganz famos war der Winkel. Von See her konnte man nicht heran, ohne von uns schon meilenweit bemerkt zu werden, und auf der Landseite hatte mein Kamerad sich vor jeder Überraschung gesichert. Auf einer kleinen Anhöhe stand ein Posten, der bis weit landeinwärts freies Gesichtsfeld hatte. Von dem war ich auch längst bemerkt und gemeldet worden, als ich noch vorsichtig in der Bucht herumpirschte. Die Nacht schliefen wir so ruhig und sicher, als säßen wir nicht mitten unter dem Gegner, sondern zu Hause in W’haven.
Frühmorgens braute Herzig, der wackere, einen Kaffee, der auch nicht von schlechten Eltern war und noch zur Hebung der Stimmung, die ohnehin nichts zu wünschen übrig ließ, beitrug.
Die Boote wurden nachgesehen, die freien Leute badeten, und wir waren eben dabei, unsere weiteren Operationen zu besprechen, als der Posten mit der Meldung kam, zwei Wachtfahrzeuge kämen mit voller Fahrt auf unsere Bucht zu.
„Tauchen!“
Dicht nebeneinander gingen wir auf den Grund und blinzelten uns fröhlich durch das Sehrohr an. Stimmt! Da kamen die Beiden auch schon heran. Anscheinend suchten sie die ganze Küste ab. Erst als sie in der Nähe waren, fuhren wir die Sehrohre ein und ließen sie über uns hinwegfahren. Nach zehn Minuten blickte ich wieder aus. Richtig, im gleichen Augenblick kam neben mir das Sehrohr meines Kameraden hoch, gerade rechtzeitig, um die beiden Wachtboote um die nächste Ecke biegen zu sehen. Jetzt waren wir sicher. Ob die beiden allerdings so ruhig weitergefahren wären, wenn sie gewusst hätten, dass kaum zehn Meter unter ihnen sich zwei Kaiserlich deutsche U-Boote von den Anstrengungen einer langen Fahrt im weichen Sande ausruhten?
Vergnügt kamen wir wieder hoch und fuhren in unserer Beschäftigung fort. Der Motor wurde überholt, das Boot aufgekramt und tüchtig gegessen. Ich hatte alte englische Zeitungen an Bord, in denen es hieß, die Engländer hätten unseren U-Bootstützpunkt herausgefunden: Es sei das Achilleion. Um ihnen also wenigstens einigermaßen gerecht zu werden, beschlossen wir einstimmig, unsere Bucht „Achilleion“ zu taufen.
Es war ein Tag, wie er dem U-Bootsmann nur selten beschieden ist. Draußen tobten die Feinde umher und suchten uns, und hier saßen wir schön weich und wohlig im warmen Sande. lebten einen guten Tag und besprachen unsere Pläne, wie wir dem Gegner recht heftig zu Leibe gehen könnten.
Die Nacht über und den nächsten Tag blieben wir noch im „Achilleion“. Alles an Bord war klar. Bei Einbruch der Dunkelheit wollten wir losgehen.