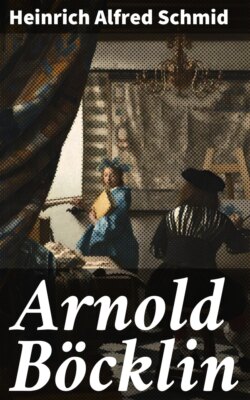Читать книгу Arnold Böcklin - Heinrich Alfred Schmid - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE VATERSTADT UND DIE ELTERN
ОглавлениеDie Vaterstadt Basel ist noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einem Bewunderer Böcklins, der hingewallfahrtet war, um die Heimat des Propheten kennen zu lernen, unsäglich eng und muffig erschienen und von ihm danach verlästert worden. Da mögen unangenehme Reiseerlebnisse das Urteil getrübt haben, aber früher, in Böcklins Jugend, hätte ein flüchtiger Besucher wirklich nicht ahnen können, daß ein enthusiastischer Künstler in den Mauern heranwuchs, der die Faune und Nymphen, Tritonen und Nereiden und die schaumgeborene Aphrodite aus dem Orkus heraufholen werde.
Die Stadt war freilich zur Zeit des Humanismus und der Reformation der Mittelpunkt geistigen Lebens für ganz Südwestdeutschland gewesen. Sie hatte gleichzeitig auch ein blühendes Kunstleben gehabt. Dürer hatte auf der Wanderschaft hier Arbeit gefunden und zwanzig Jahre später Holbein eine zweite Heimat und große und lohnende Aufträge. Die Buchdrucker datierten damals ihre Drucke aus der „weitberühmten Stadt Basel“ und in den kleinen Randleisten, mit denen Holbein die Titel schmückte, spielten sogar schon damals die Tritonen und Nereiden eine Rolle. Es galt die Stadt auch als eine der fröhlichsten am Rhein, der Frau Venus besonders hold. Aber mit der Reformation war ein puritanischer Geist eingezogen, der sich bis ins 19. Jahrhundert erhalten hat, und ein großer Teil der angesehensten alten Familien geht sogar, wie schon die Namen andeuten, auf Flüchtlinge zurück, die ihres Glaubens wegen aus Italien, Frankreich und auch aus Deutschland eingewandert waren. Diese haben nun allerdings fremde Industrien hierher verpflanzt und damit den Reichtum gefördert und es wurde dem alemannischen Stamme der Bevölkerung durch sie auch ein fremdes und gutes Reis aufgepfropft. Aber seit dem 17. Jahrhundert war der Zustrom von außen nur ein sehr schwacher und das Gemeinwesen hat sich nicht mehr vergrößert. Die Bevölkerung erhielt dadurch ein scharf ausgesprochenes Gesicht, wie es in heutigen Städten gar nicht mehr möglich ist und dies Gesicht sah etwas anders aus als im Anfange des 16. Jahrhunderts.
Die Stadt war sprichwörtlich für ihren Erwerbssinn und ihren Reichtum, aber auch für die altväterischen Gepflogenheiten, den Familiensinn, die Frömmigkeit, den Gemeinsinn und ihre Wohltätigkeit. Kaufmännische Tugenden gaben neben der pietistisch gefärbten Religiosität der Physiognomie der Bewohner ihre charakteristischen Züge.
Allein es fehlte durchaus nicht an geistigem Leben, nur kam der Wohlstand mehr der Wissenschaft als der Kunst, und unter den Künsten am meisten der Musik und der Baukunst zugute. Durch alle Zeiten des Stillstandes und des Niederganges hatte sich die Universität erhalten und so haben neben Böcklin in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts auch ein Jakob Burckhardt und ein Nietzsche gewirkt. Aber auch die Gemälde und Zeichnungen Holbeins, die sich aus den Tagen des Glanzes im Besitze der Stadt erhalten haben, waren immer geschätzt, wenn auch vielleicht nicht häufig besichtigt worden und übten ihre stille Wirkung aus. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann ferner das Interesse für das Münster und die übrigen mittelalterlichen Kirchen der Stadt zu erwachen. Namentlich aber ist schon seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts eine aufsteigende Entwicklung auf dem Gebiete der Architektur zu beobachten. Diese brachte später, in der Rokokozeit, die große Zahl von schönen, zum Teil sogar prunkvollen Patrizierhäusern hervor, die dem Innern der Stadt noch heute ihr Gepräge verleihen. Nebenher kam auch das Sammeln von Bildern auf. Der Malerberuf war zu Beginn des 19. Jahrhunderts in dieser Stadt der Kaufherren und der frommen Sitte an sich durchaus nicht gerade verachtet, wenn man auch dem Erbauer komfortabler Familienhäuser jedenfalls mehr Verständnis und sicher weit größere persönliche Achtung entgegengebracht haben wird, als den Jüngern der leichter geschürzten Muse der Malerei. Was den fürsichtigen und bedächtigen Baslern damals wirklich zu einem Kunstleben fehlte, war vielleicht nur der Sinn für naiven Lebensgenuß und schönen Schein und jener Leichtsinn, der zu großen Taten schließlich nun einmal nötig ist. Wenigstens vermißt man in vielen Äußerungen der damaligen und noch einer späteren Zeit das Gefühl für das Heroische im Verhalten eines Mannes, der ohne finanzielle Sicherheiten, nur im Bewußtsein eigener Kraft, eine Bahn betrat, die den Winden und Wogen ein so sicheres Ziel bot wie der Künstlerberuf, und der auch noch auf dieser an sich schon gefährlichen Bahn, lediglich der eigenen Vernunft gehorchend, alles Hergebrachte und Anerkannte in den Wind schlug.
Die Maler, die in Böcklins Jugend in Basel den Stand vertraten, waren nicht dazu angetan, diese Anschauungen zu ändern. Sie waren keine Gesetzgeber sondern Diener des Zeitgeschmackes. Fast alle sind sie zwar von der deutschen Bewegung, die von Carstens, Koch und den Nazarenern ausging, berührt worden. In Basel aber kamen sie dem Bedürfnis nach Alpenlandschaften und Veduten nach und unterrichteten die Jugend in einer Zeichenschule, die im 18. Jahrhundert gegründet worden war. Einer von ihnen, der genial veranlagte Hieronymus Heß, ist in der Enge der Heimat, verbittert und versauert, als Mensch und Künstler zugrunde gegangen, ein anderer, Miville, einer der Lehrer Böcklins an der Zeichenschule, hat auf vielen Reisen in zahlreichen Skizzenbüchern dieselben Gegenden und ähnliche Motive wie später sein Schüler verewigt, wenn auch ohne alle tiefere Originalität und ohne den feineren Natursinn des größeren Nachfahren.
Nicht der Glanz, mit dem Böcklin etwa als Knabe den Maler umgeben sah, hat ihn auf seine Bahn gelockt, sondern innere Notwendigkeit und das Gefühl, daß das, was er in sich trug, etwas Stärkeres und Besseres sei als die Triebkräfte, die seine künstlerische Umgebung beherrschten.
Böcklin ist der Sohn eines Kaufmanns, dessen Großeltern aus Beggingen im Kanton Schaffhausen eingewandert waren. Der Urgroßvater des Malers war offenbar ein verarmter Landwirt, der in einer Basler Fabrik sein Brot suchte und fand, auch der Großvater war Fabrikarbeiter; mit dem Vater aber begann der Aufstieg. Er war ein erfinderischer Kopf, hatte sich schon in ganz jungen Jahren durch die Verbesserung eines roten Farbstoffes die Wertschätzung seines Brotherrn erworben, dann mit zweiundzwanzig Jahren eine Tochter aus gebildeter und auch etwas wohlhabender Familie geheiratet und sich später selbständig gemacht. Das Vermögen der Frau ging freilich in seinem eigenen Unternehmen zugrunde. Er mußte dann wieder die technische Leitung einer fremden Fabrik übernehmen, und gerade in den Jahren, als die Söhne heranwuchsen, hatten sich die Eltern sehr einzuschränken. Die Mutter gehörte einer alten Basler Familie an, die schon seit Jahrhunderten von städtischer Kultur verfeinert worden sein mag. Ihre Mutter war eine Werenfels und Mitglieder dieser Familie haben sich verschiedentlich ausgezeichnet. Ein Werenfels, wenn auch nicht ein Vorfahr Böcklins, ist der Schöpfer der glanzvollen Rokokobauten aus den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Die erhaltenen Bilder von Böcklins Mutter zeigen eine Physiognomie von merkwürdig großem Schnitt; sie war eine feine, gebildete, begabte, wohl direkt bedeutende Frau, die Vertraute ihrer Kinder. Böcklins Jugend ist keine unglückliche gewesen; er erinnerte sich später gerne manch drolliger Geschichte aus seinen Knabenjahren. Er hat auch am städtischen Gymnasium eine tüchtige Schulbildung erhalten und wenigstens den Julius Cäsar noch im Originaltext gelesen. Einen wirklich bedeutenden Menschen lernte er hier in dem Germanisten und Dichter Wilhelm Wackernagel kennen, der neben seiner Tätigkeit an der Universität auch am Gymnasium Unterricht erteilen mußte, doch hatte derselbe die Schüler nicht etwa in die Literaturgeschichte einzuführen, der Unterricht ging lediglich darauf aus, ihnen ein möglichst gutes Deutsch beizubringen. Böcklin hat auch mit seinen Brüdern die Zeichenschule besuchen dürfen; nur davon wollte der Vater nichts wissen, daß er Maler werden sollte. Es gebe schon hungernde Maler genug. Ein Calame werde er doch noch lange nicht. Der Widerstand des Vaters war angesichts der eigenen Geldsorgen und angesichts der Künstlerschicksale, die er vor sich sah, begreiflich. Aber auch der Sohn hatte etwas von dem Wagemut der alten Eidgenossen und noch etwas mehr als einst der Vater; er glich ihm überhaupt sehr und vielleicht am meisten da, wo er ihm unbequem wurde, und der Entschluß, Maler zu werden, stand bei ihm fest. Die Mutter trat in ihrer ruhigen und stillen Weise auf des Sohnes Seite und fand eine Unterstützung bei seinem Lehrer Wackernagel. Sie durfte sich später wenigstens noch über die ersten äußeren Erfolge des Sohnes, die Berufung nach Weimar, freuen. Der Vater aber ist erst in dem Jahre gestorben, als Böcklin seine Toteninsel schuf; er hat also die glänzendste Schöpfertätigkeit des Sohnes noch miterlebt, indessen er gerade allem Anschein nach ohne zu ahnen, daß er einen der bedeutendsten und einflußreichsten Geister des damaligen Europa zum Sohne hatte; wenigstens äußerte er sich an seinem Lebensabend noch zu einem jungen Maler, der sich dem Meister angeschlossen hatte, es sei das Verhängnis seines Sohnes, daß er keinen Rat annehmen wolle.
An Anregungen hat es dem Maler in seiner Jugend nicht gefehlt. Die Familie wohnte, als er heranwuchs, in einem höchst malerisch gelegenen säkularisierten Kloster St. Alban, dicht an den grünen Fluten des Rheins. Kirche und Friedhof des Klosters werden heute noch gerne gemalt. Bei Basel umgeben die weite Ebene des Rheintals drei Gebirge, alle drei reich an Naturschönheiten. Offenbar hat der Jura am stärksten auf Böcklin gewirkt. Die langgezogenen Höhenrücken, die steil aufragenden Felswände, die malerischen Schluchten, die wundervollen Buchen- und Tannenwälder und die Burgruinen, die von Berg zu Berg hinübergrüßen und an eine kriegerische Vergangenheit erinnern, all das war dazu angetan, die Phantasie des Knaben mächtig anzuregen. Das Schlichte wirkt oft nachhaltiger als das Glanzvolle. Gewisse Grundzüge dieser Landschaft scheinen denn auch in berühmten Schöpfungen der Spätzeit, die im glänzenden Talare südlicher Vegetation auftreten, wiederzukehren.
Die Gemälde Holbeins, die den stolzen Kunstbesitz der Stadt bildeten, hingen damals noch in einem Raume der Bibliothek, der nicht genügend Licht hatte, wie Briefmarken in einem Album dicht beisammen „bis unter die Decke“; „aber ich hatte gute Augen“, meinte der Meister. Freilich befinden sich unter diesen Meisterwerken nur wenige, die auf Unvorbereitete tiefen Eindruck zu machen pflegen und auch das Wenige war—wie man glauben sollte—nicht dazu angetan, einen geborenen Landschafter anzuregen. Was die Arbeiten auszeichnete, war die Klarheit der Form und die Feinheit und Schärfe der Beobachtung, und dennoch, sie haben ihm „sehr gefallen“, haben ihn „sehr interessiert“, obwohl, wie er selber hervorhob, Holbeins Richtung eine andere als die seine gewesen ist.
Von starkem, wenn auch heute im einzelnen gar nicht mehr abzuschätzendem Einfluß auf das Denken und Fühlen des heranwachsenden Künstlers war endlich zweifellos die literarische Bewegung der Zeit (schon sein Zeichenlehrer klagte, Böcklin lese zu viel), waren auch die mächtigen Wogen der patriotischen Begeisterung, die in den vierziger Jahren durch die Schweiz gegangen sind. Die Zeit, in der Böcklin es durchsetzte, Maler werden zu dürfen, fällt zusammen mit der, da Gottfried Keller erkannte, daß er zum Dichter berufen war.
| LANDSCHAFT MIT GEWITTERWOLKEN | |
| 1846 |