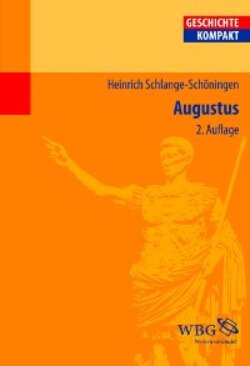Читать книгу Augustus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Die Krise der späten römischen Republik 3.1 Die strukturellen Probleme
ОглавлениеAristokratische Konkurrenz
Die Expansion über Italien hinaus hatte den Aristokraten, die durch die Kriegszüge zu großem Reichtum gelangt waren, ein weites Handlungsfeld für wirtschaftliche Aktivitäten eröffnet. Doch sahen die Familien, die bislang die Politik Roms geleitet hatten, in den neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten eine Gefahr für den Bestand ihrer Führungsrolle. Man befürchte, dass ein immer größerer Kreis reicher Männer Anteil an der Politik nehmen wollte und in den Senat drängen würde. Im Jahr 218 v. Chr. verfügte deshalb die lex Claudia de nave Senatorum, dass den Senatoren von nun an größere Handels- und Geldgeschäfte verboten sein sollten. Scheinbar stellte dieses Gesetz eine rückwärts gewandte Selbstbeschränkung der Senatoren auf den Landbesitz dar; tatsächlich aber wurde auf diese Weise die neue Aristokratie der Reichgewordenen aus den Führungsrängen der Politik ferngehalten. Allerdings konnte sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Senatoren, die durch immer neue Kriegsbeute immer mehr gesteigert wurde, seit 218 v. Chr. nur noch auf die Landwirtschaft richten, was erhebliche Auswirkungen auf die römische Gesellschaft haben sollte.
Ritterstand
Infolge der Abgrenzung der Senatsaristokratie entstand ein neuer, zweiter Stand im Staat, der Stand der Ritter. Die Ritter waren mit der von der Senatsaristokratie vorgenommenen Abgrenzung einverstanden, da sie ihnen wirtschaftliche Vorteile einbrachte. Der Ritterstand, bestehend aus all jenen, die über ein großes Vermögen verfügten, jedoch keine senatorische Laufbahn absolvierten, gelangte zu einer Monopolstellung im Handel beziehungsweise in den Geldgeschäften (zum Beispiel in der Steuerpacht). Für den Ritterstand ging es fortan vorwiegend um private wirtschaftliche Interessen, während die politische Verantwortung für die res publica bei den Senatoren lag. Als dann aber von Gaius Gracchus dem Ritterstand eine politische Aufgabe zugewiesen wurde, die darin bestand, die gegen erpresserische Statthalter geführten Prozesse als Geschworene zu entscheiden (quaestiones de repetundis), da wurde der Konflikt zwischen den beiden führenden Ständen institutionalisiert. In Rom konnten die Ritter in den Gerichten alle senatorischen Statthalter, die sich der Ausbeutung der Provinzen durch Steuereintreibung der Ritter in den Weg stellen würden, in Schwierigkeiten bringen, und dies war eine wirksame Drohung, die den Rittern weitgehend freie Bahn verschaffte und den Ruin der Provinzen beschleunigte. Es war später Sulla, der diesen Konflikt zwischen Senat und Rittern auf diktatorische Weise, das heißt durch den Ausschluss der Ritter von den Gerichten und durch die Proskriptionen, die physische Eliminierung zahlreicher Ritter, zu lösen versuchte.
Bauern
Die Beschränkung des Senatorenstandes auf den Landbesitz hatte aber noch weitere, diesmal den Bauernstand betreffende Folgen. Denn die wirtschaftliche Reglementierung führte zu einer Dominanz der aristokratischen Großgrundbesitzer, die das Staatsland (den ager publicus) okkupierten, ihre Latifundien mit großen Gruppen von Sklaven bewirtschafteten und damit die kleineren Bauernhöfe, soweit diese nach den langen Kriegszügen überhaupt noch bestanden, in ihrer wirtschaftlichen Existenzfähigkeit bedrohten. Viele römische Bauern hatten allein schon aufgrund ihres Dienstes in den Legionen kaum noch die Möglichkeit, ihre Höfe regelmäßig zu bewirtschaften, und verloren durch ihre lange Abwesenheit vom eigenen Gehöft ihre Lebensgrundlage. Doch selbst dann, wenn sie später als Veteranen neues Land zugewiesen erhielten, war es für sie schwierig, mit der Latifundienwirtschaft der Großgrundbesitzer zu konkurrieren. Dabei hatte der Bauernstand von jeher das Rückgrat der militärischen Stärke Roms dargestellt.
Agrarreformen und Heeresklientel
Vor diesem Hintergrund müssen zwei weitere Aspekte in Betracht gezogen werden, die für die Krise der Römischen Republik bedeutsam sind: Einerseits erkannten auch Angehörige der Nobilität die Notwendigkeit, den Bauernstand durch Agrarreformen beziehungsweise durch Landverteilungen zu stärken. Dies war ein Vorhaben, das bereits seit 170 v. Chr. auf der Agenda stand, jedoch für viel Streit sorgte und auch die italischen Bundesgenossen betraf, die ihrerseits Teile des ager publicus besetzt hatten. So spielte diese Frage eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Bundesgenossenkrieges im Jahr 91 v. Chr. Andererseits begann man in Rom über eine Erweiterung der Rekrutierung der römischen Soldaten über den Bauernstand hinaus zu diskutieren. Seit den Gracchen konnten die Soldaten ihre Rüstung von Seiten des Staates erhalten, und Marius hat dann am Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. diese Möglichkeit der erweiterten Rekrutierung umgesetzt und Massen von Besitzlosen in die Legionen gerufen. Dies führte jedoch zu einem neuen Problem für den römischen Senat: Wenn Besitzlose in den Legionen dienten, musste auch das Problem ihrer wirtschaftlichen Versorgung nach dem Ende ihres militärischen Dienstes gelöst werden, und damit fiel nun den Generälen eine ganz neue Bedeutung zu. Denn sie waren es, von denen die Soldaten ihre spätere Versorgung erwarteten. Bald war es dann soweit, dass die Frage der Veteranenversorgung den Feldherrn dazu veranlassen konnte, seine Truppen auch nach Abschluss eines Kriegszugs unter Waffen zu halten, um in Rom durchzusetzen, was er seinen Soldaten, die in ihrer weiteren Existenzfähigkeit ganz von ihm abhingen, schuldig war. Diese Generäle hielten mit den ihnen verpflichteten Legionen ein Machtmittel in den Händen, das sie zur Durchsetzung ihrer eigenen politischen Vorstellungen gegen Rom und den Senat führen konnten. Für die Soldaten, die viele Jahre außerhalb Italiens zugebracht hatten, wurde der Legionskommandant, von dem sie sich Landzuteilungen erhofften, zu einer wichtigeren Autorität als der römische Senat, der seinerseits diese neuartige Führungsstellung einzelner Aristokraten nicht einfach hinnehmen konnte (Heeresklientel). Dabei wurde der Konflikt zwischen Generälen und Senat durch die römischen Moralvorstellungen noch einmal verschärft. Seit jeher hatten die römischen Aristokraten versucht, in den Kämpfen für den römische Staat die eigene virtus (Tugend) zu beweisen, verschaffte der militärische Erfolg doch Ansehen und dauerhaften Ruhm, welcher der eigenen Familie auf Generationen hinaus eine besondere Position in der römischen Gesellschaft sicherte. Jetzt aber verwandelte sich die Befehlsgewalt der er folgreichen Militärs in ein politisches Übergewicht, welches das Gefüge der Republik und die Stellung des Senats zu zerstören drohte. Für jeden der mächtigen Heerführer der ausgehenden Republik hätte jedoch eine Einschränkung seiner Befugnisse bedeutet, die Möglichkeit zu weiteren militärischen Erfolgen aufgeben zu müssen. Ihnen ging es nicht mehr allein um die äußere Sicherheit der res publica, und auch nicht allein um die ihnen obliegende Veteranenversorgung, die sie in Rom durchsetzen muss ten, sondern zugleich immer auch um die eigene dignitas (Ehre).