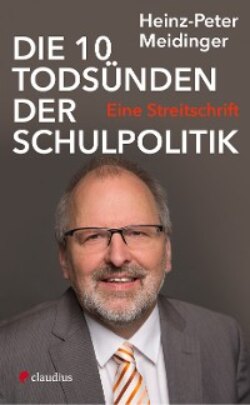Читать книгу Die 10 Todsünden der Schulpolitik - Heinz-Peter Meidinger - Страница 5
TODSÜNDE NR. 1: Überforderung von Schule durch politische Vorgaben und gesellschaftliche Erwartungshaltungen – Schule als Reparaturbetrieb der Gesellschaft
ОглавлениеDas ist der Ausgangspunkt für eine vielfach wachsende Unzufriedenheit mit unseren Bildungsinstitutionen. Die Folge einer immer größer werdenden Differenz zwischen den Versprechungen der Politik, den dadurch anwachsenden Erwartungshaltungen der Menschen und der in der Praxis fehlenden Einlösung dieser Ankündigungen ist Enttäuschung und Frust.
Wir erleben in Deutschland eine umfassende, leider immer noch weiter fortschreitende permanente Überlastung unserer Schulen mit immer neuen Aufgaben, Erwartungen, Vorgaben und gesellschaftlichen Ansprüchen, ausgehend von einem Machbarkeitswahn, als könne Schule alles regeln. Ich kenne kaum ein Land in der Welt, in dem Schulen, und damit Lehrkräfte, mit so vielfältigen gesellschaftlichen und politischen Erwartungen konfrontiert werden wie in Deutschland. Neben den eigentlichen, ursprünglichen Kernaufgaben Unterricht, Wissens-, Kompetenz- und Wertevermittlung soll Schule unter anderem
• Erziehungsdefizite beheben
• individuelle Förderung umsetzen
• gesellschaftliche Unterschiede ausgleichen
• Inklusion verwirklichen
• Integration vorantreiben
• Medienerziehung betreiben
• Schüler auf die Digitalisierung vorbereiten
• Berufs- und Studienorientierung geben
• Antisemitismus, Extremismus und Hass bekämpfen
• die Demokratie stärken
Die Aufzählung könnte noch lange fortgesetzt werden. Gegen die Ziele an sich lässt sich inhaltlich nicht viel sagen; die Frage ist nur, ob und in welcher Weise eine so mit Zielvorgaben überfrachtete Schule diesen auch nur ansatzweise noch gerecht werden kann.
Schule ist in Deutschland mehr als irgendwo anders in der Welt zum Reparaturbetrieb der Gesellschaft erklärt worden. Ein Symptom dafür ist die Forderung nach immer neuen Fächern aus dem Kreis von Interessensverbänden und politischen Parteien. Nach meiner Zählung waren es über 40 in den letzten 20 Jahren, darunter Gesundheit, Ernährungserziehung, Digitalkunde, Benehmen, Glück, Alltagskompetenz, Verbraucherkunde, Klimaschutz und Rauschkunde. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Politik alle die ungelösten Probleme an die Schulen delegiert, an denen sie selbst gescheitert ist. Das Fatale ist nur: Bei solcher Überforderung kann auch Schule selbst nur scheitern! Kein Jahr, in dem nicht in den Medien das Versagen des Bildungssystems thematisiert wird, sei es bei der Integration, der Inklusion, der Bildungsgerechtigkeit, der Demokratieerziehung, manchmal auch im Kernbereich der Schulleistungen.
Dieser Allmachtswahn, der Bildungspolitik oftmals prägt, findet mitunter eine interessante Entsprechung bei genau der Wissenschaft, die explizit Erziehung und Bildung zum Gegenstand ihrer Forschung und Theorien gemacht hat – bei der Pädagogik. Geradezu ein Wesensmerkmal für die Geschichte der Pädagogik ist der Widerspruch zwischen den eigenen Ansprüchen, den formulierten Erwartungen auf der einen Seite sowie den immer wieder ernüchternden Ergebnissen der praktischen Umsetzung und der enttäuschenden Realität auf der anderen Seite. Nichts gegen die Entwicklung neuer Lernkonzepte, aber es wirkt schon fast rührend, wie stark der Glauben bei so manchem Reformpädagogen noch ist, durch das richtige pädagogische Konzept wenn nicht einen neuen Menschen erschaffen, dann zumindest eine neue Lernwelt mitgestalten zu können, in der das Lernen allen Schülern zu jedem Zeitpunkt grenzenlosen Spaß macht. Optimismus ist für die Arbeit von Lehrkräften hilfreich, das Nicht-zur-Kenntnis-nehmen der Realität aber gefährlich, weil es auch da – wie in der Politik – zu Enttäuschungen und Frustrationen führt. Eine empirisch ausgerichtete Erziehungswissenschaft kann allerdings helfen, wieder ein Stück auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. In einer umfangreichen relevanten Studie über die begrenzte Veränderbarkeit und Steuerbarkeit von Lernmotivation aufgrund der starken genetischen Prägung heißt es: „Schüler sind mit individuellen Begabungen ausgestattet, und es wird nicht möglich sein, sie durch Fördermaßnahmen auf breiter Basis zu gleichen Leistungen zu befähigen.“ Diese Erkenntnis soll nicht dazu dienen, erzieherische Anstrengungen auf Seiten von Lehrkräften und Eltern zu reduzieren, sie kann aber helfen, die eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen.
Heute hat die Hirnforschung die Pädagogik als Wissenschaft für erzieherische Allmachtsphantasien abgelöst. Obwohl die für die Pädagogik hilfreichen Erkenntnisse der Hirnforschung relativ banal sind, etwa dass Lernen vor allem dann gut funktioniert, wenn es mit Freude und aktiver Beteiligung erfolgt und genügend große Zeitfenster dafür bereitstehen, sind auch viele Lehrkräfte davon angetan. Ja, die Vorstellung, man müsse nur die richtigen Knöpfe drücken und die entsprechenden Gehirnprozesse auslösen, hat etwas Faszinierendes. Die Realität sieht leider anders aus.
Dabei ist die Lehrkraft genau das Medium, die Schnittstelle, an der Erwartungshaltung der Gesellschaft und unzureichende Erfüllung dieser Forderung aufeinanderprallen. Deshalb ist die direkte Folge der Todsünde „Überforderung der Schule“ ein unerträglich hoher Erwartungsdruck auf die Lehrerinnen und Lehrer, die ja schließlich am Ende die sind, die diese Versprechungen erfüllen sollen.
Kaum irgendwo anders auf der Welt, zumindest in Industriestaaten, stehen Lehrkräfte unter solchem Druck, die Vorgaben der Politik und die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, wie bei uns. Sie kennen vielleicht die folgende Feststellung, die bereits vor über 30 Jahren von dem Arbeitsmediziner Professor Müller-Limmroth getroffen wurde: „Die Lehrkraft hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Behinderten bei dichtem Nebel durch unwegsames, ungesichertes Gelände in nordwestsüdöstlicher Richtung zu führen, und zwar so, dass alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an mindestens drei verschiedenen Zielorten ankommen.“ Also praktisch eine „mission impossible“!
Nicht wenige Lehrkräfte kommen mit diesem Druck nicht klar. Er führt oft erst zur Selbstausbeutung der Arbeitskraft und schließlich zum Burn-out.
Kaum eine Landesregierung hat in den letzten Jahren, obwohl es freilich in die Kernaufgabe ihrer Fürsorgepflicht fällt, wissenschaftliche Arbeitszeituntersuchungen über die Belastung und die Gesundheit ihrer Lehrkräfte in Auftrag gegeben. Diese eigentliche Staatsaufgabe mussten nun Lehrerverbände selbst in die Hand nehmen. Die Ergebnisse der entsprechenden gerade veröffentlichten Studie „Lehrerarbeitszeit im Wandel“ (LaiW) des Deutschen Philologenverbandes weist den Landesregierungen enorme Versäumnisse beim Gesundheits- und Überlastungsschutz der rund 800 000 Lehrkräfte nach. Immer neue Aufgaben führen zu immer mehr Verwaltungsaufwand, dazu große Klassenstärken und im internationalen Vergleich hohe Unterrichtsdeputate.
Todsünde Nr. 1 hat denn auch dazu geführt, dass unsere Lehrkräfte am Limit angelangt sind.