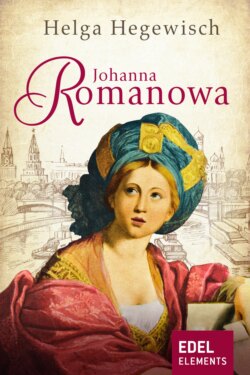Читать книгу Johanna Romanowa - Helga Hegewisch - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
ОглавлениеJohanna Wolters war eine Hexe.
Auf den ersten Blick konnte man nichts Besonderes an ihr erkennen – sie war mittelgroß, mittelkräftig, kaum mehr als mittelschön, sie hatte feste Hände, eine schmale Taille und stabile Beine. Das einzig Auffallende war vielleicht, dass sie gelegentlich vor sich hin redete, dies jedoch nur, wenn sie sich allein wähnte.
Ihr Lebenswandel ließ jedoch zu wünschen übrig: Obgleich Tochter eines ehrsamen Handwerkermeisters und dazu noch Witwe des Lehrers Wolters, der vielen Neuruppiner Kindern das Lesen und Schreiben beigebracht hatte, hielt sie engen Kontakt mit dem Abdecker, der sich auf dem Schindanger um die Häutung und Beseitigung der Tierkadaver kümmerte, und vor allem mit den beiden Totenwäscherinnen, von denen die jüngere, Katharina Wiesner, sich angeblich gegen Geld erbot, die heimlichen Abgänglein der Unverheirateten in einer verborgenen nördlichen Ecke des Stadtfriedhofes zu begraben.
Doch trotz dieser anrüchigen Beziehungen wurde Johanna keineswegs immer und von jedermann als Hexe angesehen, letztlich wohl nur von denjenigen, die ihrer Hilfe gerade nicht bedurften. Für die Bedürftigen hingegen war sie die Heilerin, die weise Frau, das galt für die Mutterschaftssehnsüchtigen ebenso wie für die Mutterschaftsüberdrüssigen, für die Weiber mit unfruchtbarem und vor allem für die mit dem allzu fruchtbaren Schoß. Außerdem war sie – Hexenkunst hin und her – die einzige Hebamme im Ruppiner Land, unter deren Händen noch nie ein Kind bei der Geburt oder kurz danach gestorben war. Allerdings nahm man ihr übel, dass sie ihre Geburtshilfe an feste Bedingungen knüpfte: Während der letzten Monate der Schwangerschaft verlangte sie von den Frauen wöchentliche Visitationen in ihrem Haus, wo sie sich ein Behandlungszimmer eingerichtet hatte. Und auch die eigentliche Geburt hatte dorten stattzufinden, wobei anderen Menschen, ob Männern oder Frauen, der Zutritt streng untersagt war. Es erforderte von einer Schwangeren schon einigen Mut, sich in Johanna Wolters’ Hände zu begeben.
In den dunklen Jahrhunderten zwischen Altertum und Mittelalter wäre so eine wie Johanna vermutlich als weise Frau in der ganzen Region hoch geehrt gewesen, als Kennerin und Hüterin vor allem der weiblichen Geheimnisse. Im Mittelalter allerdings, als durch Kriege und Pest die Bevölkerung stark dezimiert worden war und die Landesherrn dringend Nachschub an Soldaten und Leibeigenen brauchten, wäre sie wohl auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.
Jetzt, in den Jahren des Aufbruchs in die Moderne, fühlte sich das protestantische Neuruppin zwar erhaben über den Aberglauben und die Praktiken des Mittelalters, also ließ man die Hexe leben, ging ihr jedoch bei Tageslicht besser aus dem Weg und schlich sich erst nach Sonnenuntergang in ihr Haus, das am westlichen Rande der Stadt lag.
Für eine weise Frau war Johanna noch reichlich jung. In diesem Jahr des Herrn 1697 wurde sie sechsundzwanzig Jahre alt, doch war sie schon als Kind, anstatt zu spielen oder der Mutter im Haus zur Hand zu gehen, in den Wiesen und Wäldern herumgestrolcht, um bestimmte Kräuter, Wurzeln, Beeren und vor allem die Webfäden der großen Waldspinne einzusammeln.
Nach ihrer frühen Heirat und der Geburt ihres Sohnes Alexander, die dem Vernehmen nach schwer und langwierig gewesen war und nur durch einen beherzten Bauchschnitt des Medicus Dr. Heinrich Ansbach zu einem guten Ende geführt werden konnte, hatte sie sich dann mit aller Kraft auf das Erlernen medizinischen Wissens geworfen. Dass die Universitäten den Frauen verschlossen waren und ihnen der Umgang mit der Wissenschaft, vor allem mit der Medizin, verboten war, schien Johanna in ihrem Wissensdrang nicht sonderlich behindert zu haben. Klar, sagten die Leute, sie könne sich ja auf höhere Mächte als auf die der brandenburgischen Justiz beziehen – auf dunkle Mächte! Der Teufel handele durch das Weib, und im Leiden, zumal im Geburtsleiden der Frauen, habe man eine gottgegebene Möglichkeit zu sehen, sich von der Ursünde zu befreien.
Weibliches Wissen, auch wenn man es gelegentlich gut gebrauchen konnte, war vom Teufel inspiriert.
Am siebzehnten August 1697 stand Johanna am Rande der großen Durchgangsstraße und wartete auf die russische Reisegesellschaft, die den Neuruppinern von Fürstenberg her angekündigt worden war. An die zweihundert Männer sollten da unterwegs sein, zu Fuß, zu Pferde, im Reisewagen. Mehr als dreißig vierspännige Kutschen waren gezählt worden, dazu mindestens zehn sechsspännige Frachtwagen und fünfzig oder hundert oder noch mehr Ersatzpferde. Und mitten unter dieser bunten Schar sollte sich Pjotr Alexejewitsch Romanow befinden, der Zar aller Reußen. Er reiste inkognito, aber da die Kunde von seinem angenommenen Namen Pieter Michailowitsch wie auch die Beschreibung seiner Riesengestalt – mindestens zwei Meter zehn sei er lang – dem Zug von Ort zu Ort voraneilte, konnte es mit dem Inkognito nicht allzu weit her sein.
Johanna wartete zwar gemeinsam mit hunderten anderer Neuruppiner, doch stand sie in dem Gedränge sichtbar isoliert, als hätte sie einen magischen Kreis um sich gezogen. In ihrer unmittelbaren Nähe befanden sich nur ihr siebenjähriger Sohn Alexander, den alle Schura nannten, und die alte Kinderfrau Olga, die ihren Arm um Johannas Schultern gelegt hatte. Besitzergreifend und dabei doch vor allem sich selbst stützend. Johanna trug ein schlichtes schwarzes Kleid, hatte jedoch statt der gebotenen Witwenhaube ein weißes Tuch um ihren Kopf geschlungen, wodurch sie ein wenig nonnenhaft wirkte.
Es war ein heißer Augusttag. Die Menschen, von denen einige sich in ihre Festtagsgewänder gezwängt hatten, schwitzten. Johanna öffnete die beiden oberen Knöpfe ihres Witwenkleides und rollte die Ärmel hoch. Daraufhin beugte sich Olga zu dem kleinen Alex und sagte auf Russisch: »Geh, Schura, hol der Mama ihren Schirm.«
Der Knabe weigerte sich: »Ich muss hier stehen bleiben, sonst könnte ich noch den Zaren verpassen!«
»Dann geh ich eben selber«, greinte Olga, »ich altes Weib mit meinen krummen Füßen.«
Johanna hielt ihre Hand fest. »Lass doch, Babuschka, ich brauch keinen Schutz. Die Sonne tut mir gut.«
»Was weißt denn du, was dir gut tut!«
Seufzend und ärgerlich vor sich hin babbelnd, humpelte Olga davon. Das silberne Doppelkreuz, das ihr wie immer vor dem eingefallenen Busen hing, schaukelte im Takt ihrer Schritte hin und her. Nach zehn Minuten war sie zurück und breitete einen großen schwarzen Sonnenschirm über Johanna. Die Menschen rundherum spotteten: »Das Zuckerpüppchen könnte ja sonst wegschmelzen. Dabei ist es doch an sehr viel heißeres Feuer gewöhnt.«
Johanna ließ das hämische Gerede der Leute ebenso stoisch über sich ergehen wie Olgas Überfürsorge. Sie sagte nur: »Wenn du das Ding so hältst, wirst du noch einen lahmen Arm kriegen.«
»Besser mein Arm als dein Kopf!«, sagte Olga.
In diesem Moment tauchten vor der Altruppiner Kirche die ersten Reiter auf. Schwere Pferde, bunt gekleidete Menschen mit seltsamen Kopfbedeckungen. Manche Männer trugen einen eleganten Dreispitz, andere schlichte Filzkappen, und zwei oder drei hatten ihre Köpfe sogar trotz der Sonnenhitze mit dicken, runden Fellmützen bedeckt. Der Zug bewegte sich nur langsam vorwärts, offenbar richteten sich die Vorreiter nach dem Tempo der vielen Fußgänger, die hinter den Reitern und vor den Wagen und Kutschen das Kernstück der Gruppe bildeten.
Als der Zug heran war, fing Olga vor Rührung an zu weinen. »O heiliges Mütterchen Russland«, schnaufte sie, »warum nur hab ich dich verlassen!«
»Nimm dich zusammen, Babuschka«, fuhr Johanna die Alte an, »wenn du wirklich nicht weißt warum, dann kannst du dich ja dem Tross anschließen und zurückgehen.«
Sogleich war Olga still.
Direkt hinter den Vorreitern kam ein festlich geschmückter Leiterwagen, auf dem sich zehn oder zwölf Zwerge befanden, gekleidet wie für einen höfischen Ball. Sie grüßten leutselig, als wären sie regierende Fürsten, und die kleinen Damen warfen Kusshändchen.
Der sehr viel schmalere zweite Wagen war ungeschmückt und machte kaum mehr her als ein armseliger Leichenwagen. Auf einem Thron aus grob zusammengefügten Brettern saß ein buckliger Narr mit Schellen an der Mütze und der Narrenklatsche in der Hand. Rechts und links von ihm hockten zwei weitere Gestalten, halb verborgen unter großen Säcken. Alle zwei, drei Minuten stieß der Narr ein scharfes Gelächter aus und zog ihnen für einen kurzen Moment die Säcke von den Köpfen. Zum Vorschein kamen zwei grausige Missgeburten, der einen hing eine handgroße Zunge aus dem Mund, mit der sie sich sabbernd über das plattgedrückte Gesicht fuhr, die andere hatte eine Schweinenase und anstelle des rechten Auges ein großes, violett glänzendes Geschwür.
Die Zuschauer schrien auf bei dem Anblick, und nur wenige Mutige, zu denen auch Johannas kleiner Sohn gehörte, wagten ein hämisches Gelächter. Ärgerlich wies Johanna ihr Kind zurecht. »Über das Unglück anderer Leute lacht man nicht!«
»Warum denn sonst hat der Zar sie uns mitgebracht?«
»Um uns an die finsteren Seiten des Lebens zu erinnern!«
»Olga hat aber gesagt, dass es im Leben eines Zaren keine Finsternis gibt.«
Aufgeregt zappelte er an ihrer Hand. »Wann kommt denn der Zar«, rief er ein ums andere Mal, »ich will endlich den russischen Zaren sehen.«
Ein Mann hinter Johanna hatte sich auf einen Stuhl gestellt. »Da kommt er«, schrie er begeistert, »er ist mindestens drei Köpfe größer als alle anderen, und er geht zu Fuß!«
»Bist nicht ganz gescheit, drei Köpfe größer! Und zu Fuß geht so einer wie der Zar schon ganz und gar nicht.«
»Der kommt ja auch nicht als Zar, der kommt als einfacher Handwerker. Zimmermann will er sein, das hat mir mein Vetter aus Stettin berichtet.«
»Und wozu braucht ein Zimmermann all die Wagen und Kutschen?«
Für die Neuruppiner, die an disziplinierte Auftritte Brandenburgischer Truppen gewöhnt waren, hatte dieser russische Zug etwas Befremdliches, fast Wildes. Etwas, dem gegenüber äußerste Zurückhaltung geboten war. Statt zu winken und in Willkommensrufe auszubrechen, verstummte die Menge.
Obgleich die Durchgangsstraße gepflastert war, wirbelten die Reiter und Wagen eine dichte Staubwolke auf. Die Gesichter der Marschierenden waren grau, doch wirkten sie keineswegs müde. Blitzende Augen schweiften abschätzend über die Zuschauer und hielten selbstbewusst den stummen Blicken der Neugierigen stand.
Johanna schloss die Augen und sog prüfend den Geruch von Leder und Pferden und Schweiß ein. War da irgendeine Erinnerung? Olga hatte ihr oft von dem rauchigen, süßlichen Geruch russischer Lederwichse erzählt, mit der die Männer nicht nur Stiefel und Zaumzeug, sondern auch das Innere ihrer Kopfbedeckungen behandelten, wodurch ihre Haare und Köpfe oft den gleichen Geruch annahmen. War das der Geruch, den sie jetzt wahrnahm? Das leicht Ranzige und Verbrannte wurde im Zaum gehalten von etwas Zitronenmelisse und Holunder. Keine unangenehme Mischung, obgleich sie selbst sicher etwas anderes, Gefälligeres zusammengestellt hätte, doch darum ging es im Moment nicht. Das einzig Wichtige war, dass sie so etwas noch nie gerochen hatte. Dessen war sie sich absolut sicher. Erleichtert stieß sie die Luft aus der Nase. Doch bevor sie sich noch näher mit ihrer neuen Erkenntnis auseinander setzen konnte, geschah etwas Unvorhergesehenes: Ihr Sohn Schura riss sich plötzlich von ihrer Hand los, stürmte auf einen Mann im Tross zu und hängte sich an ihn: »Nimm mich mit, Gosudar«, schrie er auf Russisch, »lass mich mit dir nach Russland gehen, ich bin ein Romanow.«
Der Mann, der tatsächlich riesengroß war und als Einziger keine Kopfbedeckung trug, trat aus der Truppe und beugte sich zu dem Kind: »Was bist du?«
»Ein Romanow, ein Romanow, Majestät Imperator Gosudar, du bist ein Kaiser, und ich bin ein Prinz.«
Erschrocken sprang Johanna hinzu. Sie gab ihrem Sohn eine kräftige Ohrfeige und riss ihn an sich.
»Verzeihung, Herr«, sagte sie, »der Knabe denkt sich gern Märchen aus.«
»Und wieso sprichst du russisch?«, fragte der Mann.
»Und du, Herr?«, entgegnete Johanna, »wieso sprichst du kein Deutsch?«
Der Mann lachte. »Gut geantwortet, Weib, ich werd’s mir merken. Deutsch ist eine große Sprache, man sollte sie beherrschen. Aber dein Kind irrt sich, wenn es meint, ich wäre der Imperator. Ich bin der Zar aller Reußen. Euer Kaisertitel gebührt mir nicht.«
»Keine Sorge, Herr, du wirst ihn dir schon noch geben.«
Johanna wandte sich ab und stieß den Knaben vor sich her, zurück zu den glotzenden Zuschauern, wo er direkt in den Armen der heulenden Olga landete.
»Da siehst du mal, was du mit deinem Gerede anrichtest!«, herrschte sie die alte Frau an. Die drückte den Knaben an sich und kreischte hysterisch: »Kein Kaiser, kein König, kein Zar! Nicht einmal ein Romanow ist er, ein Wechselbalg aus der Sloboda.«
»Schluss jetzt, Babuschka, mach mich nicht zornig. Verschwinde, geh nach Haus, nimm das Kind mit dir, und schließ die Tür hinter dir ab. Und du, mein Sohn« – eine weitere Ohrfeige – »mit dir werde ich mich später beschäftigen!«
Den russischen Riesen schien der Auftritt zu amüsieren.
»Recht hat die Alte, ich bin kein König, kein Kaiser, kein Romanow. Mein Name ist Pieter Michailowitsch, und von Beruf bin ich ein Schiffszimmermann, do swidanija, Weib, dein Sohn gefällt mir. Eines Tages werde ich ihn mir holen und einen guten Soldaten aus ihm machen! Und wäre er tatsächlich ein Romanow, ich würd ihn gern gegen meinen eigenen Sohn auswechseln.«
Mit großen Schritten ging er hinter dem Zug her und reihte sich wieder ein, während sich ein paar Männer aufgeregt um Johanna scharten und sie beschimpften: »Immer du, immer dieselbe, die sich nicht an die Regeln hält. Kannst du dein Kind und dieses alte Weib hier nicht in Zaum halten? Was hast du mit dem Zar zu reden gehabt?«
»Das war nicht der Zar, das war Pieter Michailowitsch, ein niederländischer Schiffszimmermann«, wehrte sich Johanna. »Das hat er gerade selbst gesagt.«
Ein böses Gelächter antwortete ihr. »Wir lassen nicht zu, dass der große Zar in unserer Stadt eine Kränkung erfährt!«
Die Männer kamen bedrohlich näher. Johanna sah sich um, Olga und Schura waren fortgelaufen, Gott sei Dank. So würde sie nur für sich alleine geradestehen müssen.
Mit dem Geradestehen allerdings hatte sie gewisse Schwierigkeiten, denn was anfänglich für die Männer nur eine Unmutsäußerung gewesen war, ein kleiner Aderlass nach der langen Warterei unter der heißen Mittagssonne, steigerte sich rasch zu kopfloser Aggression. Verschwitzte Hände griffen nach ihr und stießen sie hin und her.
»Hört auf, lasst mich in Ruh«, schrie sie, »ich habe niemanden gekränkt.«
»Du hast in der Teufelssprache gesprochen!«
Da tönte hinter den hitzigen Männern plötzlich eine ruhige Stimme, laut, jung und etwas fremd. »Sie hat russisch gesprochen, was denn sonst!«
Der Mann, der Johanna am nächsten stand und ihr bereits das Tuch vom Kopf gerissen hatte, fuhr herum. »Und wer bist du, dass du die Teufelssprache vom Russischen unterscheiden kannst?«
»Nur ein Schiffszimmermann auf der Wanderschaft. Aber das Russische ist mir von Jugend an vertraut, es war meine Kindersprache. Und diese Frau hier und ihr Sohn haben dem großen Russen nur alles Gute gewünscht und Gesundheit und ein langes Leben. Das war ein Akt der Höflichkeit, zu dem sich ja sonst hier keiner bereit gefunden hat.«
Energisch schob sich der junge Mann durch die Menge zu Johanna, hob das weiße Kopftuch vom Boden auf und reichte es ihr.
Sie sah ihn an: Lang und dünn, rötlich-braunes Haar, ein schmales, sommersprossiges Gesicht und hellblaue scharfe Augen. Obgleich er selbst keineswegs Gelassenheit ausstrahlte, gab sein Eingreifen Johanna die Ruhe wieder. Als sie ihm das Tuch aus der Hand nahm, hielt sie für den Bruchteil einer Sekunde seine Finger und fragte: »War es denn nun der Zar oder war er es nicht?«
»Das wissen nur die Sterne«, antwortete der Wandersmann, »aber die wissen es ganz genau!« Er verbeugte sich tief und ging eilig davon.
Als Johanna nach Hause kam, stand die alte Olga breitbeinig vor der Tür und sah ihr entgegen.
»Ich hatte dir gesagt, du sollst ins Haus gehen und die Tür abschließen«, sagte Johanna ärgerlich.
»Die Tür ist abgeschlossen und Schura ist im Haus«, antwortete Olga. »Und mir persönlich will keiner übel, ich bin ja nur die Kinderfrau.«
Johanna seufzte. »Also was ist los, Olga?«
Die Alte nahm Johanna beim Arm, zog sie auf die Gartenbank und hockte sich neben sie. »Gefiel dir dieser Russe?«, fragte sie vertraulich, »dieser angebliche Pieter Michailowitsch?«
»Weiß ich nicht.«
»Du lügst! Und du gefielst ihm auch, ich hab’s genau gesehen!«
»Na und? Er ist der Zar von Russland, und ich bin eine Neuruppiner Lehrerswitwe.«
»Er ist der Sohn eines Hufschmieds, und du bist eine Romanow.«
»Nicht schon wieder die alte Geschichte, bitte. Ich kenne sie auswendig und glaube sie doch nicht.«
»Ich weiß aber Bescheid, ich war dabei!«, sagte Olga streng und griff sich an das silberne Doppelkreuz, was sie immer tat, wenn sie irgendeinen Halt brauchte. »Und einer alten Frau solltest du nicht widersprechen.«
»Gut, gut, Babuschka. Was gibt’s sonst Neues? Worüber willst du so dringend mit mir reden?«
»Will ich ja gar nicht. Weil du mir sowieso nie zuhörst.«
Johanna nahm Olgas Hand und streichelte sie. »Ich weiß, ich hab wenig Zeit. Aber nun bin ich hier, und nun höre ich dir zu.«
»Also ich dachte mir«, sagte Olga vorsichtig, »wenn du ihn heiratest, dann würde das seine niedrige Geburt aufwerten und dich endlich zur Zariza machen.«
Johanna lachte versöhnlich. »Wenn’s weiter nichts ist! Ich werde ihm also einen Heiratsantrag machen, schriftlich. Wie soll ich ihn denn anreden? Pieter Michailowitsch oder Möchtegernmajestät oder etwa Gosudar Pjotr Alexejewitsch?«
Olga nickte versonnen. »Namen sind Schall und Rauch. Aber mein Täubchen braucht endlich einen richtigen Mann, und dieser ist groß und schön und stark.«
Bei der letzten Bemerkung nickte Johanna unwillkürlich, und das ärgerte sie. Doch ja, der Zar war eine imposante Erscheinung, er hatte ihr gefallen. Einen Mann allerdings brauchte und wollte sie auf gar keinen Fall. Sie hatte bereits einen gehabt, und das reichte ihr. »Schluss jetzt, Babuschka. Du hast gesagt, was du sagen wolltest. Und auf mich wartet Arbeit.«
»Immer wartet Arbeit auf dich«, greinte Olga, »und die Arbeit versperrt dir die Tür zum Leben. Dabei ist Arbeit doch nur etwas für die, die arbeiten müssen. Eine Zarentochter tut so etwas nicht.«
»Was tut sie denn den lieben langen Tag, deine Zarentochter?«
»Sie macht sich schön und lässt sich Geschichten erzählen.«
Johanna, die ihre alte Kinderfrau sehr liebte, gab nach. »Das Schönmachen wäre bei mir verlorene Mühe. Aber eine kurze Geschichte könntest du mir erzählen. Allerdings darf sie nicht am Zarenhof spielen.«
»Bitte, Täubchen…!«
»Auf gar keinen Fall!«
Olga seufzte tief, schluckte, schniefte und legte dann den Kopf zur Seite. »Dann vielleicht eine von Aurora?«, fragte sie vorsichtig.
»Wenn’s denn sein muss, also dann eine von deiner Aurora, der schönen Königsmarckin. Was gibt’s Neues über sie?«
Sogleich richtete Olga sich auf, hob den Kopf und sagte triumphierend: »Sie hat mit Zar Peter geschlafen.«
Johanna lachte hellauf. »Eine begabte Person! Als du mir zuletzt eine Aurora-Geschichte erzählt hast, da war sie noch die maîtresse en titre von August dem Starken!«
»Da siehst du mal, wie selten du mir zuhörst. Seit einem Jahr hat der Sächsische Kurfürst eine neue Geliebte.«
»Und die Königsmarckin?«
»Hat einen Sohn von August und will jetzt Äbtissin in Quedlinburg werden!«
»Und dafür muss sie mit Zar Peter ins Bett gehen?«
»Du sollst nicht so respektlos reden! Und ob es wirklich das Bett war, ist nicht ganz sicher. Jedenfalls hat sie zwei Nächte lang ihre Scherze mit ihm getrieben. In Dresden. Im Grünen Gewölbe. Und Matriona Sergejewna hat heimlich zugesehen.«
»Tatsächlich? Und was hat sie da entdeckt?«
Olga wusste genau, dass sie jetzt ihr Täubchen gefangen hatte, für die nächsten Minuten würde es ihr nicht davonfliegen. Zufrieden lehnte sie sich zurück. »Er hat gesungen, die Trommel geschlagen und allein fünf Rebhühner verzehrt.«
»Und sonst noch?«
»Hat er eine ganze Flasche Wodka getrunken. Und als er so recht tüchtig betrunken war, da hat er …«
»Ja was denn nun?«
»Sitz still, Täubchen, dann erzähl ich weiter.«
Der junge Zimmermann auf Wanderschaft, der das Russische von der Teufelssprache zu unterscheiden wusste, hieß Stepan Simonowitsch Melchior. Er war als Sohn deutscher Einwanderer im russischen Schwarzerdegebiet geboren worden, in Woronesh am Woronesh. Obgleich Zar Peter mit Stepans Vater Simon eine leutselige Freundschaft unterhielt – der junge Zar hatte bei Simon das Schiffbauhandwerk erlernt –, gehörte Stepan nicht etwa zum russischen Tross und hatte sich auch dem Zaren nicht als Sohn von Simon Melchior vorgestellt. Das Zusammentreffen der beiden Männer in Neuruppin war unbeabsichtigt, man hätte es zufällig nennen können, doch Stepan glaubte nicht an Zufälle.
Für den Zaren lag der schlichte Grund für einen Besuch in der brandenburgischen Residenzstadt in der gut gepflasterten Durchgangsstraße. Stepan jedoch hatte sehr viel großartigere Motive bemüht: die Legalität der Macht, die göttliche Ordnung und den menschlichen Widerstand dagegen.
Stepan Simonowitsch Melchior war ein Nachtmensch. Er beobachtete das Firmament, aber hier, in Neuruppin, beobachtete er vor allem die junge Witwe Wolters, deren frühes Witwentum ihm übrigens Kopfzerbrechen bereitete – er hatte dafür keine Bestätigung in den Sternen finden können. Für seine Forschungsarbeit benutzte er meist eine sehr scharfe Brille, vermittels derer er auf hundert Meter Entfernung an einem Baum die Blätter zählen konnte. Erworben hatte er dieses kostbare Stück vor zwei Jahren in einer kleinen Stadt am Euphrat in der türkisch beherrschten Provinz Euphrat-Tigris, wohin er gewandert war, um die astrologischen Erkenntnisse der alten Babylonier zu studieren. Dass er dabei auch gleichzeitig einiges über Be- und Entwässerungssysteme und über natürliche Flussreinigung gelernt hatte, war ihm, als er wieder daheim war, sehr nützlich. Zwar interessierte ihn das Wasser vor allem wegen des Einflusses der Gestirne darauf und kaum wegen des menschlichen Umgangs damit, doch sorgten die babylonischen Erfahrungen für seinen Lebensunterhalt, zumal in Gegenden, wo man sein Schiffszimmermann-Handwerk nicht brauchen konnte.
Für seine Forschungen besaß Stepan auch ein Fernrohr, noch weit kostbarer als die ungewöhnliche Brille. Dafür hatte er sechs Monate lang für einen reichen Kaufmann in Tripolis geschuftet – keine verlorene Zeit, denn nach getaner Arbeit hatte er dessen Bibliothek benutzen dürfen.
Seit drei Jahren war er nun schon unterwegs, und die Zimmermannstracht war ihm stets mehr Verkleidung denn Bekenntnis gewesen. Er war ein Grübler und Tüftler, einer, der sich stets der astrologischen Situation versicherte, bevor er sich zum Handeln aufraffen mochte. Hatte er jedoch erst einmal die Konstellationen der Sterne errechnet, so war er unter dem Schutzmantel himmlischer Ordnung durchaus zu spontanen Handlungen fähig.
Eine dieser Handlungen war die Sache mit dem weißen Kopftuch der Johanna Wolters gewesen. Dabei interessierte ihn das Weibliche nur so weit, als es einer männlichen Rippe entstammte. Auch sein Interesse für die junge Witwe Wolters war – vor der Sache mit dem Kopftuch – kaum in den Attributen ihrer Weiblichkeit begründet gewesen. Die Sterne hatten ihm einen Wink gegeben und ihm dazu noch einen versoffenen schwarzbärtigen russischen Schwätzer an den Kneipentisch gesetzt, der von Kindertausch und gleichen Geburtsdaten und Schicksalen am Zarenhof erzählte.
Erst Jahre später sollte Stepan begreifen, um wen es sich bei dem Bärtigen gehandelt hatte: Schwarzbart war ein Kinderhändler, er gehörte zu einer berühmten Kinderhändlerfamilie, die wiederum Mitglied der Kinderhändlervereinigung war. Ein Beruf voller Regeln, Traditionen, Verbindungen und geheimer Kenntnisse, die für diesen rechtlich ungeschützten Stand wertvoller waren als jedes materielle Erbe. Die Kinderhändler unterhielten ein ausgeklügeltes Nachrichtensystem, sie wussten genau, wo ein Kind überflüssig und unerwünscht oder wo eines aus Erbschafts- oder dynastischen Gründen absolut notwendig war. Sie boten ihre Hilfe an, setzten Preise fest, schlössen Verträge. Und sie waren absolut ehrlich. Außer für Familien arbeiteten sie für Schausteller und Zirkusunternehmer. Meist kauften sie die Kinder aus dem städtischen Untergrund – Moskau war der beste Platz dafür –, behielten sie ein paar Jahre und richteten sie her, entsprechend den Wünschen ihrer Kunden: als gelenkige Krüppel, Fratzen, Clowns oder sonstwie monströse Schreckgestalten. Sehr beliebt waren Zwerge. Die Kunden benutzten sie zur Dekoration ihrer Haushalte, sozusagen als Prestigeobjekte, und die Händler hatten wenig Arbeit mit ihnen; sie kamen ja schon als Missgeburten zur Welt.
Ohne eine Ahnung von der Kinderhändlerei zu haben, war Stepan den von Schwarzbart gelegten Spuren willig zu Johanna gefolgt und hatte die junge Frau von ferne beobachtet. Bei ihren täglichen Verrichtungen, ihren Wegen in den Wald, wo sie manchmal, statt Beeren und Blätter und Borken zu sammeln, auf den höchsten Gipfel einer Blutbuche stieg, offenbar nur, um die Welt von oben zu betrachten. Korrekt hatte er alle Details notiert, die Form ihres Kopfes, ihr Profil, den Haaransatz, das Verhältnis zwischen Nase und Mund, ihren langen Hals und den schmalen, aber kräftigen Rücken.
Wenn das Gerede des russischen Kneipengenossen tatsächlich stimmen sollte, dann musste es dafür auch äußerliche Anhaltspunkte geben.
Und dann war dummerweise die Sache mit dem Kopftuch passiert, ein unbedachter Moment, eine spontane Geste, eine Berührung ihrer Hand – und schon war es um seine Sachlichkeit geschehen. Er hatte sich tief verbeugt, nicht gewagt, sie noch einmal anzusehen, und war fortgelaufen, als wäre der Teufel hinter ihm her.
Neben Johanna gab es auch eine amtlich bestellte Hebamme in Neuruppin, die von der Stadt ein festes Jahressalär von fünfzehn Talern bezog und darüber hinaus von der Familie der Gebärenden einen Extralohn erwartete, sei es in Naturalien oder in klingender Münze. Sie beschränkte sich allein auf die Geburtshilfe, worin sie nicht ungeschickt war. Für alle anderen gesundheitlichen Probleme verwies sie die Kranken an den Amtsarzt.
Johanna hingegen war für alle Leidenden da, und sie verlangte kein Entgelt für ihre Dienste. So konnte man sie wenigstens nicht der unlauteren Erwerbstätigkeit bezichtigen, und die Frauen, die den Mut aufbrachten, sich ihr anzuvertrauen, mussten ihre Ehemänner oder Väter nicht um Geld angehen. Allerdings entgingen dadurch der Amtshebamme etliche Einkünfte, und die Gerüchte, Johannas Unterhalt komme direkt vom Teufel – sie lebte ja keineswegs in Armut –, wurden immer lauter.
Wer heilen kann, der kann auch schaden!
Johannas verstorbener Ehemann, der Lehrer Theodor Wolters, hatte ihr gewiss kein Vermögen hinterlassen. Er war fast vierzig Jahre älter gewesen als sie und hatte von den sieben Jahren, die er mit ihr verheiratet gewesen war, mindestens drei im Krankenstuhl verbracht.
Johanna erinnerte sich nicht ungern an diesen geduldigen, klugen Mann, von dem sie viel gelernt hatte. Die Idee für die ungewöhnliche Verbindung war ihrem Vater gekommen, dem sie immer geklagt hatte, sie sei so wenig gescheit und gebildet, und letztendlich nicht welterfahrener als das ärmste Häuslerkind.
Der kinderlose Witwer Theodor Wolters hatte zurückgezogen gelebt, ein hochgelehrter, freundlicher, etwas hinfälliger Eremit, dessen Ruf in der Stadt nie von einem Schatten getrübt worden war.
Johanna hingegen galt schon in diesen frühen Jahren, sie war noch nicht einmal achtzehn, als hochmütig. Nicht nur, dass sie nicht das geringste Interesse für die traditionellen Frauentätigkeiten zeigte, sie hatte auch bereits zwei durchaus akzeptable Bewerber abgelehnt, einen Hufschmied und einen Bauernsohn.
»In der Beschränktheit dieser Bewerber liegt doch höchstens Platz für sie selber!«, hatte sie hochmütig gesagt, »mit mir gemeinsam würde es da wirklich zu eng werden.«
Johannas Mutter, die fröhliche Rieke, hatte sich darüber halb totgelacht. »Wenn du erst einmal mit deinem Ehemann unter der Bettdecke liegst, dann kann’s gar nicht eng genug werden.«
Der besorgte Vater Max Johann Meller jedoch hatte keineswegs mitgelacht, sondern war zu dem alten Lehrer gegangen und hatte ihm unumwunden Johanna zur Heirat angeboten. »Sie ist gesund und kräftig und recht geschickt, wenngleich sie manchmal ihren eigenen Kopf hat.«
»Was heißt das, ihren eigenen Kopf?«, hatte der überraschte Lehrer gefragt.
»Manche bezeichnen sie als hochmütig, aber das ist sie nicht. Sie hält ihren Kopf nur für ein zu kostbares Gefäß, als dass sie ihn mit Kleiderflicken und Kartoffelhacken und Schwarzsauerkochen füllen dürfte.«
»Und welche Füllung sieht sie stattdessen vor?«
»Wissen jeder Art, die Erfindungen der Menschen, die Geheimnisse der Natur, die medizinische Wissenschaft.«
»So, so … nun ja …, die Beschäftigung mit der Wissenschaft hat ihre großen Reize, aber für eine Frau sollte doch wohl eher das Praktische Vorrang haben. Wie sonst könnte sie denn ihren Mann und sich selbst versorgen?«
»Meine Johanna versorgt nicht, sie wird versorgt. Wenn man das erst einmal begriffen hat, dann kann man gut mit ihr auskommen. Das Praktische erledigt die alte Babuschka für sie, ihr Name ist Olga, und sie ist uns von Russland her bis ins Ruppiner Land nachgelaufen, man wird sie einfach nicht los. Sie sagt, dass der Herrgott sie dazu ausersehen hat, ihrem Täubchen zu dienen, unserer Tochter nämlich, die übrigens von der Kinderfrau nie mit Namen angeredet wird, immer nur mit Koseworten. ›Das Kind hat keinen Namen‹, sagt sie, ›es ist nie getauft worden.‹ Natürlich stimmt das nicht, wir haben unser Kindchen sogleich zur Kirche gebracht, kaum dass wir Russland verlassen hatten. Zu einer lutherischen Kirche, in Lettland, versteht sich.«
»Du weißt, dass ich deiner Tochter lesen und schreiben beigebracht habe, sechs Jahre lang. Eine aufmerksame Schülerin, sie stellte Fragen.«
»Gott sei’s geklagt, das tut sie den ganzen Tag lang. Und so sehr ich sie auch liebe, ich halte es einfach nicht mehr aus, weil ich doch nie die rechte Antwort weiß.«
Der Lehrer hatte nachgedacht. »Du kennst mein Alter«, hatte er gesagt, »und man hat dir auch sicher berichtet, dass mich gelegentliche Anfälle plagen, Epilepsie nennt man das. Darum bin ich aus den schulischen Pflichten entlassen worden. Das Haus hier hat man mir nur auf Lebenszeit gegeben, und meine Pension ist gering. Warum sollte mir eine junge Frau in meiner Armut Gesellschaft leisten wollen?«
»Weil du so viele Bücher besitzt. Und weil du freundlich und gut bist, das hat sie gesagt. Und auch, dass sie keinen anderen nehmen würde, denn sie will weder eine Bäuerin noch eine Handwerkersfrau werden.«
»Was denn sonst will sie werden?«
»Weiß ich’s? Sie liegt auf dem Rücken und lässt sich von den Wolken ihre Zukunft erzählen. Sie flüstert unserer alten Kuh russische Hexensprüche ins Ohr, bis die doppelt so viel Milch gibt wie zuvor. Sie zaubert und verzaubert, sie deutet, sagt wahr, sie heilt und verflucht, und sie kann allein durch die Kraft ihrer Gedanken ein Haus in Brand setzen.«
»Und das alles glaubst du, Max Johann Meller?«
»Natürlich nicht. Aber es genügt schon, wenn ein paar Leute in unserer Stadt das glauben. Ein besonderer Mensch ist auch besonders gefährdet. Ich mache mir Sorgen, Theodor, das Kind braucht etwas anderes, als ich ihm geben kann. Bei dir wäre Johanna sicher.«
Tatsächlich hatte das Gerede in der Stadt nach Johannas Heirat aufgehört. Und als sie übers Jahr dem alten Lehrer noch einen Sohn geschenkt hatte, da war sie fast zu einer normalen Ruppiner Bürgersfrau geworden. Fast, denn es hatte auch Stimmen gegeben, die raunten, der Knabe Alexander sei auf gar keinen Fall das Kind des alten Lehrers, eines Mannes, der in seiner fast zwanzig Jahre währenden ersten Ehe kein Kind zustande gebracht habe und außerdem auch noch unter der Fallsucht litte. Und war nicht zum genau passenden Zeitpunkt wieder einmal dieser Schwarzbart in Neuruppin aufgetaucht und von der verrückten Olga wie eine Trophäe ins Haus des Lehrers geschleppt worden? Allerdings nicht für lange. Schon nach kurzer Zeit hatte der offenbar sehr erzürnte Lehrer den Kerl persönlich wieder an die Luft gesetzt.
Eines jedoch hatten auch die Übelmeinenden zugeben müssen: Der alte Lehrer und sein junges Weib waren gut miteinander ausgekommen. Zum ersten Mal, seit man ihn kannte, hatte der Lehrer jedermann auf der Straße leutselig begrüßt. Und wenn er auf der Bank vor seinem Haus in der Sonne gesessen hatte, dann war Johanna nie von seiner Seite gewichen, sie hatte ihm stundenlang zugehört und dabei seine Hand gehalten.
Und dann hatte er einen besonders schlimmen Anfall, und Johanna hatte voll wütiger Verzweiflung versucht, ihn ins Leben zurückzuholen – umsonst.
Man hatte ihr dann sogleich das Haus weggenommen und natürlich auch die Lehrerpension, also war sie gezwungen gewesen, ins Haus der Eltern zurückzukehren, mitsamt der Kinderfrau und ihrem kleinen Sohn. Und kurz darauf war dann auch der Schwarzbart wieder erschienen und hatte an die Tür von Max Johann Mellers Haus geklopft. Er war einen ganzen Tag lang geblieben.
Anschließend hatte das Mellerhaus ein neues Dach bekommen, aus hellerem, feinerem Stroh, als man es je zuvor gesehen hatte.
Anschließend hatte Hoppenraths Tochter auf diesem teuren neuen Dach einen kleinen Teufel herumspringen sehen, immer um den Schornstein herum, aus dem nicht nur blauschwarzer Rauch, sondern sogar gezackte Flammen gestoben waren.
Anschließend wurden kurz hintereinander Max Johann Meller und seine Frau Rieke von einer unbekannten Krankheit dahingerafft – gut für die Tochter, denn die hatte von nun an das Alleinrecht über das Mellerhaus und erbte wohl auch ein kleines Vermögen.
So wurde Johanna von neuem zur Hexe gemacht, und sie hatte sich gefügt, hatte wieder Kräuter und Käfer und Spinnennetze gesammelt und die jungen Frauen in Neuruppin mitfühlend auf ihre Schwangerschaften angesprochen, bevor diese noch selbst davon wussten.
Spät in der Nacht lief Johanna mit schnellen, leichten Schritten durch die Stadt. Sie mied den großen Steinweg, nutzte die Dunkelheit an den Wallmauern und bog von hinten in die Schulzenstraße ein. »War doch schön, wenn mir die Pflicht diesmal etwas mehr Vergnügen bereiten würde«, murmelte sie. Statt des üblichen weißen Kopftuches trug sie heute die schwarze Witwenhaube, nicht, weil sie sich in der Nacht mehr als tagsüber dem Witwenstand zugehörig fühlte, sondern weil das weiße Tuch das Mondlicht angezogen hätte.
Vor dem Arzthaus in der Schulzenstraße Nummer sieben blieb sie stehen. Wie immer in den Nächten vom Freitag auf Sonnabend, wenn der Kreismedicus Dr. Heinrich Ansbach seinen Wochenbericht niederschrieb, brannte in einem der rückwärtigen Fenster im Erdgeschoss noch Licht. Als Johanna leise an eines der Fenster klopfte, wurde ihr gleich die Hoftür geöffnet.
»So geht das nicht mehr«, murmelte der Mann, als er vor ihr her durch den kurzen dunklen Flur ins Zimmer ging, »so können wir’s nicht weiter treiben, du ruinierst meinen Ruf.«
Johanna ließ sich auf einen Hocker fallen, zog die schwarze Haube vom Kopf, schüttelte die Locken und fragte lächelnd: »Und was ist mit meinem Ruf?«
Der Mann, obgleich um den Eindruck schlechter Laune bemüht, konnte ein Antwortlächeln nicht unterdrücken. »Da gibt’s nichts mehr zu ruinieren, weil du ja eine Hexe bist.«
»Und wenn ich grad mal keine Hexe bin, dann lebe ich als eine ehrbare Witwe.«
»Als solche würdest du wohl kaum mit unbedecktem Kopf im Zimmer eines Mannes sitzen!«
»Du bist doch Arzt, vor dir darf ich mich zeigen, wie ich bin. Und sowieso habe ich den Hexenruf vor allem dir zu verdanken. Kräuterfrauen gibt es ja manche, aber keine, die gleichzeitig ein Medicus ist.«
»Du bist kein richtiger Medicus, überheb dich nicht, wirst auch nie einer sein.«
»Alles, was ich an medizinischem Wissen besitze, das kommt von dir. Und falls ich immer noch weniger weiß als du, so liegt das nur an dir, nicht an mir.«
Es war heiß in dem Zimmer. Der Kreismedicus hielt seine Fenster geschlossen, um die Falter von der Lampe fernzuhalten, aber auch, um die nächtliche Zweisamkeit mit Johanna, nach der er sich auf die unziemlichste Weise sehnte, nicht stören zu lassen.
Johanna machte es sich bequem, öffnete die oberen Knöpfe ihres Kleides und rollte die Ärmel bis über die Ellenbogen hoch.
»Lass das, es könnte jemand hereinkommen.«
»Es ist noch nie jemand hereingekommen, also was ist, erzähl mir von deinen Patienten der letzten Woche. Was haben sie dir vorgeführt? Steifhals, Fallsucht, ein Hitzefieber? Oder vielleicht gar ein ausgerenkter Fuß?«
»Nichts, was du nicht spielend statt meiner hättest erledigen können, sogar besser, weil du ja geduldiger bist.«
»Und weil ich dazu noch die Kräuter kenne und immer ein schönes Sprüchlein zur Hand habe. Und nicht zuletzt, weil ich den Glauben an meine Heilkraft vermitteln kann, das ist wohl am wirksamsten.«
»Red nicht so sündig.«
»Besser sündig als scheinheilig.«
Johanna stand auf, trat hinter ihren Lehrmeister und schaute ihm über die Schulter auf die Eintragungen in seinem Arbeitsbuch.
»Ach da sieh her, die Schöppen-Luise krankt an der Galle. Ob es nicht vielleicht doch die Leber ist? Ich weiß, wie freudig sie dem Branntwein zuspricht. Bei ihrer letzten Geburt hat sie versucht, sich den Wehenschmerz mit vielen Gläschen wegzutrinken. Das arme Kind ist schon betrunken zur Welt gekommen.«
Der Medicus griff nach Johannas Hand, die sie auf seine Schulter gelegt hatte. »Was schert dich der Stadtklatsch. Du bist gekommen, weil du lernen willst. Grad heute hab ich ein neues Buch erhalten von dem großen Leibniz, ich würd es gern mit dir durchgehen.«
»Wozu, wo’s doch vermutlich wieder auf Französisch ist.«
»Das gibt mir die Möglichkeit, es für dich zu übersetzen.«
»Glaubst du denn wirklich, ich könnte es begreifen?«
»Du kannst alles begreifen und schneller als ich selber.«
Johanna beugte sich noch tiefer über seine Schulter und fuhr mit der freien Hand die geschriebenen Zeilen entlang. »Aber ich will hier nicht über die Gedanken des Herrn Professors von Leibniz unterrichtet werden, sondern über die Leiden und Zipperlein der Neuruppiner. Eine Hexe muss immer gut informiert sein.«
Wie aus Versehen berührte sie mit ihren Lippen seine Schläfe. Der Arzt schob sie von sich, sprang vom Stuhl hoch und floh auf die andere Seite des Schreibtisches.
»Ich muss dir etwas sagen, Johanna.«
Sie lachte spöttisch. »Willst du mir vielleicht einen Heiratsantrag machen?«
»Ich bin verheiratet, das weißt du genau.«
»Das weiß hier jeder. Und doch scheinst du immer auf der Suche zu sein.«
»Wozu noch suchen, wenn ich doch längst gefunden habe. Aber Sitte und Gesetz verbieten mir, mich meines Fundes zu erfreuen.«
»Bin ich dir denn allen Ernstes so unerfreulich? Ich bin frei, eine Witwe, nicht unvermögend. Und ich schleiche mich einmal in der Woche des Nachts zu dir.«
»Hör auf, Johanna, du sollst mich nicht mutwillig erregen.«
»Falls dich tatsächlich etwas erregt hat, dann kann das nur der Teufel gewesen sein. Johanna Wolters ist sittsam und lernbegierig, damit sie mit ihrem erworbenen Wissen anderen Menschen helfen kann. Also ruf deine Männlichkeit zur Ordnung.«
In aller Ruhe beschäftigte sie sich weiterhin mit seinem Arbeitsbuch. Schweigend sah der Medicus ihr zu. Von Zeit zu Zeit blickte sie auf und schickte ihm ein Lächeln.
»Gut«, sagte sie endlich und schloss das Buch. »Ich habe alles verstanden, auch deine lateinischen Wörter, hinter denen du dich so gerne versteckst. Also, was wolltest du mir sagen?«
»Ich weiß nicht mehr, kann mich partout nicht erinnern. War wohl nicht so wichtig.«
»Du lügst, Doktor. Ich seh es an deinen Ohren, dem steifen Hals, den verkrampften Schultern. Was raus will, muss raus. Soll ich dir ein wenig den Nacken reiben und die Brust und den Hals, damit dir die nötigen Worte in den Mund gelangen?«
»Wag es ja nicht, mich noch einmal zu berühren.«
»O weh, o weh«, seufzte Johanna, »das muss ja ein starker Teufel heute sein!«
Er räusperte sich wütend. »Wenn du dich weiterhin über mich lustig machst, werde ich dir die Tür weisen. Aber zuvor will ich noch wissen: Was war das heute Mittag mit dem Russen?«
»Ist es das, was an dir zerrt?«
»Die Leute reden nun mal, haben ja sonst nicht viel Ablenkung.«
»Und der gute Medicus hört ihnen zu. Mit welchem Gewäsch hat man dir denn dieses Mal die Zeit gestohlen?«
»Dass du ausfallend geworden seist gegen den russischen Herrscher, dass du ihn geschmäht und verflucht habest mit dem übelsten Teufelsgeschrei. Sogar dein Sohn sei dem Zaren in böser Absicht ins Genick gesprungen, man habe ihn nur schwer zurückreißen können. Und als danach die Männer dich zur Rechenschaft ziehen wollten, da sei ein fremder Wanderbursche dazwischengetreten, ein wilder Rotkopf, der habe dich an der Hand gepackt und sei mit dir davongelaufen.«
Johanna lachte. »Schöne Geschichte«, sagte sie. »Haben sie dir auch erzählt, wohin wir gelaufen sind?«
»Auf Hoppenraths Feld, zu der großen Heumiete, darin seid ihr dann verschwunden.«
»Und die Neuruppiner Sittenwächter haben sich rund um die Miete aufgestellt und haben uns ächzen und stöhnen und vor Lust schreien gehört? Und den zuschauenden Weibern ist dabei vor lauter Geilheit der Schoß feucht geworden, und die Männer haben sich schnaufend zwischen die Hosenbeine gefasst.«
»Hör auf, Johanna, lass die unziemlichen Reden.«
»Wenn hier etwas unziemlich ist, dann das Gerede der Leute mit ihrer schmutzigen Phantasie.«
»In jedem Gerede liegt ein Körnchen Wahrheit, das weißt du so gut wie ich.«
»Deine Wahrheit vielleicht, und die ist dann nicht sauberer als die der anderen.«
Johanna legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und versuchte sich in die mittägliche Situation zurückzudenken. Das Körnchen Wahrheit, gab es das tatsächlich?
Sie sah sich am Straßenrand stehen, der von dem russischen Zar aufgewirbelte Staub war noch nicht ganz abgezogen. Rings um sie wütende, schwitzende Männer. Die Sonne brannte auf ihren unbedeckten Kopf. Wo war ihr Tuch? In den Händen eines ernst blickenden Jünglings, der es ihr reichte und dabei kurz ihre Hand berührte. Ein heißer Strom fuhr durch Johannas Körper, jetzt erst in der Erinnerung.
»Warum bin ich nur manchmal so unachtsam«, murmelte sie.
»Unachtsam nennst du das?«
Johanna setzte sich aufrecht hin und sah den Medicus streng an. »Du bist ein Narr, Doktor, kaum besser als die Menschen, denen du so willig zugehört hast. Aber lassen wir das jetzt. Du wolltest mir doch etwas anderes sagen, etwas Reales, Ernstes. Ich hab’s in deinem Gesicht gelesen, als ich hereingekommen bin. Das Gewäsch der Leute war nur eine Ablenkung.«
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Doch, Heinrich Ansbach, das weißt du. Du hast etwas auf dem Herzen, und du könntest froh sein, dass ich dir überhaupt ein Herz zubillige, dieses Ding in deinem Leib, das dich traurig macht, weil es so einen starken Gegner hat in deiner Vernunft. Wenn ich dich heut so betrachte, dann möchte ich meinen, dein Herz hätte gerade einen großen Kampf verloren. Stimmt’s?«
Der Medicus griff in die Schreibtischschublade und brachte eine Branntweinflasche hervor. »Willst du auch?« Er hielt ihr die Flasche hin.
»Hast du schon vergessen, dass ich nur trinke, wenn’s mir fröhlich zumute ist?«
Er nahm einen tiefen Schluck, dann noch einen. Anstatt die Flasche wieder zurückzustellen, umklammerte er sie mit beiden Händen und sagte: »Man will mich zum Ratsherrn berufen, und übers Jahr könnt ich dann Bürgermeister werden.«
»Aha.«
»Das war mir sehr wichtig. Und auch fürs Einkommen gut. Und die Frau könnt dann endlich etwas hermachen aus sich, grad jetzt, wo sie die Hoffnung, doch noch Kinder zu gebären, endgültig aufgeben musste.«
»Na gut, soll sie etwas aus sich machen, ich habe nichts dagegen. Wo liegt der Haken?«
»Sie hat verlangt, dass ich dich nicht mehr kenne.«
»Was?«, Johanna fuhr hoch.
»Nicht nur das. Sie hat zwei andere Ratsherrn hinter sich, den Joachim Krämer und Friedrich von dem Eck, beides Verwandte von ihr. Du weißt, sie ist höherer Herkunft als ich, hat Beziehungen, ist auch eine geborene Neuruppinerin. Diese Verwandten nun haben mir bedeutet, dass sie nur für mich stimmen könnten, wenn mein Leben glasklar und durchsichtig sei und nicht den geringsten Schatten aufweise.«
»Und mit dem geringsten Schatten haben sie mich gemeint?«
»Die Frau hat’s ihnen gesteckt, und jetzt bestehen sie eben auf Durchsichtigkeit.«
Johanna setzte sich ihre Witwenhaube auf, stopfte die Haare darunter und band sich vorn eine feste Schleife.
»Armer Doktor«, sagte sie. »Und arme Doktorin. Sie hat mich oft gebraucht, wenn die Künste ihres Gatten nicht ausreichten – die aufsteigende Hitze, die schwarze Melancholie. Und angeblich hat sie nichts dagegen gehabt, dass du mich deine Wissenschaft lehrst.«
»Das ist vorüber. Denn jetzt will sie etwas aus sich machen, und mehr als nur Frau Doktor sein, eben Frau Bürgermeister. Und sie sagt auch, du hättest mich impotent gemacht.«
Johannas Lachen klang schadenfroh. »Was deine Mannesehre anbelangt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ab heute werd ich in ganz Neuruppin deine große Potenz preisen!«
»Johanna …!«
»Ja, Doktor?«
»Ich hab dich nie angerührt.«
»Tapfer, tapfer! Aber Impotenz habe ich auch nie an dir wahrgenommen. Eher das Gegenteil.«
»Verleumde mich nicht in der Stadt, ich flehe dich an.«
»Wie sehr du doch besorgt bist, dass sich dein Lebensbild eintrüben könnte!«
Kopfschüttelnd betrachtete sie den Medicus, und ihre Schadenfreude wandelte sich in Gutmütigkeit. »Aber mach dir keine Sorgen, ich weiß, was ich dir schuldig bin. Du hast mich dein Handwerk gelehrt und mir ein Tor zur Wissenschaft geöffnet. Geh also zurück zu deiner Frau, sag ihr, die Hexe habe dir deine Potenz zurückgegeben – sie kann sie nicht mehr brauchen.«
Johanna wusste schon seit ein paar Tagen, dass sie beobachtet wurde. Sie hatte die fremden Blicke als leichten Wind auf ihrer Haut gefühlt, nicht so aufdringlich wie die mit neugieriger Häme vergifteten Blicke einiger Neuruppiner Mitbürger, doch immer noch lästig genug. Manchmal hätte sie nichts dagegen gehabt, unsichtbar zu sein oder sich wie eine Araberin von Kopf bis Fuß zu verschleiern.
Am Tag nach dem Durchzug der russischen Reisegesellschaft fühlte sie sich seltsam matt und unsicher. Sie hätte diesen Zustand gerne auf das Ende ihrer Freundschaft mit dem Stadtmedicus geschoben, doch wusste sie, dass der eigentliche Grund in den fremden Windblicken lag, zu denen auch eine Gestalt gehörte, eine lange, dünne, rothaarige Mannesgestalt.
Johanna bewertete ihre Beziehung zu Männern vor allem nach deren Nützlichkeit – für einen, der sich ihrer mit Blicken zu bemächtigen versuchte, hatte sie keinen Bedarf.
Die Berührungen ihres Ehemannes Theodor Wolters waren für sie zwar nicht lustvoll gewesen, doch sie hatte sie mit heiterer Gelassenheit ertragen – sie wusste ja wofür. Gegebenenfalls wäre sie auch dem Heinrich Ansbach zu Willen gewesen, doch waren des Doktors Bedürfnisse nie über begehrliche Vorstellungen hinausgegangen. Ähnlich wie der alte Lehrer erfuhr wohl auch der Stadtmedicus die größte Bestätigung seiner Männlichkeit, wenn sie ihn bat, vor ihr mit seinem Wissen zu glänzen.
An diesem Tag hatte Johanna wenig zu tun. Olga erledigte die Hausarbeit, Schura war in der Schule, und die Beratung und Behandlung von Frieda Schoopmann, einer Tagelöhnersfrau aus dem nahen Schönberg, war erst nach Einbruch der Dunkelheit fällig. Also entledigte Johanna sich ihrer Schuhe, schürzte die Witwenröcke und verließ ihr Haus. Sie lief den Steinweg entlang, am Friedhof vorbei, durch das Berliner Tor, hinaus ins Freie.
Seht nur, da läuft die Hexe, müßig bereits am Vormittag, und dazu noch ohne Schuhe und Strümpfe!
Johanna freute sich des Lebens und spielte Verstecken mit sich selbst, sie schob sich durch dichtes Gebüsch, duckte sich im Graben und gelangte schließlich zu der großen Rotbuche, die sie in geübter Eile erkletterte.
Auf halber Höhe lehnte sie sich tief atmend gegen den Stamm. Hier war sie allein, kein fremder Blick konnte die Blätter durchdringen. Bis zur Taille öffnete sie ihr Mieder und fächelte sich Luft zu. Doch anstatt erholsame Ruhe zu finden, drängte sich Olga in ihre Phantasie.
»Auch wenn man sich versteckt, öffnet man am helllichten Tag nicht sein Mieder!«, quengelte die Babuschka.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Johanna, zog ihre Röcke hoch und streckte die nackten Beine in die Sonne. »Die verehrungswürdige Aurora von Königsmarck hätte das nie getan!«
»Hätte sie auch nicht. Sie weiß genau, was sich schickt. Die Fesseln bleiben stets bedeckt, es sei denn, man will etwas damit erreichen.«
»Und die bewundernswerte Aurora hat viel damit erreicht!«
»Allerdings. Und was ist mit dir? Geht es dir etwa darum, der Welt die Druckstellen an deinen Fußknöcheln zu zeigen, die von deiner verqueren Geburt herrühren? Und dazu noch das zarte geschwungene R, das ich dir auf Wunsch deiner Mutter in den rechten Fuß habe brennen müssen? Falsch herum hast du im Mutterleib gelegen, und wenn ich dich nicht mit aller Kraft an den Füßen gepackt und ins Leben gezogen hätte, dann wärst du schon tot gewesen, bevor dir das erste Licht auf den Kopf geschienen hätte.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Johanna wieder. »Aber jetzt würde ich gerne an etwas anderes denken. Sieh doch, wie hübsch die Blätter das Licht filtern und wie grün es auf meiner Haut liegt.«
Olga jedoch war nicht mehr aufzuhalten. »R wie Romanow«, sagte sie energisch, »nicht M wie Meller!«
»Und auch nicht K wie Königsmarck«, spottete Johanna. »Ein Muttermal haben manche Menschen. Und dass ich ein Wunschkind war, das weiß ich. Meine Mutter Rieke hat mir’s immer wieder gesagt und bewiesen. Ohne sie könnte ich nicht so gut lachen, und sie hat mir auch das Tanzen beigebracht. Also lass die alten Geschichten endlich ruhn und gestatte mir ein paar neue.«
»Pah, gestatten! Das hast du ja schon selbst erledigt. Geändert aber hat sich dadurch nichts. Die Wahrheit muss endlich ans Licht, sonst wird sie sterben!«
»Sie ist doch längst tot, sie stinkt und verfällt. Und ich will nicht, dass du immer wieder versuchst, meinen Sohn zu einem Teil deiner Wahrheit zu machen.«
»Die Wahrheit ist des Menschen allerhöchstes Gut«, greinte Olga.
»Bei den zehn Geboten steht das Wahrheitsgebot aber bekanntlich erst an achter Stelle!«, sagte Johanna.
»Aber in der Erbfolge stehst du an erster Stelle!«, triumphierte Olga.
Johanna wurde ärgerlich. »Ich wüsste wirklich nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat!«
»Alles, mein Täubchen, alles hat damit zu tun.«
»Schluss, aus, ich will nun wirklich nichts mehr hören«, rief Johanna. »Verdirb mir nicht den schönen Tag.«
Mit Händen und Füßen versuchte sie sich gegen die Hirngespinste zu wehren. »Mein Leben«, rief sie dabei, »meins, meins, meins! Und ich erlaube dir keinen Zugriff darauf.«
Plötzlich, mitten hinein in ihr sinnloses Gezappel, tönte eine Stimme von unten herauf: »He, hallo, was geschieht denn da oben, warum schreist du, brauchst du Hilfe?«
Johanna erstarrte. Der Fremde! Er war ihr nachgegangen und hatte alles mit angehört. Jetzt blieb ihr nichts anderes übrig, als die Sache auszusitzen und sich tot zu stellen. Dann würde der Fremde sein Interesse verlieren und weitergehen.
Stattdessen erschallte die bedrohliche Ankündigung: »Ich komme jetzt rauf!«
Nun saß Johanna wirklich in der Falle. Der Mann hatte zwar auf den ersten Blick nicht den Eindruck großer Gelenkigkeit gemacht, aber mit Entschlossenheit und Geduld gelangt die Schnecke nach Jerusalem. Das hatte Johannas Vater immer gesagt, der bedächtige Max Johann Meller.
Sie wartete. Ächzend und stöhnend, wie ein alter Mann, mühte sich der Fremde aufwärts und fluchte dabei vor sich hin, halb russisch, halb deutsch, und zwischendrin richtete er immer wieder ein paar gekeuchte Worte an sie: »Du verlangst ziemlich viel von mir. Aber glaub bloß nicht, dass es sich hier nur um dich dreht. Für dich allein würd ich mich hier nämlich nicht in Lebensgefahr bringen.«
Johanna enthielt sich jeder Reaktion. Sie saß nur und wartete und redete sich selbst gut zu – diesmal wirklich nur in Gedanken und absolut stumm. Ich bin kein junges Mädchen mehr, ich bin eine gestandene Witwe, ich bin eine Hexe, ich bin fast eine Doktorin. Wenn er sich die Schulter ausrenkt oder den Kopf aufschlägt, könnte ich mich professionell um ihn kümmern, könnte ihm Spinnweben auf die offene Wunde legen und seine nackte Schulter mit frischem Quellwasser kühlen. O himmlischer Vater, erbarme dich meiner, lass den Fremden abstürzen. Das wäre doch die beste Lösung.
Und siehe da, es splitterte und knarrte und krachte ganz nah unter Johannas Ast, der Fremde schrie in Todesangst und wäre gewiss in die Tiefe gestürzt, hätte Johanna ihn nicht in letzter Sekunde gepackt und festgehalten. Mit Tränen der Wut über ihre eigene Unzuverlässigkeit zog sie ihn zu sich auf den Ast.
»Vater im Himmel«, stöhnte sie dabei, »warum verweigerst du mir meine ehrbare Witwenschaft!«
Doch als Stepan endlich neben ihr saß, immer noch sicher von ihr gehalten, und als sie dann erneut diesen heißen Strom fühlte, der von ihm auf ihren ganzen Körper überging, da senkte sie schließlich voller Ergriffenheit den Kopf. »Herr, dein Wille geschehe.«
Stepan empfand Scheu vor Johanna, die umso größer wurde, je näher er ihr kam. Und wenn er dann endlich in ihren Armen lag, in der Heumiete auf Hoppenraths Feld, dann zitterte er nicht nur vor Begehren, sondern mehr noch vor seinem eigenen Mut. Er, ein einfacher Wandersmann aus Woronesh am Woronesh, hatte die Tochter des Zaren verführt! Das war ein Verbrechen gegen die gottgewollte Ordnung, dem die Todesstrafe drohte, falls man es je entdeckte – und dafür würde schon die verrückte Babuschka sorgen.
Johanna jedoch lachte nur über seine Ängste. »Zuerst einmal hast nicht du mich, sondern ich habe dich verführt. Zweitens bin ich keine Zarentochter, sondern das sehr geliebte Kind des Schmiedes Max Johann Meller und seiner Frau Rieke. Drittens gilt hier preußisches und nicht russisches Recht. Und viertens bist du schließlich nicht der erste Mann, der sich meines Körpers erfreuen darf.«
Sobald von diesem anderen Mann die Rede war, sah Stepan rot. »Ein Wüstling, einer, der dir aufgezwungen worden ist, auch er verdient den Tod, noch weit mehr als ich.«
»Er ist doch schon tot«, beruhigte Johanna ihren Liebsten. »Und wenn er bei mir lag, habe ich seinen Körper nie gespürt.«
Ungefragt und eigentlich auch uneingeweiht gab die Babuschka dann dazu ihren Kommentar ab. »Sie hat zwar ein Kind geboren, aber ihre Seele ist jungfräulich geblieben. Sie wartet auf ihren Prinzen. Und der bist nicht du, und darum verbietet dir deine Ehre und Gottesfurcht, dich meines Täubchens in der typischen Mannesabsicht zu nähern. Geh fort von hier, Stepan Simonowitsch, die Wanderschaft ist zum Wandern da. Verzieh dich und kühle deine Hitze in anderen Quellen.«
Stepan jedoch blieb, und während der folgenden Monate hatte er auch keine Schwierigkeiten, bei den Neuruppinern sein Brot zu verdienen. Das Nachtlager bereitete er sich meist in einer geschützten Mulde am Alten Rhin, von dort aus konnte er den Himmel gut beobachten. Doch wenn er auf Johanna wartete, sehnsüchtig, ungeduldig und manchmal auch rasend vor Eifersucht, verweigerten sich die Sterne spielerisch seinem Zugriff, sie wichen vor ihm zurück, verschleierten sich, und ihr Licht schwankte hin und her, als wollte es sich über ihn lustig machen. Kaum aber war Johanna bei ihm und bedeckte lachend sein Gesicht mit ihren dichten Haaren, dann fühlte er sich geblendet von einem ganz anderen Licht, und er vergaß, dass ihm irgendein Sternefunkeln je wichtig gewesen war.
Im Mellerhaus konnten sich die Liebenden auch nachts, wenn Schura schlief, nicht treffen. Die Babuschka hatte unmissverständlich klargemacht, dass sie die ganze Stadt zusammenschreien würde, wenn sie diesen rothaarigen Swoboda-Teufel je in Johannas Bett antreffen würde.
Johanna war gegen die Zornausbrüche der resoluten Russin machtlos. Es half auch nicht, dass sie versuchte, die Alte mit Aurora-Geschichten abzulenken: »Deiner geliebten Königsmarckin verzeihst du jede Liebesgeschichte, warum nicht auch mir?«
»Weil meine Aurora es nur mit hohen Herren treibt, stets höher geboren als sie selbst. Du aber schläfst dich abwärts!«
Aurora Gräfin Königsmarck war der andere feste Bestandteil in Olgas Leben und die nie versiegende Quelle von ihren Geschichten. Und Aurora – zehn Jahre älter als Johanna – hatte es für ein Jahr zur maîtresse en titre bei dem sächsischen Kurfürsten August und dabei zur Mutter von dessen Sohn Moritz gebracht – immerhin! Während sich Johanna, der von Rechts wegen die russische Zarenkrone gebührte, zuerst mit einem brandenburgischen Dorfschullehrer eingelassen hatte und dann mit diesem halbrussischen Scharlatan.
Im Ort galt Olga als nicht ganz bei Verstand, eine geschwätzige Närrin, die man nicht ernst nehmen musste. Stepan jedoch wusste es besser.
»Du kennst doch die Worte, die unsere Zariza Natalja auf dem Sterbebett zu Zar Peter gesagt hat?«, flüsterte Olga verschwörerisch.
»Nein, kenne ich nicht«, entgegnete Stepan, »will ich auch nicht kennen.«
»Solltest du aber, damit du die Schwere deines Unrechts einsiehst. Denn vor der Vergebung muss die Einsicht und die Reue kommen. Also: Natalja hat zu ihrem angeblichen Sohn Peter gesagt: ›Du bist nicht mein Sohn, du bist mir untergeschoben worden.‹ Und das ist Wort für Wort die überlieferte Wahrheit, dafür verbürgt sich die Kammerfrau Lisaweta Alexejewna, meine alte Freundin, die nach unserer Flucht meinen Platz bei der Zariza eingenommen hat.«
»Im Tod reden manche Menschen Unsinn. Und woher willst du überhaupt von dem Gerede Kenntnis haben, du warst doch zur Zeit ihres Todes schon längst nicht mehr in Moskau!«
»Schlechte Nachricht reist schnell, und gute gab’s sowieso nicht. Am schlimmsten hat die Zariza unter Johannas Heirat gelitten – die Zarentochter verkuppelt mit einem alten, fallsüchtigen Kleinstadtlehrer! Die Zariza konnte den Gedanken kaum ertragen, er hat sie krank gemacht. Die Nachrichten gingen hin und her, und auch mit Geld hat sie uns gut versorgt, ein-, zweimal im Jahr. Wir sollten doch nicht im Elend leben. Sie hat mir vertraut, meine Natascha. Und als man ihr Baby damals umbringen wollte, hat sie es mir unter den Rock geschoben. Zehn Stunden lang musste ich stocksteif in einer Ecke ausharren, während die Teufel die Zimmer durchsucht haben. Das Täubchen unter meinem Rock hat wohl geahnt, dass man ihm an den Kragen wollte, keinen einzigen Mucks hat es getan. Dann waren die Bösen endlich fort, und ich bin mitsamt dem Täubchen weggelaufen, durch viele verschlungene Gänge, und als ich endlich die Kremlmauer hinter mir hatte, da stellte sich mir plötzlich ein Mann in den Weg, ein kräftiger, großer Kerl mit einem pechschwarzen Bart.
›Was trägst du da in dem Bündel, Olga Michailowna?‹, fragte er. Und ich, zu Tode erschrocken: ›So heiß ich nicht, und dies hier ist mein Reiseproviant, ich bin unterwegs zu meinem Vetter Paulo Karlowitz, in der Sloboda. Lasst mich durch, Herr, haltet mich nicht auf.‹ Aber er hat schon das Tuch von meinem Wickelkind gezerrt und mit flinken Fingern die unteren Bänder gelöst, sodass die kleinen Füße zum Vorschein kamen. ›Aha!‹, hat er gesagt und die Wickelbänder sorgsam wieder um die Füße gelegt. Und dann hat er einen Pfiff ausgestoßen, und sogleich kam von hinter dem Torpfeiler eine junge Frau gerannt, der stand das Mieder schon offen, und sie riss mir das Kind aus dem Arm und legte es sich an die Brust. Und mein Täubchen, hungrig wie es war, schnappte sofort gierig zu und begann zu trinken. Hilflos stand ich daneben und musste zusehen, wie die junge Frau mein Täubchen an sich drückte und ihm Koseworte zuflüsterte. ›Nun geh endlich, Babuschka‹, fuhr mich der Schwarzbart an. ›Siehst du denn nicht, dass du hier überflüssig bist? Du hast dies Kind gestohlen, weil du es teuer verkaufen wolltest. Aber dafür gibt’s bestallte Kinderhändler, mit denen solltest du dich nicht anlegen, das sind gefährliche Burschen.‹ In dem Moment kam dann auch noch ein zweiter Mann dazu, ein Riese von einem Kerl, der umfasste mit beiden Händen die Taille der Frau und hob sie mitsamt dem Kind auf einen Wagen. Auch der Schwarzbart saß auf, und sie fuhren davon. Ohne sich noch einmal umzusehen.«
Wenn Olga mit der Geschichte so weit gekommen war, rannen ihr jedes Mal die Tränen über das Gesicht, und Johanna reagierte regelmäßig mit gelangweiltem Spott: »Das Kindlein jedoch wurde gerettet, hatte die liebevollsten Eltern der ganzen Welt und dazu noch eine Kinderfrau, die die beste Märchenerfinderin der ganzen Welt ist!«
»Aber der Prinz«, schrie Olga dann, »dem Prinzesschen gebührt ein echter Prinz als Ehemann!«
Wenn es Johanna gut ging und sie heiterer Laune war, dann antwortete sie darauf: »Sie hat ihn doch schon gefunden!« Wenn sie bedrückt war, weil Stepan sich oft so seltsam verhielt und eine kränkende Distanz zu ihr wahrte, dann sagte sie: »Gib endlich auf, Olga Michailowna, mit deinen Geschichten vergiftest du mein Leben.«
Olga Michailowna Ronkina war in den vierziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts als Tochter eines fahrenden russischen Schaustellers und seiner deutschen Frau geboren worden. In jungen Jahren ist sie sogar recht anmutig gewesen, sie hatte Tanzen und den einfachen Salto gelernt und war dann einem Löwenbändiger in die Hände gefallen, der, nachdem er sie umstandslos entjungfert, sogleich das Weite gesucht hatte. Den Mann vermisste sie nicht, Enttäuschung überfiel sie erst, als sie begreifen musste, dass sie wider Erwarten nicht schwanger geworden war. Sie liebte Kinder über alles. Da sie sich jedoch durch diese erste Erfahrung absolut nicht zu einem weiteren Versuch ermutigt fühlte, beschloss sie, sich von nun an um anderer Leute Kinder zu kümmern.
Zu dieser Zeit, 1662, gastierte die Schaustellertruppe in der Nähe von Hamburg, in der Stadt Stade, die damals unter schwedischer Herrschaft stand. Hier, in Schloss Agathenburg, hatte die Gräfin Maria Christina von Königsmarck gerade ihr drittes Kind geboren, ein Mädchen. Und es gelang Olga, in dem Haushalt eine Stellung zu erlangen, anfangs nur als Küchenhilfe. Doch mit ihrer angeborenen Zähigkeit und wohl auch mit ein paar Tanzschritten und vor allem mit dem einfachen Salto, der den Königsmarck’schen Nachwuchs begeisterte, schaffte sie bald den Aufstieg in die Kinderstube. Sieben Jahre lang blieb sie bei den Königsmarcks und vor allem bei dem Komtesschen Aurora, das sie liebte und aufzog wie ihr eigenes Kind.
Dem kleinen Mädchen hat das sicher nicht geschadet, die gräfliche Mutter jedoch wollte Olga irgendwann wieder loswerden, sie wusste nur nicht wie. Bis ihr eines Tages das Schicksal beisprang und ein fürstliches russisches Ehepaar, entfernte Verwandte des Grafen Königsmarck, auf einer Deutschlandreise ein paar Nächte im Schloss Agathenburg verbrachte. Zu der Reisegesellschaft gehörten auch sechs berittene Soldaten, angeführt von einem Tataren, den sie Korporal nannten. Dass Olga, die Männerverächterin, sich Hals über Kopf in diesen Korporal verliebte, ging, ihren späteren Berichten nach, keineswegs mit rechten Dingen zu. Sie erlebte das erste Mal den betäubenden Geruch russischer Lederwichse, die der Tatar im Übermaß benutzte – salzig-süß mit einem Schuss Zitronenmelisse und Holunder – und verfiel dem Geruch mindestens so sehr wie dem Mann selbst. Wäre sie noch im Vollbesitz ihrer Geisteskräfte gewesen, wäre sie auf jeden Fall bei ihrem geliebten Kind geblieben, anstatt sich – übrigens reich beschenkt von der erleichterten Gräfin – auf den Gepäckwagen zu schwingen und ihrem salzig-süß duftenden Reiterkorporal zu folgen.
Über Olgas ferneres Leben mit dem Korporal und ihren Aufstieg von dem fürstlichen Gepäckwagen in den Kreml und dort in die privaten Gemächer der Zariza Natalja war wenig Belegbares zu erfahren, stattdessen gab es eine Unzahl bunter Geschichten, gespickt mit Zauberei, Intrigen, Verwünschungen und immer wieder mit der Erinnerung an diesen besonderen Geruch. Noch Jahre später hat sie den empfindsamen Geist der heranwachsenden Johanna damit füttern können.
Jetzt war Olga alt, und der wild verzweigte Strom aus ihren Legenden war zu zwei parallel fließenden Rinnsalen geschrumpft, das eine hieß Aurora, das andere Johanna.
Stepan wäre gern noch eine Weile in der Stadt Neuruppin geblieben, obwohl ihn seine Leidenschaft, um deren Vergehen er den Herrgott täglich bat, immer mehr irritierte. Doch fand er, nach anfänglichem Entgegenkommen der Einwohner, bald keine Arbeit mehr. Nicht einmal ein Zimmer konnte er mieten. Kaum klopfte er an eine Tür, schon erstarb jedes Gerede im Haus und von innen wurde der Riegel vorgeschoben.
Dann kam der Herbst mit frühen Stürmen und Regengüssen, die Wolken hingen tief, und weder bei Tag noch bei Nacht konnte er den Himmel sehen. Stepan aber brauchte den Blick auf die Sterne, um in seiner astrologischen Forschung wenigstens eine kleine Rechtfertigung zu finden für das, was ihm hier geschah.
Johanna hingegen hatte keine Rechtfertigung und auch keine Erklärung nötig. »Das ist die Liebe, Stepan. Und das sind zwei Körper, die füreinander geschaffen sind. So etwas gibt es nicht sehr oft, und es macht viele Menschen neidisch.«
Was sie Stepan dabei verschwieg, war jedoch der eigentliche Grund für die verschlossenen Türen in der Stadt: Der neue Ratsherr und Stadtmedicus Heinrich Ansbach hatte die Stimmung aufgeheizt, da reichte schon eine gelegentliche sorgenvolle Bemerkung: Brauchen wir etwa die Fremden in unserer Stadt, sind wir uns denn nicht selbst genug? Oder: Wer Gräben reinigt, kann auch Gräben vergiften! Oder: Eine einzelne städtische Hexe ist grad noch zu ertragen, jedoch eine Hexe gepaart mit dem Teufel wird unerträglich!
Und der Teufel ist der, der mit seinem satanischen Rohr in den Palästen des Himmels herumspioniert. So einer kann auch durch Türen und Wände sehen. Habt ihr denn nicht bemerkt, dass eure Familiengeheimnisse inzwischen in der Öffentlichkeit breitgetreten werden?
In einer Nacht vom Freitag auf Sonnabend lief Johanna darum noch einmal zum Haus des Stadtmedicus. Das sonst so einladende Arbeitslicht in dem rückwärtigen Fenster im Erdgeschoss brannte nicht, und auch auf Johannas leises Klopfen kam keine Antwort. Die Haustür war verriegelt.
Also begab sie sich am nächsten Morgen, zur Ordinationszeit, erneut in die Schulzenstraße und ging energischen Schrittes vorbei an der erstaunt aufblickenden Jungfer Frieda, die dem Arzt als Bürohilfe diente, den schmalen Flur entlang und direkt in das Ordinationszimmer. Der Stadtmedicus war gerade dabei, der alten Mutter des Küsters Leinemann den entzündeten Arm zu versorgen. Bei Johannas Anblick zuckte er zusammen und fuhr sie an: »Eintritt nur für Kranke. Die Jungfer Frieda kümmert sich um die Anmeldung.«
Johanna lächelte zufrieden. Die alte Leinemann war bekannt als Neuruppins größtes Klatschmaul.
»Aber, aber, Doktor, ich bin krank. Allerdings krank vor Ärger. Und seit wann brauche ausgerechnet ich eine Anmeldung? Das war doch sonst nicht so.«
»Sie stören mich bei der Arbeit, Witwe Wolters. Darum muss ich Sie bitten, sofort meinen Behandlungsraum zu verlassen.«
»Heinrich! Denk doch mal zurück an die vergangene Nacht, wie sehr du dich da meiner Gegenwart erfreut hast. Und all die Nächte zuvor.«
Sie kam ganz nahe heran, strich ihm mit der Hand über die Wange und betrachtete dann interessiert die schwärende Wunde am Arm der Frau.
»Das sieht aber gar nicht gut aus, Frau Leinemann«, sagte sie, »ich vermute, es nässt und eitert schon seit Tagen?«
»Eijeijei! Macht große Schmerzen, will nicht heilen«, stöhnte die Alte. »Wird immer schlimmer. Dabei hab ich mich doch nur an einem alten Nagel gerissen, im Kuhstall.«
»Ich wüsst schon ein Mittel, das hilft garantiert. Kommen Sie doch später bei mir vorbei. Ich mach’s Ihnen umsonst. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, in der Stadt nichts herumzuerzählen. Unser Doktor will doch Bürgermeister werden, und da würde es sich nicht gut machen, wenn die Leute von meinen nächtlichen Besuchen erführen.«
Die Alte nickte grinsend und schien bereits ob der aufregenden Neuigkeit weniger Schmerzen zu haben. Augenzwinkernd sagte sie: »Schweigen werd ich wie ein Grab! Und ich komm dann am Abend bei dir vorbei. Dank auch für dein Vertrauen.«
Als Johanna ein paar Tage später auf den Markt ging, traf sie dort Margarete Ansbach, die Ehefrau des Medicus und jetzigen Stadtrats. Niemand außer Johanna hatte sie je ohne Haube oder Hut gesehen. Es hieß, sie sei darunter kahl wie eine Kartoffel, weil eine böse katholische Kinderfrau sie einst heimlich zur Nonne geschoren hätte und das Haar seitdem vor lauter Schreck nach innen statt nach außen gewachsen wäre. Johanna wusste es besser.
Mit einer überraschenden Freundschaftsgeste legte Margarete einen Arm um Johannas Schultern und sagte: »Wie schön, Sie zu treffen, Witwe Wolters, ich würde Sie so gerne wieder einmal zu einem Tässchen Schokolade in mein Haus bitten.«
Neugierig sahen die Leute zu den beiden Frauen hin, zu der blühenden jungen und der mausgrauen älteren. Johanna, deren Treffen mit Margarete stets nur unter strikter Geheimhaltung nach Einbruch der Dunkelheit stattgefunden hatten, begriff sogleich die Absicht hinter dem Tässchen Schokolade und war auf der Hut.
»Wenn die Frau Stadtrat am helllichten Tage Einverständnis zeigt mit der Stadthexe, dann muss es schlimm stehen um das Wohlbefinden im Hause Ansbach.«
»Wohlbefinden war da nie, das wissen Sie so gut wie ich«, antwortete Margarete leise. »Und seit zwei Tagen ist es dort noch viel unbehaglicher.«
Sie nahm Johanna am Arm und zog sie energisch zu der Bank vor der Apotheke. Kaum saßen sie, fing Johanna mit aufgesetzter Munterkeit zu reden an. »Und wie geht es Ihrer armen Kopfhaut, Frau Margarete, hat meine Medizin geholfen?«
»Ja, Gott sei Lob und Dank. Die kahlen runden Stellen sind weniger geworden, auf den meisten wachsen nun endlich neue Haare. Bald wird Heinrich Ansbach nicht mehr behaupten können, der Teufel habe mir auf den Kopf gespuckt.«
»Gut, gut, da bin ich aber froh. Und wo drückt Sie diesmal der Schuh?«
»Nicht mein Schuh ist es, der mich heute drückt, und das wissen Sie so gut wie ich.«
»Ihr Mann schickt Sie?«
»Sie haben ihn letzte Woche sehr verwirrt. Er war sehr zornig mit mir, hat sogar die Hand gegen mich erhoben. Ein Mann in Bedrängnis, hab ich mir gedacht, einer, der dringend Hilfe braucht.«
»Hilfe, nicht endlich einmal Gegenwehr?«
Margarete schüttelte den Kopf. »Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Das ist es, was Gott von uns verlangt. Hilfe braucht mein Mann, nicht Widerstand. Und diese Hilfe kann einzig von Ihnen kommen.«
»Wieso denn von mir?«, fragte Johanna unsicher.
»Sie haben der geschwätzigen Mutter Leinemann eine dumme Posse vorgespielt: Der Doktor und die Hexe. Warum denn nur, damit zerstören Sie doch auch Ihren Ruf?«
»Ihr Mann hat es selbst einmal zu mir gesagt: Eine Hexe hat keinen Ruf zu verlieren.«
»Aber ein Stadtrat, der Bürgermeister werden will.«
»Von mir aus kann er gerne Bürgermeister werden, ich hindere ihn nicht.«
»Doch, das tun Sie. Und es fällt mir wirklich schwer, Ihre Gründe dafür zu begreifen.«
»Ach ja?«, Johanna lachte unfroh. »Für Sie ist das Leben doch bequem. Die wohlhabende Neuruppinerin und der gelehrte Herr Stadtmedicus, ein hoch angesehenes Paar, eine vorbildliche Ehe. Dass da keine Liebe zwischen Ihnen beiden ist und dass der Herr Stadtmedicus gelegentlich gewalttätig wird, das weiß ja niemand.«
»Niemand außer Ihnen. Ich habe Ihrer Diskretion vertraut!«
»Das konnten Sie und können Sie immer noch.«
Margarete Ansbach atmete schwer. Plötzlich begann sie zu keuchen und nach Luft zu ringen. Ihr Gesicht färbte sich rot, die Augen traten hervor.
»Ach mein Gott, Ihr Asthma!«, sagte Johanna wütend, weil sie sich wieder einmal bei ihrer Hilfsbereitschaft gepackt fühlte. Eilig kramte sie aus ihrer großen Tasche ein Fläschchen hervor. »Hier, riechen Sie daran, kräftig, versuchen Sie langsam einzuatmen, so … so ist es gut … ganz langsam, ganz tief. Ich habe Ihnen doch die Tinktur neulich mitgegeben, Sie sollten sie immer in Ihrer Rocktasche haben!«
Margarete wollte reden, musste aber ein paar Mal ansetzen, bevor sie einen ganzen Satz hervorbrachte: »Mein Mann hat Sie geliebt und begehrt!«
»Aber Sie wissen doch, zwischen uns ist nichts gewesen außer Lernen und Lehren.«
»Ich weiß es. Aber nur, weil Sie ihn nicht gewollt haben.«
Ein Hustenanfall schüttelte sie. Johanna rieb und klopfte ihr den Rücken. »Und statt Ihrer«, keuchte Margarete, »begehrt er inzwischen das Bürgermeisteramt, mit der gleichen Intensität.«
»Aber mit besseren Aussichten«, warf Johanna ein.
Nach und nach wurde Margaretes Atem ruhiger. Ein letzter Schnaufer, ein Luftschnappen, dann endlich schien der Anfall überwunden und Margaretes nächste Sätze kamen so flüssig heraus, als wären sie sorgsam geprobt worden: »Seien Sie großzügig, Witwe Wolters, stellen Sie sich ihm nicht in den Weg. Als Ärztin sind Sie inzwischen viel gescheiter und besser als er. Warum wollen Sie nicht auch als Mensch besser sein!«
»Als Mensch? Sie meinen als Hexe! Jawohl, ich habe ein paar Gerüchtchen auf den Weg geschickt, und die sind abgeschwirrt wie Fledermäuse in der Nacht. Es sollte nur eine kleine Warnung sein, dass ich das, was er über mich und den deutschrussischen Wanderburschen in Umlauf gesetzt hat, nicht wehrlos hinnehmen werde.«
»Heinrich Ansbach war eifersüchtig, sonst nichts. Am liebsten hätte er natürlich beides, Sie und den Bürgermeisterposten. Ein Zeichen dafür, dass sich die Hoffnung nur sehr schwer geschlagen gibt.«
»Schon wieder Hoffnung! Ihre Hoffnung, seine Hoffnung. Wo bleibt denn da die meine?«
»Wieso brauchen Sie noch Hoffnung, Sie haben doch die Liebe.«
Margarete Ansbach hatte ihre Haltung wiedergefunden, das hektische Rot ihrer Wangen war der üblichen grauen Blässe gewichen. »Ich möchte, dass Sie diese Stadt verlassen«, sagte sie, »Sie können doch überall Ihr Brot verdienen. Mein Mann hat sein Wissen mit Ihnen geteilt, obgleich seine akademische Ehre und auch die Gesetze ihm solches verbieten. Frauen und Juden dürfen nicht in die Wissenschaft eingeführt werden – das ist Ihnen bekannt. Warum befreien Sie Heinrich Ansbach nicht von Ihrer Gegenwart? Ich würde Sie dafür großzügig bezahlen.«
»Das überrascht mich wirklich sehr, Frau Margarete. Glauben Sie denn, dass es Ihnen besser gehen wird, wenn ich nicht mehr hier bin?«
»Wenn es meinem Mann besser geht, dann ist auch mir geholfen. Und Sie, Witwe Wolters, würden mich gewiss noch vor Ihrem Fortgang mit ausreichend Medizin für die kommenden Jahre versorgen.«
Ungläubig starrte Johanna die Frau an, und plötzlich bekam sie eine große Wut. Sie hätte nicht sagen können, was sie in diesem Moment mehr aufregte, die klebrige Hingabe einer ungeliebten Frau an ihren Ehemann, oder aber deren arrogante Einforderung von Fürsorge von eben jener Person, der sie gerade den Stuhl vor die Tür ihrer Heimat setzen wollte.
»Jetzt reicht’s aber, Frau Ansbach«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Diese Stadt ist auch meine Stadt, und ich werde mich hier nicht rauskaufen lassen. Wenn Sie meinen, Sie könnten mir die Heimat verleiden, indem Sie dafür sorgen, dass man Stepan Melchior hier Arbeit und Wohnung verweigert, dann werde ich dafür sorgen, dass der Stadtrat Heinrich Ansbach nicht Bürgermeister wird. Dann verbünde ich mich eben mit dem Bösen, und die Liebe habe ich ja sowieso.«
Sie sprang auf und rannte davon, ohne sich noch einmal umzusehen, raus aus der Stadt, durchs Berliner Tor, hinein in den Wald. Dort ließ sie sich keuchend in das feuchte Laub am Fuß ihrer Rotbuche fallen, lehnte sich an den Stamm und berauschte sich an Rachephantasien, von denen sie jedoch genau wusste, dass sie das Reich der bösen Wünsche nicht verlassen würden.
Als sie sich zwei Stunden später auf den Weg nach Hause machte, war sie durchgefroren, hatte einen nassen Rock, ein Kratzen im Hals, aber auch ein paar neue Gedanken.
Sie liebte Stepan, das war sicher, daran hatte sogar die graue Wohlgeborene nicht gezweifelt. Und alles andere würde sie ab sofort ihrer Liebe unterordnen. Und wenn es Stepan nicht möglich wäre, im Ort eine vernünftige Wohnstatt zu finden, würde sie ihn zu sich ins Haus nehmen. Und wenn Olga das nicht ertragen könnte, dann müsste die eben ausziehen. Olga mit ihren verrückten Gedanken, von denen Johanna selbst und vor allem ihr Sohn sich bislang viel zu sehr hatten beeinflussen lassen. Sie wollte doch gar nichts anderes sein als das, was sie war, nicht fürstlichen Geblüts, nicht schwimmend in Gold und Edelsteinen, und vor allem keine Zariza. Falls man sie tatsächlich ihrer Schwachheit wegen unmittelbar nach der Geburt gegen ein kräftiges männliches Baby ausgetauscht hatte – umso besser! So brauchte sie wenigstens keine Kriege zu führen, keine Millionen von Leibeigenen für sich schuften zu lassen, nicht wochenlang starr für offizielle Porträts zu sitzen und vor allem nicht ständig gewahr sein zu müssen, dass irgendwer sie vergiften könnte.
Sie liebte und sie wurde geliebt, das hatte sie den meisten Menschen, die sie kannte, voraus. Notfalls könnte sie Stepan ja sogar heiraten! Das behagte ihr zwar nicht, aber wenn es half, die Wogen in der Stadt zu glätten…! Sie würde auch keine dummen Gerüchte mehr auf den Weg schicken, das würde Heinrich Ansbach ihr danken und seinerseits nur noch Gutes über sie und Stepan reden.
Je näher sie ihrem Haus kam, umso optimistischer und entschlossener wurde sie, und als sie eintrat, rief sie als Erstes Olga zu: »Von heute an lebt Stepan Simonowitsch bei uns! Ich werde ihn nämlich heiraten und für ihn sorgen. Noch heute gehe ich zum Standesamt. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du eben ausziehen!«
Die Babuschka jedoch schüttelte nur unwirsch den Kopf. »Red keinen Unsinn, was soll denn dein Sohn von dir denken! Und auf dem Tisch im Behandlungszimmer liegt schon seit Stunden die Schinder-Käthe, die schreit nach dir, weil du ja versprochen hast, ihr in ihrer schweren Stunde beizustehen.«
Ach ja, die dumme, schon fast dreißigjährige Käthe, ledige Tochter von Kurt Neusiedler, dem Abdecker, den alle mieden und dessen Gewerbe für die Stadt doch unerlässlich war. Käthe, die angeblich immer nach Verwesung stank, die krumm gewachsen und zu nichts nütze war, dabei jedoch ein Engelsgesicht hatte, mit großen ausdruckslosen Kuhaugen und einem breiten, feuchten Mund, der immer leicht geöffnet stand. Nach anfänglichen Wutausbrüchen hatte ihr Vater den Zustand der Tochter resigniert hingenommen – »na, dann sind wir eben in Zukunft zu dritt.«
Gut möglich, dachte Johanna, dass er selbst der Vater des Babys war. Sie würde jedenfalls nicht versuchen, der gebärenden Käthe unter den sinnverwirrenden letzten Geburtswehen den Namen des Kindsvaters abzupressen, wie es von den städtischen Hebammen bei ungeklärten Schwangerschaften erwartet wurde.
Nun hing Käthe Neusiedler also bäuchlings über Johannas Behandlungstisch, hatte die Röcke über den Kopf hochgeschlagen und jammerte zum Gottserbarmen. Sie blutete.
Johanna stürmte ins Zimmer, verriegelte die Tür hinter sich – ihr Sohn war bereits sehr neugierig auf das geheime weibliche Leben – und wusch sich als Erstes sorgfältig die Hände. Dann packte sie die Wimmernde am Kragen, zog sie hoch und bugsierte sie auf den Geburtsstuhl, um sie zu untersuchen.
»Glaubst du etwa, du bringst deinen dicken Bauch weg, indem du dich drauflegst?«, schalt sie. »Und hör auf so zu zappeln, sonst kann ich dich nicht untersuchen.«
»Mein Vater hat aber gesagt, du kriegst nie wieder irgendein Stück von seinen Viechern, wenn du mein Kind nicht gesund zur Welt holst!«
»Red kein dummes Zeug und lass das Jammern. Wenn du musst, dann schrei, aber richtig! Und wenn du nicht schreien musst, dann hältst du besser den Mund.«
Es wurde eine lange, schwere Geburt, und viele Stunden lang befürchtete Johanna, dass sie ausgerechnet mit der Tochter des Abdeckers, dem sie das beste Anschauungsmaterial für die weiblichen Organe verdankte, das Grauen eines toten Kindes oder gar den Tod der Gebärenden erleben müsste.
Nach fast zwanzig Stunden vergeblicher Bemühungen – Käthe verlor viel Blut und wurde immer schwächer, Johanna wurde immer verzweifelter – jagte sie am frühen Morgen Olga in die Schulzenstraße zu Dr. Ansbach, um ihn um Hilfe zu bitten.
Olga kehrte unverrichteter Dinge zurück. Die Tür des Doktorhauses sei verschlossen gewesen, und auf ihr heftiges Klopfen habe nur die Jungfer Frieda aus dem Fenster geschaut und gesagt, der Doktor habe eine schwere Nacht hinter sich, er schlafe noch, und wenn er denn wach werden würde, müsse er ohnehin sogleich zur Ratssitzung fahren.
Johanna dachte an ihre eigenen langen Geburtsleiden, denen Heinrich Ansbach erst mit einem mutigen Griff zum Skalpell ein Ende bereiten konnte. Vor allem aber musste sie sich jetzt an Heinrich Ansbachs Bücher erinnern, und dazu an die vielen Versuche, die sie selbst an toten Tieren vorgenommen hatte.
Plötzlich fiel alle Erschöpfung, der sie sich kaum noch hatte erwehren können, von ihr ab und machte einem Gefühl euphorischer Energie Platz. Sie konnte es, und sie würde es tun, und wenn es ihr auch strikt verboten war und mit Gefängnis geahndet werden könnte.
Sie traf ihre Vorbereitungen, kochte die Instrumente aus, die sie sonst nur für Tiere benutzte und die sie nicht einmal besitzen, geschweige denn bei Menschen anwenden durfte, flößte der bereits vor Schwäche willenlosen Käthe ein Glas Kartoffelschnaps ein, wusch sich nochmals die Hände und begann ganz ruhig mit der Arbeit.
Es war ein kleiner Junge, den Johanna bei ihrem ersten chirurgischen Eingriff am menschlichen Objekt ins Leben beförderte, komplett mit zehn Zehen und zehn Fingern und zwei winzigen Hoden.
Sie ahnte, dass dieses Ereignis für sie fast so wichtig sein könnte wie die Geburt ihres eigenen Sohnes. Sie hatte eine Frau vor dem Tod bewahrt und gleichzeitig einem neuen Menschen das Leben ermöglicht, war dem so genannten Schicksal entschlossen entgegengetreten. Sie hatte etwas Verbotenes getan, etwas, das mit schwerer Strafe geahndet werden könnte – und ihr ganzer Körper, ihr ganzes Denken und Fühlen jubelte vor Glück.
Trotz ihrer Erschöpfung wich sie während der nächsten Stunden nicht von Käthes Seite, bereitete Spinnenweben und Salbeiblätter über die sorgsam vernähte Wunde, wechselte mehrfach den Verband und verabreichte der vor lauter Glück rasch schmerzfreien jungen Mutter viel dunkles Bier. Am Abend legte sie ihr zum ersten Mal das Bübchen an die Brust.
Danach überließ sie Mutter und Kind der Babuschka, bei der sich, nach dem üblichen Gezeter, bald die Mütterlichkeit durchsetzte, und begab sich selbst endlich zur Ruhe. Sie dachte weder an das Gute noch an das Böse, nicht einmal an ihren Liebsten, sie schlief zwölf Stunden lang.
Als sie endlich wieder munter war, sich um Käthe und das Baby gekümmert und eine große Tasse schwarzen Tee getrunken hatte, fand sie auch zurück zu ihren Problemen, zu ihren Entschlüssen, und ihr fiel auf, dass sie den Liebsten seit zwei Tagen nicht gesehen hatte. War vielleicht Frau Margarete endlich zur Vernunft gekommen und hatte, anstatt Johanna weiterhin verjagen zu wollen, ihren Einfluss genutzt, um Stepan ein Quartier zu besorgen?
Johanna machte sich auf, Stepan zu suchen, irgendwer hatte ihn gewiss gesehen. Als sie ihn nach mehreren Stunden immer noch nicht gefunden hatte, sich auch niemand an ihn erinnern wollte, war Johannas heiterer Optimismus längst umgeschlagen in Angst.
Wieder daheim ging sie unruhig in der Wohnung herum, da fischte Olga schließlich ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus ihrer Schürzentasche und sagte: »Hier, mein Täubchen, den hat mir der Stepan Simonowitsch vor ein paar Tagen in die Hand gedrückt, über all der Aufregung um die Abdeckerstochter hätte ich den Zettel fast vergessen. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein.«
Stepans Brief enthielt keine Anrede und auch keine innigen Grüße am Schluss, nur eine simple Mitteilung:
Da man mir überall in der Stadt von Deiner Untreue berichtet hat, von Deinem schamlosen Verhältnis mit dem verheirateten Stadtmedicus, sehe ich mich veranlasst, umgehend diese Stadt, in der mir das größte Glück begegnet, aber auch das tiefste Leid zugefügt worden ist, zu verlassen. Ein Wandersmann muss wandern, das hat die alte Olga schon immer gesagt, und auch, dass ein einfacher Zimmermann und Wasserbauer kein Recht hat auf die Liebe einer Zarentochter. Nicht einmal, wenn diese eine Hure ist.
Johanna schrie und tobte nicht. Sie brach auch nicht zusammen, noch versuchte sie etwa, Stepan zu verfolgen. Johanna versteinerte. Für Tage, dann für Wochen schwand aus ihr alles Leben – oder jedenfalls das, was zuvor ihr Leben ausgemacht hatte. Für ihren Sohn und Olga wurde sie unberührbar. Ihre Patientinnen, die sie so sorgsam auf die Geburten vorbereitet hatte, mussten plötzlich ihre Kinder alleine zur Welt bringen oder mit viel Geld die städtische Hebamme, der Johannas Wirken stets ein Dorn im Auge gewesen war, zur Hilfeleistung bestechen. Die Armen, Heimlichen und Unverheirateten hatten jedoch meist kein Geld, so versuchten sie, allein zurechtzukommen. Während der ersten zwei Monate im Jahr 1698 gab es in Neuruppin drei Totgeburten und dazu stürzte sich ein junges Mädchen kurz vor der anstehenden Geburt das Wehr im Alten Rhin hinunter.
Oft blieb Johanna bis spät am Tag im Bett, und wenn sie endlich hochkam, dann nur, um sich daneben auf den Boden zu legen und das Laken über den Kopf zu ziehen. Ihr Gesicht wurde so grau wie das der Frau Margarete, und sie verweigerte jede normale Nahrung. Stattdessen trank sie mindestens drei Krüge schwarzes Bier am Tag und aß nur hin und wieder einen trockenen Brotkanten dazu. Ihr Körper schwemmte auf, und sie empfand sich einer großen bleichen Made ähnlicher als einem menschlichen Wesen. Sie konnte nicht weinen. Sie konnte auch kaum einen klaren Gedanken fassen, alles wurde erstickt von dem Gefühl bleierner Sinnlosigkeit.
Eines Nachts dann, im März, begann sie plötzlich zu wimmern, erst zart wie ein verängstigtes Katzenjunges, dann steigerte sich das Geräusch zu hysterischem Geheule, und schließlich wurde daraus ein Brüllen, so verzweifelt und tierisch, dass zwei Männer, die nach einem späten Umtrunk an ihrem Haus vorbeigingen, entsetzt die Flucht ergriffen: »So klingt es, wenn sich die Hexe mit dem Teufel paart.«
Aber da war kein Teufel mehr, der Teufel hatte seine Hexe eine Hure genannt und war auf und davon, ohne zu wissen, dass er von sich ein Stück hinterlassen hatte. Johanna stieß es in dieser Nacht voll Angst und Schmerz und Trauer aus ihrem Körper.
Die Babuschka, die sich seit Stepans Verschwinden und Johannas gefährlicher Melancholie – die sie für sehr ansteckend hielt – auf die allernötigsten Handreichungen für die Kranke beschränkt hatte, fand ihr Täubchen am nächsten Morgen aufrecht in dem blutbeschmierten Bett sitzend. In den Armen hielt sie ein in Tücher gewickeltes und sorgsam verschnürtes Paket, auf dem sich ebenfalls dunkle Blutflecken abzeichneten.
Johanna lächelte der Babuschka entgegen. Zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten waren ihre Augen wieder klar. »Es ist vorbei, Olga. Jetzt endlich kann ich trauern ohne Reue und Schuld und Sühne. Ein ganz normaler Verlust, mit dem viele Frauen fertig werden müssen. Die Verzweiflung hat mich so weit von mir weggetrieben, dass ich nicht einmal gemerkt habe, was da in mir vor sich ging. Aber ich hätt’s ohnehin nicht halten können. Es war nicht lebensfähig. Genauso wenig wie die Gemeinschaft zwischen mir und Stepan. Die Liebe und das Bereitsein haben damit leider überhaupt nichts zu tun.«
Die Babuschka wollte Johanna das Bündel wegnehmen. »Du wirst doch immer verrückter«, murrte sie. »Womit hast du denn nur letzte Nacht wieder herumgespielt? War die Wiesner Katrin hier und hat dir ein Abgänglein geschenkt, eines, dem nicht einmal ein Grab zugedacht ist? Oder hast du wieder von der Abdeckerstochter etwas Tierisches bezogen?«
»Nein, Babuschka, diesmal war es etwas sehr Menschliches, ich hab dazu nicht einmal die Totenwäscherin gebraucht. Statt es auseinanderzuschneiden und zu untersuchen, werde ich es heimlich am nördlichen Friedhofsrand begraben und drei Vaterunser dazu beten, und dann werde ich mir ein Jahr Trauer verschreiben und jeden Sonntag das geheime Grab besuchen. Oder vielleicht doch nur sechs Monate, das sollte wohl genügen, es hat ja nie wirklich gelebt.«
Bis zum Sommer hatte Johanna sich so weit unter Kontrolle, dass sie ihr altes Leben wieder aufnehmen konnte. Die Jugend allerdings war ihr unterdes abhanden gekommen, die schöne Unbekümmertheit und der leichtherzige Frohsinn, der keinen Anlass brauchte. Bislang hatte sie mit ihren fast sechsundzwanzig Jahren und trotz Ehe, Witwen- und Mutterschaft immer noch wie ein junges Mädchen gewirkt. Jetzt sah sie wie eine erfahrene Frau aus.
Ihre Schritte wurden gesetzter, aber auch energischer. Sie überprüfte ihre Handlungen auf Sinn und Notwendigkeit, bevor sie sich ausnutzen und zu Überflüssigem hinreißen ließ. Ihre Arbeit als Heilerin schränkte sie auf Kosten ihrer Studien des menschlichen Körpers immer mehr ein. Ganz bewusst nutzte sie ihren Ruf als Hexe, als einer Person, mit der man sich besser gut stellt, weil sie einem sonst Krankheiten an den Hals und Ungeziefer ins Haus wünschen könnte, um in Ruhe gelassen zu werden.
Margarete Ansbachs Haar war inzwischen überall nachgewachsen, allerdings nicht mausgrau wie die übrigen Haare, sondern in reinstem klarem Weiß. Beim Erntedankfest hatte sie, errötend wie eine Jungfrau, zur allgemeinen Verblüffung die Haube für ein paar Minuten abgenommen und sich im Schmuck ihrer grau-weiß gestreiften Pracht gezeigt.
»Das hat ihr die Hexe angetan!«, flüsterten die Leute.
Margarete aber lobte Johanna dafür, dass sie diesem russischen Rotkopf den Laufpass gegeben und es vorgezogen habe, allein in Neuruppin zu bleiben. »Wir hätten sie und ihre Tinkturen und Salben doch sehr vermisst!«, sagte sie, und im Übrigen habe diesem dummen Gerede von einem verwerflichen Verhältnis zwischen dem Stadtmedicus und der Hexe ja sowieso niemand Glauben geschenkt.
Kurz nach dem Erntedankfest wurde Heinrich Ansbach dann tatsächlich die Stelle eines Hilfsbürgermeisters angeboten. Derart in seinem Ehrgeiz befriedigt und im Frieden mit seiner Frau, besann er sich wieder auf Johanna und versuchte, die Freitagsnächte neu zu beleben.
»Ich habe mit meiner lieben Frau gesprochen«, sagte er zu ihr, »sie hat nichts mehr dagegen, wenn ich dir weiterhin Unterricht erteilte. Jetzt, da sich ihr Herzenswunsch, Frau Bürgermeister zu sein, erfüllt hat, hält sie es für menschlich und großzügig, auch dir deinen Wunsch zu erfüllen, nämlich dir Zugang zur Wissenschaft zu gewähren. Sie hat sogar angeboten, sich ein paar Mal wöchentlich um deinen Sohn zu kümmern. Sie würde ihm gerne gute Manieren beibringen und natürlich auch Lesen und Schreiben. Es ginge nicht an, dass er den lieben langen Tag am Rockzipfel dieser verrückten Babuschka herumhinge.«
»Mein Sohn kann bereits lesen und schreiben«, sagte Johanna ärgerlich, »und seine Manieren sind vollkommen ausreichend.«
»Wie du meinst, ich werd’s ausrichten. Aber mit dir und mir hat das ja nichts zu tun. Wir werden uns nun endlich wieder in den Freitagnächten gemeinsam meiner Wissenschaft und deiner Erfahrung widmen können.«
Johanna reagierte darauf ebenfalls menschlich und großzügig: »Ich bin dir sehr verbunden, Heinrich Ansbach, und ich nehme dein Angebot gerne an. Allerdings müsstest du schon zu mir kommen, und das bei Tage. Du wolltest ein glasklares durchsichtiges Leben führen, und gemeinsamen Nächten eignet immer etwas Verschwommenes, Undurchsichtiges an. Also kommenden Freitag zur Mittagszeit bei mir?«
Eine plötzliche Hitze fuhr ihm ins Gesicht, und seine rechte Hand zuckte nach oben. So ist es also, wenn er seine Frau schlägt, dachte Johanna. Sie sah ihm starr in die Augen, die Hand fiel herunter und pendelte an seinem Arm wie ein totes Stück Fleisch. Zwischen zusammengebissenen Zähnen fauchte er sie an: »Du bist des Teufels. Gott wird dich dafür strafen.«
»Gott wird sich sehr wohl überlegen, wen von uns beiden er straft.«