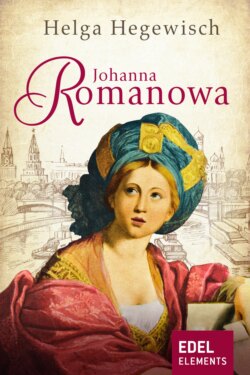Читать книгу Johanna Romanowa - Helga Hegewisch - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2
ОглавлениеNicht nur Johannas Leben hatte sich seit dem Durchmarsch des russischen Reisezuges geändert, auch das ihres Sohnes Alexander. Solange er denken und reden konnte, hatte ihm seine Babuschka erzählt, dass eigentlich ihm und nicht etwa dem gleichaltrigen Sohn Peters, Alexej, die nächste Zarenkrone gebühre.
»Auf deinen Schultern wird die Zukunft Russlands liegen«, hatte Olga in tagtäglicher Beschwörung auf das Kind eingeredet, »zwar bist du wegen der Starrköpfigkeit deiner Mutter leider nur ein halber Prinz, aber der Sohn Zar Peters ist überhaupt keiner. Von der Mutterseite jedenfalls fließt in dir reines Romanow-Blut.«
So richtig klar geworden waren dem Kind diese Zusammenhänge nie, doch hatte das Gerede der Alten in ihm ein diffuses Überlegenheitsgefühl, wenn nicht gar ein kindliches Sendungsbewusstsein entstehen lassen. Und als nun der Zar aller Reußen in persona durch Neuruppin zog – so groß und stattlich und doch so bescheiden –, da meinte er plötzlich die Bedeutung des Geredes über Russlands Zukunft und sein kostbares Romanow-Blut zu begreifen: Dieser Mann, Pjotr Alexejewitsch Romanow, war sein wirklicher Vater! Der alte Lehrer, auf dessen Knien er als kleines Kind gesessen hatte und dessen Namen er trug, konnte unmöglich sein Vater sein. Ein hinfälliger Mann, höchstens noch tauglich zum Großvater. Und dass seine Mutter eine Beziehung zu dem Zaren hatte, war ja bei dem Besuch klar ersichtlich gewesen: Nur mit ihr hatte er gesprochen, nicht mit dem Pastor oder mit dem Bürgermeister oder mit dem Stadthauptmann – nur mit ihr, mit Johanna Wolters, Schuras Mutter.
All das Widersprüchliche, Verschwommene war für den Knaben ganz klar geworden: Er hieß in Wahrheit nicht Alexander Wolters, sondern Alexej Petrowitsch Romanow, und sein Vater, der große Zar, würde bald zurückkommen, um ihn zu holen und auszuwechseln gegen diesen anderen Alexej, der dem Zaren als Sohn untergeschoben worden war. Hatte er denn nicht genau das zu ihm gesagt?
Die alte Olga, dankbar, dass ihre Bemühungen endlich Früchte trugen, nahm die gewissen Unstimmigkeiten hin und verfestigte eifrig die Träume des Kindes: Der große Zar aller Reußen wird eines nicht so fernen Tages zurückkehren, dich holen und endlich in deine wahren Rechte einsetzen.
Johanna hatte während der Monate ihres Glücks mit Stepan und dem Unglück danach kein sehr aufmerksames Auge auf ihren Sohn gehabt. Und als sie sich ihm dann endlich wieder zuwandte, musste sie erkennen, dass die Idee seiner »wahren« Herkunft, die Olga dem kindlichen Bewusstsein wie ein Reis zwecks Veredelung aufgepfropft hatte, inzwischen zu erstaunlicher Kraft hochgeschossen war: Olgas Ammenmärchen hatte endlich einen realen Bezug bekommen.
Das Kind wartete, voller Unruhe, Ungeduld, und dabei doch von unbeugsamer Zuversicht auf den Mann, den es für seinen Vater hielt.
Johanna wartete ebenfalls, inzwischen ruhig, geduldig und dabei nicht allzu zuversichtlich, auf ihren Liebsten.
Doch was wusste sie eigentlich von Stepan? Sie war so ausschließlich mit ihrer Leidenschaft, ihrer ständigen sexuellen Erregung und Hingabe beschäftigt gewesen, dass sie darüber versäumt hatte, ihn genauer kennen zu lernen.
Ungeschickt war er, schüchtern, verschlossen und stets etwas abgelenkt. Nur in den intimsten Momenten war er ganz mit ihr gewesen, offen fordernd, wagemutig und selbstbewusst.
Das wusste sie. Und das würde sie auch nie vergessen. Und sonst? Dass er aus Russland stammte, dass sein Vater Schiffszimmermann war und dass er drei Brüder hatte, die brav und tüchtig in der Nachfolge des Vaters arbeiteten. »Drei gesunde Söhne«, hatte er gesagt, »da kann er doch leicht auf den vierten verzichten.«
»Und dieser vierte, was will er denn sonst tun, wenn schon nicht Sohn sein?«
»Er will den Sinn des Lebens erforschen, unseren Platz im Universum und vor allem unsere menschlichen Abhängigkeiten.«
Dieser Satz hatte Johanna damals tief gerührt, fast wären ihr die Tränen gekommen. Ein Wirrkopf, der nach den Sternen griff, bevor er noch mit sicheren Beinen auf der Erde stand. Und der über menschliche Abhängigkeiten grübelte und doch die nahe liegende und wunderbarste Abhängigkeit, seine Liebe, nicht begriff.
»Gut, gut, Stepan Himmelsforscher«, hatte Johanna darauf gesagt, »grübel, wenn du grübeln musst, aber verpass vor lauter Bäumen den Wald nicht. Der Mensch ist vor allem abhängig vom Menschen. Natürlich auch etwas vom Wetter, von den Steuern, von den hohen Herrschaften, von Krieg und Frieden und so weiter. Aber das Wichtigste ist ihm doch sein eigenes Menschsein, sein Körper, seine Haut und Knochen und Eingeweide, sein Aufblühen und Verwelken, die Stärke oder Schwäche seiner Muskeln, die Kraft seines Unterleibes. Und ich sage dir, mein kluger Liebster, mit der Ergründung dieser Abhängigkeiten bin ich schon sehr viel weiter gekommen als du mit deiner Platzsuche im Universum.«
»Dies Bündel aus Haut und Knochen und Eingeweiden ist doch nur ein winziger Splitter in all den großen Abhängigkeiten!«
»Aber es ist alles, was wir haben.«
»Eben damit werde ich mich nie und nimmer abfinden können!«
Während des kommenden Winters überlegte Johanna immer wieder, die Stadt Neuruppin zu verlassen. Sie begann sogar ein paar Vorbereitungen zu treffen, richtete den alten großen Planwagen, mit dem ihre Eltern und sie selbst einst hier angekommen waren, wieder her und sah sich nach einem passenden Pferd um. Schließlich kaufte sie eine zweijährige braune Stute. Durch die Streitigkeiten mit Heinrich Ansbach waren ihre Möglichkeiten in Neuruppin mehr und mehr eingeengt, sie stand unter scharfer Beobachtung und konnte sich keine Experimente an Tierkadavern mehr erlauben, geschweige denn einen Menschen operieren. Das Versteck ihrer Instrumente wechselte sie nahezu täglich, immer in Sorge, dass man sie wegen verbotener Eingriffe anklagen könnte.
Die Trauer um den verlorenen Liebsten und das Gefühl, immer nur benutzt und nie belohnt worden zu sein, nahm ihr die heitere Sicherheit, mit der sie zuvor ihr Ausgeschlossensein akzeptiert und sich auf ihre Forschungs- und Heilarbeit konzentriert hatte.
Als ihr Sohn Alexander, der sich seit dem Besuch des Zaren nur noch Alexej nennen lassen wollte, begriff, dass seine Mutter den Ausbruch aus ihrer Neuruppiner Welt plante, machte er ein großes Geschrei und erklärte starrsinnig, dass er auf gar keinen Fall von hier fortgehen würde. Er müsse warten auf die Rückkehr des Zaren. Und dieser könne ihn nur hier finden.
Wider besseres Wissen versuchte Johanna, ihren Sohn nicht ernst zu nehmen. »Ein so großer Herrscher hat Mittel und Wege, dich überall zu finden – das heißt, wenn ihm wirklich etwas daran liegt. Und sowieso wirst du tun, was ich dir sage!«
»Werd ich nicht!«, schrie das Kind. »Du müsstest mich schon an Händen und Füßen binden, und auch dann würde ich noch ein solches Geschrei machen, dass die Leute hier begreifen würden, wie böse und übel du mit mir umgehst.«
Da das Kind sich wehrte, wehrte die Babuschka sich ebenfalls. Zwar hatte sie es inzwischen aufgegeben, Einfluss auf Johanna zu nehmen, doch klammerte sie sich nun umso mehr an den »kleinen Zarewitsch«.
Auch war Johannas Entschluss ja nur halbherzig, denn ebenso wie das Kind wartete sie Tag für Tag, Stunde für Stunde, und ihre Erinnerungen und Träume wollten den Forderungen der Vernunft nicht nachgeben.
Im Frühjahr dann passierte, was Johanna schon lange befürchtet hatte. Ihre Heilkunst wurde umgedeutet in Hexenkunst und die Hexe zur Jagd freigegeben.
Die Tagelöhnerfrau Lina Burger, die bereits innerhalb von sechs Jahren vier Töchter geboren hatte, erwartete das fünfte Kind. Die Frau war abgearbeitet, ausgelaugt und müde und sah mit ihren vierundzwanzig Jahren bereits aus wie eine alte Frau. Sie hatte dieses Baby nicht gewollt, und ihr Körper wollte es offenbar auch nicht. Doch jedes Mal, wenn sie befürchtete, ihre Leibesfrucht zu verlieren, kam sie zu Johanna gelaufen und flehte sie an, einen Abgang zu verhindern.
»Aber dein Körper scheint sich gegen das Kind entschieden zu haben, also sollten wir uns auch danach richten«, sagte Johanna. »Und außerdem hast du mir doch selbst erzählt, dass du es eigentlich gar nicht haben willst.«
»Ja, ja, hab ich. Oder hab ich auch nicht, ich weiß nicht mehr, wenn ja, dann war es eine Sünde. Was in einem wächst, das darf man nicht vor der Zeit wieder hergeben. Wenn ich nur tüchtig durchhalte, dann wird’s gewiss ein Junge. Das hat der Pastor gesagt.«
Johanna tat, was sie konnte, verabreichte entspannende Mittel, kochte Stücke der Eibenwurzel aus und ließ die Schwangere den Saft trinken, verordnete Ruhe – die die Frau natürlich nicht einhalten konnte – und entschloss sich schließlich, als die Blutungen und ständigen Kontraktionen nicht aufhören wollten, zu einem Eingriff, den sie erst einmal bei einer durchreisenden Zirkusfrau gemacht hatte und dessen Erfolg sie nie hatte überprüfen können: Aus einem ausgekochten und fein zusammengedrehten Stück Schweinedarm formte sie eine Schlinge, die sie um den Gebärmutterhals der Frau legte, um dem Embryo den Ausgang zu verwehren.
Ein Versuch … dachte sie, nur ein Versuch, und wenn die Kontraktionen nicht aufhören, kann ich die Sache wieder rückgängig machen. Doch der Körper der Schwangeren kam tatsächlich zur Ruhe. Im neunten Monat dann war es für Johanna ein Leichtes, die Schlinge wieder zu lösen.
Die unmittelbar danach einsetzenden Geburtswehen waren dann von einer derart gewaltigen Kraft, wie Johanna sie noch nie erlebt hatte. Der Körper der Frau wurde hin und her gerissen, schreiend bäumte sie sich auf, und als das Baby schließlich in einem Schwall von Fruchtwasser und Blut ausgestoßen wurde, sackte sie in sich zusammen, als wäre sie bereits tot.
Ohne das Kind genauer zu betrachten, durchtrennte Johanna die Nabelschnur, hüllte es in ein warmes Tuch und versuchte es der Mutter in den Arm zu legen. Die aber stieß es weg. »Das war der Teufel in meinem Leib«, murmelte sie, »der Herr hat ihn endlich ausgetrieben. Weg mit ihm, ich will ihn nicht, habe ihn nie gewollt!«
Die Plazenta kam schnell und sah normal aus. Johanna versorgte sie in dem dafür vorgesehenen Topf, sie wusste, dass die meisten Frauen die Nachgeburt an sich nehmen wollten, um sie heimlich zu begraben. Sie sei der sterbende Zwilling des Neugeborenen, hieß es, und sie vereine alle schlechten Eigenschaften auf sich, damit das lebende Kind nur die guten behalte. Und da das Böse eine große Macht habe, müsse man es sorgsam und mit Ehrfurcht behandeln.
Nur die ganz armen Frauen ließen sich dazu herbei, den Mutterkuchen an die Totenwäscherin zu verkaufen. Die fertigte daraus Amulette. Mit Zauberkräften, wie man sagte. Schon zweimal hatte Johanna von der Totenwäscherin eine dieser Nachgeburten als großzügiges Geschenk bekommen. Sie untersuchte und präparierte sie und bewahrte sie dann in Spiritus auf.
Erst als Johanna ihre Patientin versorgt hatte – Gott sei Dank war nichts gerissen und die Schwäche nur eine allgemeine –, konnte sie sich endlich etwas näher mit dem Baby befassen. Es war ein Mädchen, und es sah merkwürdig aus. Der Kopf schien Johanna im Verhältnis zum übrigen Körper viel zu groß, aber es war kein Wasserkopf, wie sie ihn schon mehrfach in Heinrich Ansbachs Lehrbüchern abgebildet gesehen hatte. Der untere Teil des Gesichtchens wirkte ganz normal, auch die nachtdunklen Augen, die blicklos in die Welt sahen, doch die Stirn, flach wie ein Brett, war mindestens doppelt so hoch wie der Teil zwischen Augen und Kinn. Und das Verstörendste war, dass sich auf dieser flachen Stirn, ein wenig rechts von der Mitte, ein Mal befand, dunkelrot, wie ein ausgelaufener Tintenklecks.
Das Kindlein hatte gleich nach der Geburt den vorgeschriebenen ersten Schrei getan, jetzt atmete es flach und ruhig. Und als Johanna es badete, ruderte es munter mit den kurzen Armen und Beinen und schien sich wohl zu fühlen.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Johanna, »deine Mutter wird dich schon annehmen, sie muss nur erst einmal zu Kräften kommen. Nach den Geburtsschmerzen sind die Frauen manchmal noch etwas außer sich und sagen und tun dann merkwürdige Dinge. Und dein kleines Muttermal können wir abdecken mit Mehlfarbe, damit’s nicht gleich jeder sieht. Später wirst du schon lernen, damit zu leben. Und ich werde dir auch einen Glücksbringer mit auf den Weg geben, nämlich die feine Schnur aus Schweinedarm, ohne die du nicht hättest überleben können.«
Schon am ersten Morgen nach der Geburt kam der Kindsvater vorbei, um seine Frau nach Haus zu holen. Die anderen Kinder bräuchten ihre Mutter, und er selbst könne sich nicht kümmern, es sei schließlich Erntezeit. Als er von Johanna erfuhr, dass das Baby wieder ein Mädchen sei, würdigte er es keines Blickes, drehte sich um und ging – dabei hatte Johanna es so sorgsam gewickelt und verhüllt, dass man nur den unteren Teil des Gesichtchens sehen konnte. Die Mutter schien die Sprache verloren zu haben. Sie starrte nur vor sich hin, aß und trank willenlos, was Johanna ihr reichte, und ließ sich, ohne selbst einen Finger zu rühren, das Kind an die Brust legen.
In der zweiten Nacht verschwand Lina Burger mitsamt dem Baby aus Johannas Haus.
Während der kommenden Tage wurden in der Stadt verworrene Gerüchte und seltsame Anklagen verbreitet. Anfangs noch harmlos und vorsichtig, dann immer selbstsicherer, immer sensationsgieriger, bis sie wie eine gewaltige Flutwelle aus Schmutz durch ganz Neuruppin brandeten.
Johanna aber bemerkte das alles nicht. Sie erlebte etwas gänzlich anderes, eine Welle des Glücks und die Erfüllung ihrer Träume: Stepan Simonowitsch Melchior war zurückgekommen! In derselben Nacht, als Lina Burger mit ihrem Baby aus Johannas Haus verschwunden war, trat er ein, ging ruhigen Schrittes in das Zimmer, in dem Johanna schlief, entkleidete sich und legte sich zu ihr.
Den ganzen nächsten Tag über und auch noch die Nacht und den folgenden Tag kamen die beiden nicht mehr heraus, auch nicht, als Olga durch die verschlossene Tür mitteilte, dass jemand einen halb verrotteten Katzenkadaver ins Behandlungszimmer geworfen habe.
»Räum’s weg«, rief Johanna, »und bring uns Brot und Wein, und danach lass uns in Ruhe.«
Sie liebten sich, aßen und tranken ein wenig, versuchten auch ein paar Mitteilungen, mussten sich aber schon bald wieder lieben.
»Ich konnte nicht bleiben«, flüsterte Stepan, »ich werde nie bleiben können.«
»Jetzt bist du ja da«, sagte Johanna.
»Ich vergehe mich an der göttlichen Ordnung«, seufzte er.
»Nur zu«, sagte sie, »ich verzeihe dir.«
Über den Grund seines Fortgehens vor fast zwei Jahren redeten sie nicht. Johanna hatte lange genug Zeit gehabt, sich ein paar überzeugende Erklärungen zurechtzulegen. Sie hatte verstanden, dass ihre angebliche Untreue nur ein Vorwand für sein Fortgehen gewesen war, eine zufällig passende Begründung – nicht mehr.
»Du hast dich in die Erforschung deiner Abhängigkeiten vernarrt und merkst gar nicht, dass du dadurch deine eigene Freiheit verlierst.«
»Es gibt keine Freiheit, hat sie nie gegeben!«
»Gibt es doch! Ich zum Beispiel nehme für mich die Freiheit in Anspruch, keine Zariza zu sein. Weil ich es nämlich nicht sein will.«
»Das wird dir überhaupt nichts nützen.«
»Wieso denn nicht? Mein Leben gehört mir, verstehst du, mir ganz allein. Es ist mir von Gott gegeben worden zu meiner persönlichen Verfügung. Und darum kann ich auch einen Teil davon an dich verschenken, und kein Mensch, schon gar nicht dein tyrannischer Sternenhimmel, wird mich daran hindern.«
»Wenn’s doch so wäre!«, seufzte Stepan.
Seine Grübeleien, die sie als kindisch und ängstlich empfand, machten sie ungeduldig. Sie wollte Antworten von ihm, wollte wenigstens mit ihm streiten können, aber Stepan wich aus, und wenn sie ihn zu sehr mit Worten bedrängte, brachte er sie mit seinem Körper zum Schweigen.
Auf die Dauer jedoch erlahmt jede Lust, und Johannas Energie wollte sich nicht mehr unterdrücken lassen. Und als Stepan dann doch ein paar zusammenhängende Sätze zuwege brachte: Er sei eigentlich überhaupt nicht hier, sie solle ihn sofort vergessen, dürfe ihn auf gar keinen Fall weiter an sich binden, weil er tun müsse, was ihm aufgetragen und darum Schicksal sei … und so weiter, und so weiter, da bekam sie einen Wutanfall.
»Hör auf, Stepan«, schrie sie, »ich kann dein Gerede nicht mehr ertragen!«
»Mangelnde Einsicht …«, sagte er trotzig, »gestohlene Zeit …«
»Wem hast du denn die Zeit gestohlen? Einer Ehefrau etwa, einer anderen Geliebten oder vielleicht gar deinem Zaren?«
Er antwortete nicht, und es wäre wohl besser gewesen, wenn auch sie geschwiegen hätte. Doch das gelang ihr nun nicht mehr. »Warum bist du denn überhaupt zurückgekommen?«, schrie sie. »Doch nur, um mich erneut in Verzweiflung zu stürzen, und um dir zu beweisen, dass deine Sterne wieder mal Recht hatten. Dann solltest du jetzt sofort gehen, geh, Stepan, geh, lass mich in Ruhe, ein für alle Mal.«
»Ich wollte dich doch nur schützen …«, sagte er.
»Mich schützen? Wovor denn? Ich kann mich selbst verteidigen, und die einzige wirkliche Gefahr in meinem Leben, die geht von dir aus.«
Darauf stieg Stepan aus ihrem Bett, kleidete sich mit zitternden Händen an und sagte: »Ich geh dann also.«
Sie sprang auf und versuchte ihn zurückzuhalten. »Nicht, Stepan, nein, nein, ich hab’s nicht so gemeint, bleib bei mir, auch wenn es nur für kurze Zeit ist …«
Sie hängte sich an ihn, zerriss ihm das Hemd, aber er schob sie von sich. »Sei nicht so«, sagte er, »das passt nicht zu dir.«
Bevor Johanna danach wieder in Verzweiflung und Selbstmitleid versinken konnte, wurde sie mit der Feindseligkeit der Neuruppiner konfrontiert, die unkontrollierbar zu werden drohte.
Lina Burger hatte ein Teufelskind geboren, hieß es. Und Johanna sei schuld daran.
Die bedauernswerte Tagelöhnerfrau berichtete jedem, der es hören wollte – und immer mehr Leute wollten es hören –, sie habe von Anfang an gewusst, dass mit dem Kind in ihrem Leib etwas nicht in Ordnung sei, und sie erinnerte sich nun auch genau daran, dass in einer stürmischen Nacht im letzten November, als ihr Mann betrunken neben ihr schnarchte, etwas über sie gekommen sei, ein geifernder, stinkender Ziegenbock, der habe ihr einen seiner Hufe auf die Kehle gestellt, um sie am Schreien zu hindern, und dann sei er mit seinem glühend heißen Geschlecht in sie eingedrungen, mit tiefen wollüstigen Stößen, bis er dann plötzlich von ihr abgelassen und sich höhnisch meckernd davongemacht habe. Ob durch die Tür oder durch den Schornstein, das wusste sie leider nicht mehr. Aber von der eigentlichen Begattung wusste sie noch sehr viel, und sie wurde nicht müde, es den anderen Frauen in allen Einzelheiten zu schildern.
Danach habe sie zu Gott gebetet, die Teufelsbrut nicht in ihr wachsen zu lassen, und der Herr habe sie schließlich erhört und ihr Blutungen und vorzeitige Wehen geschickt. Aber dann sei die Witwe Wolters eingeschritten und die habe also das Teufelskind immer wieder zurückgetrieben in Linas Leib, habe es in seinem warmen Nest halten wollen, und schließlich, als Gott ärgerlich wurde und dem Teufel nicht den Sieg überlassen wollte, da habe die Wolters das Kind im Leib seiner Mutter festgebunden. Mit einer Schnur aus Schweinedarm! Sie, Lina Burger, habe die Schnur des Teufelskindes aufbewahrt, als Zeugnis für das Geschehen, und wer es sehen wolle, der sei jederzeit bei ihr willkommen.
Das ironische Gelächter, mit dem Johanna sich anfangs gegen das Gerede wehren wollte, verging ihr spätestens an dem Tag, als sie bei hellem Sonnenschein auf offener Straße von mehreren schreienden Frauen angegriffen wurde. Sie stießen sie hin und her, zerrten an ihren Kleidern und schrien immer wieder: »Teufelshure, Teufelshure!« Wäre nicht ein Beerdigungszug vorbeigekommen, mit Totenwagen und Pastor und einer Gemeinde von mindestens fünfzig Trauernden, dann hätte dieses bösartige Weibergerempel wohl schlecht enden können.
Es war August und sehr heiß. Die fremden Erntehelfer waren wieder in der Stadt, es wurde vierzehn Stunden am Tag und, wenn der Mond schien, auch noch des Nachts geschuftet und dazu viel Bier und Schnaps getrunken. Die polnischen Arbeiterinnen, die mit hochgerafften Röcken und halboffenen Miedern beim Binden und Aufbocken die Getreidegarben umarmten, heizten die Phantasien der kleinstädtischen Männer an. Der Alte Rhin führte nur noch sehr wenig Wasser, und aus der Abdeckerei des Kurt Neusiedler stank es kaum noch, weil der Unrat sogleich austrocknete.
Das Getreide stand zwar hoch und dicht, aber die Ernte war nicht gut: viel leere Halme und seltsam verschrumpelte schwarze Körner. Eine Fäulnis, ein seltenes Ungeziefer, oder vielleicht doch der Teufel?
Am späten Abend nach dem Weibergeschrei versammelten sich ein paar randalierende Männer vor Johannas Haus, sie pissten gegen die Tür und grölten, die Teufelshure solle herauskommen, sie wollten ihr zeigen, dass ein richtiger Mann es leicht mit dem Teufel aufnehmen könne. Sie zertrampelten Johannas Kräutergarten und steckten anschließend einen der beiden Eibensträucher in Brand. Und morgen würden sie wiederkommen, schrien sie, und dann würde mehr brennen als ein Eibenbusch.
Johanna hatte Angst, und ihre Angst trieb sie zu hektischer Betriebsamkeit. »Wir müssen weg von hier«, verkündete sie, »ich hab ja schon immer gesagt, dass ich hier nicht bleiben werde.«
Olga, die von der Stimmung der Stadt nichts mitbekommen hatte, ging seelenruhig ihren üblichen Tätigkeiten nach. »Und ich und Alexej haben dir schon immer gesagt, dass wir hier bleiben müssen. Bis der Zar kommt.«
»Ich packe!«, schrie Johanna.
»Tu das, mein Täubchen. Aber pack nicht aus Versehen auch unsere Sachen ein.«
Ohne sich zu besinnen, wuchtete Johanna die große Kleiderkiste, in der sich außer Kleidern vor allem ihre Medikamente, die wenigen Bücher, die sie besaß, und die schwere verrostete Pistole ihres Vaters befanden, auf den Planwagen, dazu Bettzeug, einen dicken, geknüpften Teppich und den langen doppelten Pelzmantel, den ihre Eltern aus Russland mitgebracht hatten. Olga sah ihr zu und schüttelte kichernd den Kopf. »Ist aber Hochsommer, der heißeste August seit dem Tod von Zar Iwan!«
Als Johanna ihre Küchengeräte zusammensuchte, musste sie sich mit Olga um jedes einzelne Stück streiten. Zwar nahm die Alte Johannas Aufbruch nicht ernst, doch wollte sie auch im Spiel ihre Töpfe und Kochlöffel beisammen halten. Ganz vorn im Wagen, gleich hinter der Kutschbank, stapelte Johanna mehrere Ballen Stroh, unter denen sie ihren wichtigsten Besitz verbarg, die Gläser mit den Menschen- und Tierpräparaten und die Tasche mit den verbotenen chirurgischen Instrumenten.
»Gut, gut«, sagte Olga, »das Teufelszeug muss weg.«
»Gib mir Geld, Olga«, sagte Johanna.
»Aber sicher, mein Täubchen. Willst du dir endlich ein Hochzeitskleid kaufen?«
Johanna hatte sich bislang nie um Geld gekümmert, sie hatte nicht einmal darüber nachgedacht. Sehr aufwändig war ihr Leben nicht gewesen, doch hatte sie immer alles gehabt, was sie brauchte. Zuerst unter der Obhut ihres Vaters, dann bei dem alten Lehrer und danach wieder in ihrem Elternhaus. Notwendige Bezahlungen erledigte Olga. Jetzt wunderte Johanna sich über den schweren Geldbeutel, den die Alte ihr in die Hand drückte.
»Woher hast du das alles, Olga?«
»Weißt du doch, Täubchen«, sagte Olga. »Und wenn du’s nicht weißt, dann willst du’s eben nicht wissen. Macht nichts, Hauptsache, man lässt uns nicht verhungern.«
Am Abend saß Johanna erschöpft in der Küche, verschränkte die Arme auf dem Küchentisch und bettete den Kopf darauf. »Stepan ist wieder weggelaufen«, sagte sie leise.
»Was, Täubchen?«
»Stepan …«, rief sie, »Stepan hat mich verlassen.«
»Leider nicht, Täubchen!«
Johanna sah auf. »Mama«, sagte Schura, »die anderen Jungen glauben, du bist eine Hexe.«
»Lass sie reden, kümmere dich nicht drum. Wir gehen bald weg von hier.«
»Wir gehen nicht. Und ich hab zu den anderen gesagt, dass du eine Zariza bist und ich ein Zarewitsch. Und die Jungen wussten nicht, was das ist. Ich hab’s ihnen erklärt, und da wollten sie mich schlagen.«
»Und?«
»Ich kann mich gut wehren!«, sagte das Kind stolz.
Johanna verriegelte die Tür, legte die Läden vor und schickte den Jungen ins Bett.
Bald darauf klopfte es. Johanna öffnete nicht. Das Klopfen wurde dringlicher und steigerte sich schnell zu einem wütenden Rütteln. Da rollte Schura schlaftrunken von seinem Lager, schrie: »Mama, Mama, der Zar kommt, warum öffnest du denn nicht?« und hatte schon den Riegel zurückgeschoben.
Es war Margarete Ansbach, die rasch eintrat und die Tür hinter sich zuwarf.
»Sie bringen mich in Verruf, Witwe Wolters«, schalt sie, »seit wann verschließen Sie des Nachts Ihre Türe und lassen mich draußen warten?«
Johanna fasste sich schnell. »Was gibt’s, Frau Margarete, was kann ich für Sie tun?«
»Für mich überhaupt nichts. Aber für sich selbst und für den rothaarigen Teufel.«
»Meine persönlichen Angelegenheiten gehen Sie nichts an.«
»Wohl wahr. Aber Sie sind ja keine schlechte Person, und ich meine es gut mit Ihnen. Die Stimmung in unserer Stadt ist gefährlich überreizt – die Trockenheit, die schlechte Ernte, die Hitze. An irgendetwas müssen die armen Leute hier ihre Wut doch auslassen. Und Sie bieten so eine schöne Angriffsfläche. Nicht nur, dass Sie ein Teufelskind in die Welt geholt haben, auch der Teufel höchstpersönlich hat wieder bei Ihnen Quartier bezogen.«
»Der, den Sie den Teufel nennen, ist längst über alle Berge. Ich hab ihn weggeschickt.«
»So, haben Sie das? Und wie ist es dann möglich, dass er immer noch die Hinterhöfe unsicher macht? Man kann trotz der Hitze des Nachts die Fenster nicht mehr offen stehen lassen, weil er heiße Schwefeldämpfe in die Schlafzimmer bläst, um die Weiber zu unsittlichen Handlungen zu verführen. Grad eben hab ich ihn gesehen. Er kam vom See herauf und zerrte einen Karren hinter sich her.«
»Hier … mit einem Karren? Nein, nein, Frau Margarete, Sie haben sich geirrt in der Dunkelheit. Ich habe ihn fortgejagt, und er wird nie wiederkommen. Die Weiber in der Stadt brauchen sich nicht mehr nach ihm zu sehnen – genauso wenig wie ich.«
Plötzlich brach Johanna in Tränen aus. »Und ich brauche auch niemanden«, schluchzte sie, »ich komme sehr gut alleine zurecht.«
»Sie wissen ja überhaupt nicht, was Sie wirklich brauchen und wollen! Deshalb sag ich’s Ihnen jetzt: Sie brauchen dringend einen Ortswechsel. Sie wollen Ihren Hausrat auf den großen Wagen laden und unsere Stadt verlassen. Dann ist endlich wieder Ruhe. Und der Teufel wird seiner Hexe folgen und aufhören, unsere Weiber hier verrückt zu machen. Als Frau des Bürgermeisters muss ich mich doch verantwortlich fühlen, zumal mein Gatte momentan etwas … etwas abgelenkt ist.«
Schura zerrte an Johannas Arm. »Mama, sie will uns aus unserem Haus verjagen!«
»Nicht verjagen, liebes Kind«, sagte Frau Margarete ungewohnt sanft, »ich rate deiner Mutter nur zu einer längeren Reise.«
»Das geht nicht, weil ich hier bleiben muss. Sonst kann mich Zar Peter nicht finden.«
Margarete lächelte. »Das versteh ich gut. Wenn man an ein Wunder glaubt, dann muss man dafür bereit sein. Aber du könntest in der Zwischenzeit bei mir wohnen, in meinem Haus. Und wenn der Zar kommt, dann werden wir es ganz gewiss bemerken.«
»Wir haben doch unser eigenes Haus!«
»Ja sicher. Doch wenn man es euch anzündet und es in Schutt und Asche versinkt, dann habt ihr es nicht mehr!«
Johanna hatte die Frau des Stadtmedicus noch nie lächeln sehen. Es gefiel ihr ganz und gar nicht. »Bitte gehen Sie jetzt, Frau Margarete. Ich will nicht, dass Sie meinem Sohn Angst einjagen.«
»Ich will Sie doch nur warnen. Wer sich mit dem Teufel einlässt, lebt nahe am Feuer. Und Ihr Sohn kann schließlich nichts dafür.«
Im Hinausgehen bedachte sie Schura noch einmal mit einem Lächeln. »Ich hätte sogar ein Zimmer für dich, mit einem schönen weichen Bett und vielen Spielsachen. Es ist unser Kinderzimmer, aber es hat noch nie ein Kind darin gewohnt.«
Johanna knallte die Tür hinter ihr ins Schloss und schob zwei Riegel vor. »Olga«, schrie sie, »Olga, steh endlich auf. Wir verlassen noch heute Nacht diese Stadt.«
Olga kam herangeschlurft. Sie trug ein leinenes Nachthemd und hielt sich an ihrem silbernen Doppelkreuz fest. »Was hast du denn, Täubchen, reg dich nicht auf. Da ist noch heißes Wasser auf dem Herd, ich mach dir einen Kräutertee.«
Johanna ließ sich auf einen Küchenstuhl fallen. »Dieses Weibsbild …«, schluchzte sie, »diese ausgetrocknete Ansbacherin, ich hab ihr doch überhaupt nichts getan!«
»Ja, ja«, sagte Olga, »so geht’s im Leben.«
»Sie hat ein Kinderzimmer für Schura!«
»Weiß schon, hat sie mir auch gesagt. Ist doch besser, als wenn er auf dem Stroh im Planwagen schlafen muss. Nun trink mal, Täubchen. Danach wirst du gut schlafen. Ich hab einen Kräuterschnaps reingegeben. Und morgen kannst du dann die Stute anspannen, die muss sowieso endlich etwas zu tun kriegen.«
Johanna schlief lange und tief. Im Traum sah sie Stepan auf dem Dach ihres Hauses herumspringen, und sie hörte ein fröhliches Schieben und Schlurfen und Klatschen. Der Traum gefiel ihr, sie wollte ihn nicht loslassen. Am späten Vormittag jedoch zerriss das schöne Gespinst – brutal wurde Johanna in die Wirklichkeit zurückgestoßen: Neuruppin brannte. Und das Feuer, das mit rasender Geschwindigkeit um sich griff, hatte just in dem Teil des Städtchens begonnen, in dem Johannas Haus stand – wer weiß, vielleicht sogar in ihrem Garten, wo von den zwei geschnittenen Eibenbüschen nur noch einer stand.
Man schrieb den zwölften August 1699, jenes Datum, das später den ersten großen Neuruppiner Brand markieren sollte. Hundertdrei Gebäude fielen ihm zum Opfer, darunter auch das Heilig Geist Hospital, was mehr als alles andere für eine Beteiligung höllischer Mächte an dem Unglück sprach.
Die einzigen Häuser, die im westlichen Teil der Stadt dem Feuer widerstanden, waren das Haus des Stadtmedicus und das Meller-Haus. Zwar tobten die Flammen durch Johannas Garten und loderten wie mit Drachenzungen zum Haus hin, um es, genau wie die umliegenden Häuser in Besitz zu nehmen, aber es gelang ihnen nicht. Denn oben auf dem Dachfirst sprang der Teufel herum, er spielte mit dem Feuer, ließ es immer wieder auf Reichweite herankommen, um es dann höhnisch lachend zurückzujagen. Der Herr der Finsternis beschützt die Seinen, solange sie ihm nützlich sind.
Als Johanna von den schrill läutenden Feuerglocken aus dem Schlaf geschreckt und zu sich gekommen war, stürzte sie sogleich und ohne noch eine Sekunde zu überlegen in den Stall, schirrte die Stute an und jagte sie mitsamt dem Planwagen durch die brennenden Gartenbüsche hindurch aufs freie Feld.
Zitternd und schreiend stolperte Olga hinter ihr her und zerrte den widerstrebenden Schura mit sich.
Da stand der Planwagen dann, auf Hoppenraths frisch abgeerntetem Feld, hinter der großen Getreidemiete.
Die Stute begann den Boden nach vergessenen Ähren abzusuchen. Olga jammerte und verfluchte die besoffenen Männer, die an dem ganzen Unglück schuld seien, und Schura machte sich heimlich davon. Hoch oben auf dem Kutschbock hockte Johanna, immer noch zitternd und außer Atem. Jetzt, da keine unmittelbare Gefahr mehr drohte, war sie wie gelähmt vor Entsetzen. Wenn das Feuer nur ihr gegolten hatte, und daran zweifelte sie nicht, warum hatten dann die Neuruppiner ihre eigenen Häuser nicht geschützt, warum konnten sie zulassen, dass aus einer Racheaktion gegen eine Einzelne eine so gewaltige Feuersbrunst wurde?
Und wo war Schura? Sie sprang vom Wagen und wollte zurücklaufen, um ihn zu suchen. Aber Olga hängte sich mit der Kraft einer Furie an sie.
»Du bleibst jetzt hier!«, schrie die Babuschka, »wenn du gehst, gehe ich mit. Und dann sag ich den Leuten, dass ich das Feuer gelegt habe, und dann wirst du erleben, was sie mit mir machen. Dein Sohn ist zum See gelaufen, ich habe es gesehen.«
»Du lügst! Schura ist in allergrößter Gefahr.«
»Die Einzige, die hier in Gefahr ist, bist du! Sie werden dich lynchen, wenn du jetzt gehst, und mich mit. Und dann hat unser Söhnchen niemanden mehr.«
Johanna begriff immerhin, dass sie sich jetzt nicht zeigen durfte. Und sie vertraute auf Schuras Vernunft, er war ja kein kopfloser Draufgänger.
Sie sah, wie die Menschen in wilder Panik umherliefen, sie schienen nicht zu wissen, was sie zuerst tun sollten, ihre Habseligkeiten und das Vieh aus den Häusern retten oder gegen das Feuer ankämpfen. Weil es nicht genügend Wasser im Ort gab, versuchten einige Bürger, eine Eimerkette bis hinunter zum See zu bilden. Aber es ging ihnen zu langsam, der Weg war zu weit, und die Menschen zu ungeduldig. Viele blieben nicht in der Kette stehen, sondern rannten wieder davon, um nach einer anderen Möglichkeit zu suchen.
Der dichte Rauch, aus dem heraus wütende Flammen schlugen, verdeckte Johanna die Sicht auf ihr Haus, das sie vor allen anderen verloren glaubte. Doch jedes Mal, wenn ein Windstoß eine Schneise in den Rauch blies, erkannte sie, dass die Mauern noch standen. Und einmal meinte sie sogar, Stepan auf dem Dach nahe dem Schornstein stehen zu sehen und aus einem großen Eimer Wasser über das Reet zu gießen.
Am frühen Abend endlich kam alles zur Ruhe. Schwerer dunkler Qualm lag über der Stadt. Die unmittelbare Gefahr schien gebannt. Johanna schüttelte Olga ab, die sie immer noch festhalten wollte, und lief zurück in die Stadt, entschlossen, ihren Sohn zu finden.
Schon von weitem sah sie, dass ihr Haus noch stand. Dort aber, wo zuvor ihr sorgsam gepflegter Kräutergarten gewesen war, hatte sich eine Menschenansammlung gebildet, Männer mit Sensen und Sicheln, Frauen mit Schlagstöcken, dazu ein paar wild umherrennende Kinder. Ihr Sohn war nicht dabei. Die Haustür stand weit offen, lärmende Weiber schleppten Johannas Hausrat auf die Straße, sie zertrümmerten das Geschirr, zerschlugen die Möbel und warfen alles auf einen großen Haufen.
Kopflos vor Wut und Zorn wollte Johanna sich in die Menge stürzen, um zu retten, was zu retten war, doch kam sie gerade noch rechtzeitig zur Vernunft und begriff, in welcher Gefahr sie sich selber befand. Sie verbarg sich hinter einer zusammengestürzten Mauer und sah dem Zerstörungswerk zu. Die Fenster wurden eingeworfen und die Fensterrahmen und -läden herausgebrochen, die Türen aus den Angeln und das Stroh vom Dach gerissen. Eine ungeheure Energie ging von diesen Menschen aus, so als verteidigten sie ihr Leben gegen eine tödliche Gefahr, die in den Mauern des Meller-Hauses lauerte. Sie feuerten einander an, einige brüllten sogar kämpferische Kirchenlieder. Vier der Männer hatten das große Kreuz aus der Kirche herbeigeschleppt, und als der hoch aufgeschichtete Gerümpelhaufen schließlich in Flammen aufging, schwenkten sie das Kreuz vor dem Feuer hin und her und flehten den Herrgott an, dem Beelzebub nun endlich das Handwerk zu legen.
Johannas Angst um ihren Sohn nahm ihr fast den Verstand. Zwar war er kräftig und geschickt und ließ sich nicht so leicht einfangen, aber falls sie ihn doch erwischten, würden sie ihn womöglich zuoberst auf den Scheiterhaufen werfen. Dieser Gedanke ließ sie alle Vorsicht vergessen. Mit wütenden Sprüngen näherte sie sich der randalierenden Menge.
»Ihr Schweine«, schrie sie, »ihr verdammtes Pack, wohin habt ihr meinen Sohn verschleppt? Der Herrgott wird euch strafen und mit Krankheiten überschütten und euer gerettetes Vieh wird eingehen und der Schwarze Tod wird über euch alle kommen.«
Im ersten Moment waren die Tobenden so verdutzt, dass sie kurz innehielten, es schien sogar, als würde die Stimmung umkippen und die blinde Wut in sich zusammenfallen. Ein paar Frauen begannen zu heulen, und die Männer ließen die Waffen sinken. Johanna jedoch fühlte sich plötzlich am Arm gerissen und zurückgestoßen aus dem Schein des Feuers hinter eine Mauer, und von dort aus in eine Hintergasse.
»Dein Sohn ist in Sicherheit!«, zischte Stepan, »aber dich werden sie gleich in Stücke reißen, wenn du dich weiterhin wie eine Rachegöttin aufführst.«
»Stepan …«, ächzte sie und stolperte hinter ihm her durch verkohltes Gerümpel und halb eingestürzte Mauern. »Was hast du da oben auf dem Dach gemacht?«
»Beeil dich, lass die dummen Fragen. Der Zorn des Pöbels ist noch nicht verrauscht. Sie brauchen dich, und sie werden dich lynchen!«
»Aber Schura, wo ist Schura?«
»In Sicherheit, hab ich doch gesagt.«
»Und Olga?«
»Ist inzwischen bei ihm. Du hättest sie sowieso nicht mitnehmen können.«
»Wenn’s keine Sicherheit für mich gibt, gibt es auch keine für Schura und Olga!«
»Die Hexe bist doch nur du, nicht dein Sohn. Der ist ein unschuldiges Kind. Und Olga ist eine verrückte Alte. Und die Ansbacherin, die wollte schon immer einen Sohn. Sie wird sich um ihn kümmern!«
»Nein!«, schrie Johanna und versuchte sich von ihm loszureißen. Stepan jedoch hielt sie eisern gepackt und zerrte sie weiter hinter sich her, bis zum Berliner Tor.
Plötzlich sah sie in der Dunkelheit den Planwagen mit der Stute davor. Das Tier wandte ruhig den Kopf um, als es die schnellen Schritte hörte.
»Wie kommt mein Wagen hier ans Tor?«, fragte Johanna verwirrt.
»Ich hab ihn hergeführt. Los, rauf mit dir auf den Kutschbock. Hörst du denn nicht das Wutgeschrei, die Leute sind wieder zu sich gekommen, sie werden kurzen Prozess mit dir machen. Darauf kannst du dich verlassen!«
Kaum hatte Stepan Johanna auf den Bock geschoben und ihr die Zügel in die Hand gedrückt, da riss er sich seinen Gürtelriemen von der Hose und schlug damit wie rasend auf den Rücken der Stute ein. »Hüa, hüa«, schrie er, »altes träges Vieh, renn, was du rennen kannst, vielleicht schaffst du es ja, deine Herrin zu retten.«
Und die Stute, aufgeschreckt von den ungewohnten Schlägen, rannte in wilder Panik davon. Johanna hockte auf dem Kutschbock des heftig rumpelnden Planwagens, hilflos und unfähig, das Geschehen zu meistern. Ein letzter Ruf von Stepan: »Und dass du ja nicht zurückkommst! Dein Sohn wird’s dir später danken.«
Die Zügel rutschten ihr aus den Händen, sie zog die Knie hoch, rollte sich auf dem Kutschbock zusammen und ließ die Stute laufen. Die würde ihren Weg schon finden.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Johanna ihre Umwelt wieder wahrnahm. Die Stute wurde langsamer, fiel in einen nachlässigen Trab und dann in Schritt. Mit heftigen Bewegungen schüttelte sie sich den Schaum vom Maul. Dann entdeckte sie ein kleines Gewässer, zerrte den Wagen dorthin, blieb stehen und neigte den Kopf, um zu trinken.
Aus der plötzlichen Stille wuchsen langsam die Geräusche des Waldes.
Johanna richtete sich auf, drückte das Kreuz durch und zuckte mit den Schultern, als ob sie etwas abschütteln wollte. Es war geschehen, was sie schon immer befürchtet hatte, die durch die Hitze und die ungewöhnlich schlechte Ernte angestaute Wut der Neuruppiner hatte sich ein Ventil gesucht. Und da die Hexe und der rothaarige Teufel so offensichtlich vorhanden waren, machten die ohnmächtigen Menschen sie nun zum Anlass allen Unheils.
Der Gedanke an den roten Teufel brachte Johanna nun vollends zu sich selbst zurück. Was hatte Stepan auf ihrem Dach gemacht? Hatten die Sterne ihm den Brand vorhergesagt, und hatte er darum schon Nächte zuvor das Strohdach befeuchtet und große Mengen Wasser bereitgestellt? Wie sonst war es erklärlich, dass ihr Haus als einziges den Flammen hatte standhalten können?
Doch wenn das wirklich so war, dann hatten die Sterne offenbar vergessen, Stepan darauf hinzuweisen, dass menschliche Wut mindestens so zerstörerisch sein konnte wie eine Feuersbrunst.
Alles, was er noch hatte tun können, war, sie fortzujagen.
Und Schura? Und Olga?
Stepan hatte gesagt, Schura sei in Sicherheit. Er hatte die Ansbacherin erwähnt. Die Ansbacherin würde sich kümmern, hatte er gesagt, weil sie sich schon immer ein Kind gewünscht hätte. Die Frau des Stadtmedicus hatte ihr den Sohn gestohlen!
Die Erkenntnis traf Johanna wie ein Messerstich. Wut fiel über sie her. Sie würde sofort umkehren, nach Neuruppin fahren, direkt vor das Medicus-Haus in der Schulzenstraße, und sich ihren Sohn zurückholen.
Sie zerrte am Zügel, um die Stute wieder vom Wasser wegzutreiben, und als die Widerstand leistete, sprang sie ungeduldig vom Kutschbock. Doch bevor sie noch das Zaumzeug ergreifen konnte, wurde sie auf ein Geräusch aufmerksam, das, so leise es war, zu ihr durchdrang, weil es sich von den Waldgeräuschen unterschied. Erst hörte sie ein leises Wimmern, kurz darauf ein zartes Geplärre, dann kräftiges Babygeschrei.
Gab es hier irgendein Tier, das menschenähnliche Geräusche von sich gab? Oder hatte etwa jemand sein Baby am Bach liegen gelassen? Das Geschrei kam aber keineswegs vom Waldboden her, sondern direkt aus dem Inneren des Planwagens. Und als Johanna nachsah, entdeckte sie zwischen Hausrat und Bettzeug ein fest gewickeltes Bündel, aus dem ein vor Zorn und Hunger rot angelaufenes Gesichtchen schaute: Lina Burgers Teufelskind.
Neben dem Baby lag ein Stapel sauberer Tücher, und, sorgfältig in einer Ecke, vor dem Umkippen geschützt, stand eine Kanne voll mit Milch. Sonst nichts, keine Bitte, keine Nachricht.
Als sie das Baby hochnahm, hörte es sofort auf zu schreien und sah Johanna mit großen dunklen Augen an.