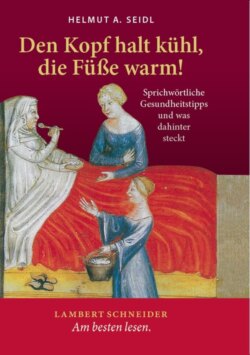Читать книгу Den Kopf halt kühl, die Füße warm! - Helmut A. Seidl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеKopf kalt, Füße warm, macht den besten Doktor arm. Wer hat nicht schon diese populärste deutsche Gesundheitsregel oder eine ihrer zahlreichen Varianten gehört? Doch was wird in dem Reim eigentlich genau empfohlen und warum sollte man sich so verhalten? Diese Fragen stellen sich für manch alte und auch neuere Sprüche zum Thema Gesundheit/Krankheit.
Was es nun mit den interessantesten Gesundheitstipps des deutschen Volksmunds aus den letzten 500 Jahren auf sich hat, wird nachfolgend zu klären versucht. Es geht dabei ausschließlich um Sprichwörter, die einen Rat zum Erhalten oder Erlangen der Gesundheit geben, mithin um „medizinische Sprichwörter“.
Da sich viele Medizinsprichwörter der Neuzeit noch auf das hippokratische Lehrsystem stützen, ist zu deren Verständnis eine knappe Darstellung der Grundzüge dieser „Humoralpathologie“ unabdingbar. Humores sind die „Säfte“ und so ist die auf den griechischen Arzt Hippokrates (460 v. Chr. – etwa 377 v. Chr.) und seine Nachfolger zurückgehende Lebens- und Krankheitslehre vom Säftekonzept bestimmt. Danach gibt es mit Blut, Schleim, gelber und schwarzer Galle vier Körpersäfte, die im richtigen Verhältnis zueinander vorhanden sein müssen. Ist dies nicht der Fall, liegt eine Krankheit vor. Die ursprüngliche Harmonie und mithin eine Gesundung suchte man z.B. durch künstlich herbeigeführte Ausscheidungen wie Aderlass oder Abführen wieder zu erlangen. Im „Corpus Hippocraticum“ ging man ferner davon aus, dass bei einem Menschen „Lebenswärme“ und „Feuchtigkeit“ mit fortschreitendem Alter abnehmen. Sind beide aufgezehrt, kommt es zum Tod. Daher galt es etwa, alten Leuten Wärme, z.B. durch eine Ofenbank, und Feuchtigkeit, z.B. in Form von Wein, zuzuführen. Es herrschte demnach das Prinzip: Ausgleich durch Gegenteiliges. Die Hippokratiker hatten zudem eine aus der Gesamtheit ihrer Theorien resultierende Diätetik, in deren Mittelpunkt das Schema der sex res non-naturales stand, also der sechs nichtnatürlichen Dinge: Licht und Luft, Speis und Trank, Arbeit und Ruhe, Schlaf und Wachen, Ausscheidungen und Absonderungen, Anregungen des Gemüts. Bei diesen sechs Lebensbedingungen war das richtige Maß ausschlaggebend. Die Quintessenz einer solchen Diätetik ließe sich treffend mit dem Sprichwort Wer ein langes Leben will erringen, halte Maß in allen Dingen umschreiben.
Als einschlägige Primärquelle sind in dieser Publikation die sogenannten „Aphorismen des Hippokrates“ herangezogen worden, die im Mittelalter die Grundlage für den Medizinunterricht bildeten und als Brevier ärztlichen Wissens dienten.
Ausgebaut wurde die hippokratische Lehre insbesondere durch Galen(os) von Pergamon (129–199), der zeitweise Leibarzt des römischen Kaisers Mark Aurel war. Durch seine zahlreichen Schriften begründete er den „Galenismus“ und verfeinerte den Hippokratismus z.B. durch die Zuordnung von Eigenschaften bzw. Qualitäten wie „feuchtwarm“ oder „kalttrocken“. So passten etwa Nüsse ideal auf Fisch, da man sie als „warm“ und Fische als „kalt“ einstufte: Auf Fische ist die Nuss ein Gegengift. Die wichtigsten Dogmen Galens wurden um 1190 von Moses Maimonides in den „Flores Galeni“ zusammengefasst, die im Mittelalter als medizinisches Repetitorium den „Aphorismen des Hippokrates“ kaum nachstanden und auf die hier ebenfalls zurückgegriffen wird.
Tradiert und gleichfalls erweitert hat die hippokratische bzw. galensche Medizin der Perser Avicenna (980–1037) alias Ibn Sina. Er war es auch, der Noah Gordon als Vorbild für den Weltbestseller „Der Medicus“ diente. Avicenna hatte selber einen ungleich bedeutenderen Bestseller verfasst: den „Canon Medicinae“. Dieser war das ganze Mittelalter hindurch das einflussreichste Lehrbuch morgen- wie abendländischer Medizin gewesen. Von den fünf Büchern ist hier das erste und einflussreichste einer Überprüfung im Hinblick auf eine Relevanz für Gesundheitssprichwörter unterzogen worden. Letzteres gilt auch für Avicennas berühmtes „Lehrgedicht über die Heilkunde“.
Ein anderes hier herangezogenes Lehrgedicht, das „Regimen Sanitatis Salernitanum“, entstand um 1100 im süditalienischen Salerno an der Schola Salernitana, der neben Montpellier wohl bedeutendsten Medizinhochschule des Mittelalters. Es wurde in der Folgezeit ständig erweitert und in fast alle europäischen Landessprachen übersetzt. Jahrhundertelang dienten die auf dem Hippokratismus fußenden „Salernitanerregeln“ Ärzten wie Laien als Vademecum der Diätetik. Daher leiten sich viele medizinische Sprichwörter von diesem „Flos Medicinae“ ab. Darunter ist z.B. der noch heute allseits bekannte Spruch: Nach dem Essen soll man ruh’n oder tausend Schritte tun.
Erst mit der Entdeckung des Blutkreislaufs durch den Engländer William Harvey (1578–1657) im 17. Jahrhundert ließ sich die „Säftetheorie“ bzw. der Galenismus allmählich nicht länger aufrechterhalten. Die beiden populärsten Gesundheitsbücher der Goethezeit sind allerdings immer noch stark von hippokratischem Geist durchdrungen. Bernhard Christoph Fausts (1755–1842) „Gesundheits-Katechismus“ war dabei in ganz Europa nicht minder erfolgreich als Christoph W. Hufelands (1762–1836) berühmtes Hauptwerk „Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern“ (ab 1805 mit dem Titel „Makrobiotik“).
Der Untertitel dieses Buches „…und was dahintersteckt“ verweist auf den Hauptzweck: Es wird aufgezeigt, wie es zu den Gesundheitstipps kam bzw. welche Lehren, Konzepte, Anschauungen oder sprachlichen Aspekte dabei zugrunde lagen. Ob die Empfehlungen aus Sicht der heutigen Medizin gerechtfertigt sind oder nicht, ist indes nicht Gegenstand dieser Publikation, auch wenn hie und da darauf eingegangen wird. Insofern ist das vorliegende Buch keineswegs ein „medizinischer Ratgeber“. Es handelt sich vielmehr um eine interdisziplinäre Pionierarbeit für ein breites Publikum, die Erkenntnisse aus der Medizin- und Kulturgeschichte, der Volksmedizin, der Volkskunde sowie der Sprichwortforschung zu gewinnen und auf unterhaltsame Weise erstmals zu aufschlussreichen Synthesen zusammenzufügen trachtet.