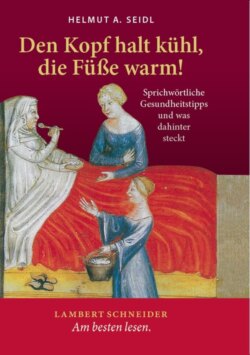Читать книгу Den Kopf halt kühl, die Füße warm! - Helmut A. Seidl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Sparsamer Sex und häufiges Händewaschen – Körper und Körperteile
ОглавлениеSex ist gesund heißt es in einem modernen Sprichwort. Modern muss es schon allein wegen „Sex“ sein, denn der Ausdruck fand erst im 20. Jahrhundert über das Englische Eingang in die deutsche Sprache.
Was heute als „Sex“ bezeichnet wird, nannte man früher meist „Wollust“. Damit war die übermäßige geschlechtliche Begierde bzw. die oftmalige Befriedigung derselben gemeint. Ein Geschlechtsverkehr sollte nämlich ausschließlich Fortpflanzungszwecken im Rahmen einer Ehe dienen: Liebe führt zu Erben, Wollust ins Verderben. Was die Erfüllung dieser ehelichen Pflichten betrifft, so sah der Volksmund einmal pro Woche als angemessen an: Gut dem, der täglich geht aufs Häuschen und alle Wochen einmal aufs Mäuschen. Mit „Häuschen“ bezog man sich auf den Abort, mit „Mäuschen“ auf die Ehefrau. Doch schon zu Luthers Zeiten hielt man hier eine Verdopplung für angebracht: Die Woche zwier, der Weiber Gebühr, schadet weder mir noch dir, macht’s Jahr einhundertundvier. Laut einer Online-Befragung bei Paaren wird auch heute noch nach dieser sprichwörtlichen Empfehlung verfahren: „Zweimal pro Woche oder 104 Mal im Jahr kommen sie sich körperlich näher.“
Das wäre für die Dogmatiker der hippokratischen Schulmedizin schon zu viel des Guten gewesen, mahnten sie doch eindringlich und immer wieder zu Mäßigung beim Sex. Galenos von Pergamon warnte in diesem Zusammenhang vor einer Vergeudung wertvoller Körpersäfte und einer Schwächung des Leibes; er erblickte darin die Gefahr eines vorzeitigen Alterns. Seine Ansicht teilte die Ärzteschaft bis weit ins 19. Jahrhundert. So schrieb etwa Goethes Leibarzt Hufeland zu „Ausschweifungen in der Liebe – Verschwendung der Zeugungskraft“ Folgendes: „Von allen Lebensverkuerzungsmitteln kenne ich keins, was so zerstoerend wirkte, und so vollkommen alle Eigenschaften der Lebensverkuerzung in sich vereinigte als dieses.“ Kein Wunder, dass das seinen Niederschlag im Volksmund fand: Wer lange will leben, muss sparsam lieben bzw. Wer sich nahe hält zum Tisch und fern von den Frauen, der kann ein langes Leben schauen oder Wollust verkürzt das Leben. Des Weiteren hieß es: Schenke Wollust ein, so trinkst du Pein oder Wollust ist ein böser Zundel. Letzteren, eine Art Feuerschwamm, benutzte man vor der Erfindung des Streichholzes als Anzünder. Was mit der Wollust alles entfacht werden kann, besagt ein Spruch aus dem 16. Jahrhundert: Vier ding ergehn aus der wollustigkeit: leibs- vnd seelenbefleckung, sinnen- vnd gsichtsschwächung, erbguets verweigerung, alters eezeitliche nahung. Man konnte also angeblich nicht nur körperlichen, sondern auch seelischen Schaden davontragen.
Das war vom medizinischen Standpunkt aus erst recht bei der Selbstbefleckung der Fall, und zwar bei Mann wie Frau. So ist in einem einst sehr populären „Handbuch der Frauenzimmerkrankheiten“ vom Jahre 1790, verfasst von Johann V. Müller, zu lesen:
Es giebt eine Gattung von Auszehrung welche von jugendlichen Ausschweifungen entsteht, wenn wollüstige Jünglinge, entweder durch einen unzeitigen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, oder durch die noch weit verderblichere Selbstbefleckung, alle ihre guten Säfte und Lebenskräfte zugesetzt haben … Allein auf der andern Seite herrschen auch unter dem schönen Geschlecht eine grosse Reihe dergleichen Uebel, welche aus der Selbstbefleckung entspringen, und dergleichen üblen Folgen ist das weibliche Geschlecht so gut als das männliche ausgesetzt, und noch viel mehr. Denn ausser der Selbstbefleckung mit der Hand giebt es noch eine andere Art der Befleckung unter ihnen, welche mit der weiblichen Ruthe geschiehet. Dieses Laster gieng unter dem Frauenzimmer zu Rom, in demjenigen Zeitpuncte, da alle guten Sitten daselbst verbannet waren, sehr stark im Schwang … Es fanden sich Weiber, die stolz darauf waren, in gewissen Stücken den Männern zu gleichen, und aus dieser Ursache sich männlicher Verrichtungen anmaßten. In Griechenland hiessen sie Reiberinnen, Kratzerinnen – und auch noch zu unsern Zeiten, giebt es noch Ungeheuer dieser Art – und junge Frauenzimmer lassen sich desto williger von ihnen verführen … Und was sind die Folgen davon? … Nervenschwäche – Trübsinn – Niedergeschlagenheit – Schüchternheit der Seele und Auszehrung, welche solche unglückliche junge Schönen aufreibt … Ausserdem ist der in der Jugend durch die Selbstbefleckung erregte und unterhaltene Trieb zur Wollust, so zur Gewohnheit geworden.
Da man „Selbstbefleckung“ früher gemeinhin auf eine Stufe mit Geschlechtskrankheiten wie Tripper oder Syphilis setzte, ist sie auch sprichwörtlich verdammt worden, und zwar z.B. in Aussagen wie Davon geht das Rückenmark zurück!. Dergleichen wurde von der Schulmedizin untermauert, die sich hier auf antike Vorstellungen über die Herkunft des Samens berief. Für die Folgen des Onanierens gab es sogar eine eigene Krankheitsbezeichnung, zu der es in einem „Handbuch der Pathologie“ von J. N. von Raimann vom Jahre 1839 heißt:
Die „Rückendarre“ … ist streng genommen keine eigene Art der Auszehrungen, sondern eine bestimmte und zwar jene Modification der Nervenschwindsucht, welche von übermäßigen Ausleerungen des Samens sowohl durch Ausschweifungen im Beyschlafe, als vorzüglich durch Onanie, bey Personen beyderley Geschlechts entsteht. Sie wird schon von Hippokrates als blinde Abzehrung … beschrieben, und vom Rückenmarke abgeleitet.
Auf die besagte „blinde Abzehrung“ gehen auch landläufige Warnungen wie Onanie/Masturbieren/Selbstbefriedigung/Wichsen macht blind zurück. „Onanie“ leitet sich übrigens von der biblischen Gestalt des „Onan“ her, „masturbieren“ wird erst seit dem 19. Jahrhundert verwendet und kommt vom gleichbedeutenden lateinischen Verb „masturbari“, welches wiederum aus „manu stuprare“, d.h. mit der Hand schänden, hervorgegangen sein dürfte. „Wichsen“ schließlich ist erst im 20. Jahrhundert in der Umgangssprache ein Synonym für geschlechtliche Selbstbefriedigung geworden. Ansonsten war es eine Variante von „wächsen“ und bedeutete „blank putzen“. Der heute obsolete Begriff „Rückendarre“ bezeichnete eine Austrocknung des Rückenmarks bzw. des Samens. Dazu vermerkt „Pierer’s Universal-Lexikon“ noch im Jahre 1862: „Die Rückendarre kommt meist bei jungen Männern vor u. ist sehr häufig Folge geschlechtlicher Ausschweifungen … Außerdem tritt gern Lungenschwindsucht hinzu und tödtet unter den Zeichen der Schwindsucht, daher als ‚Rückenmarksschwindsucht‘ bezeichnet.“ So weit also die seinerzeitige Erklärung für den angeblichen Rückgang des Rückenmarks. Inzwischen „haben Sexualwissenschaftler längst bewiesen … Die Selbstbefriedigung – auch … ‚Autoerotik‘ genannt – ist in keiner Weise schädlich.“
Was nun die geschlechtlichen Ausschweifungen jedweder Art anlangt, so glaubte man einst (und teilweise immer noch), dass die Natur hier zumindest den Männern Grenzen gesetzt hat: Tausend Schuss und dann ist Schluss. Damit hatte man zwar einen schönen Volksreim, doch mit der vermuteten Mengenzahl des Spermavorrats lag man völlig falsch.
Was aber war zu tun, wenn man sich früher an medizinische und kirchliche Gebote halten und fleischlicher Begierde entsagen wollte? Auch hier wusste der Volksmund Rat: Vor der Frau Venus geile Sucht die best Arznei ist schnelle Flucht.
In der Antike hatte man noch versucht, sexuelle Begierde auf andere Art und Weise einzudämmen. So berichtet etwa Galen unter Bezugnahme auf Hippokrates von einem Mann, der eine verheiratete Frau verführt hatte. Als Sextherapie erhielt dieser – Schläge auf die Leber! Das machte insofern Sinn, als die Leber im Hippokratismus u.a. als Sitz der Leidenschaften, mithin der Wollust, galt. Anfang des 18. Jahrhunderts sah der thüringische Arzt Christoph Hellwig (1663–1721, ab 1713 von Hellwig) als Hauptursachen einer „allzugrossen Begierde zum Beyschlaff/und Geilheit“ Überfluss und Schärfe des Samens. Zur Bekämpfung dieser Sexsucht, also „wenn eine Manns-Person allzu hitzig ‚ad rem veneream‘, zum Beyschlaff ist“, kam für ihn ebenfalls eine Art Flucht bzw. Kontaktsperre in Frage: „Sonsten muß ein solcher Mann lustige Conversation, zumahl von galanten und beredtsamen Frauenzimmer[n], meiden.“ Das war jedoch nur eine von vielen angeführten Möglichkeiten. So empfahl er z.B.: „Darnebst gewöhne man sich die welcke Wurtzel des Knaben-Krauts/‚Satyrionis‘, zum öfftern einzunehmen/nicht aber die frische/welche das Wiederspiel wuercket.“
Vom „Beischlaf“ nun zum Schlaf im eigentlichen Sinne. Während ersterer, falls im Übermaß praktiziert, von Hufeland als größtes Lebensverkürzungsmittel bezeichnet wird, ist der Schlaf für ihn „das groeßte Retardations- und Erhaltungsmittel des Lebens“. Ähnlich positiv äußert sich der Volksmund: Ohne Schlaf und Ruh’ nimmt der Leib nicht zu. Die alte Schulmedizin, so etwa Galen, hielt den Schlaf übrigens deshalb für gesund, weil damit dem Körper notwendige Feuchtigkeit zugeführt werde, während man glaubte, Schlaflosigkeit führe zu einem Austrocknen. Doch auch beim Schlaf konnte man des Guten zu viel tun: Früh zu Bett und spät auf, macht einen kurzen Lebenslauf. Begründet wird das von Hufeland im hippokratischen Sinne: „Zu langes Schlafen haeuft zu viel ueberfluessige und schaedliche Saefte an.“ Sein Kollege Faust pflichtet ihm bei: „Kann man nicht auch zu viel schlafen, und schadet das? – Ja … und ein solcher langer Schlaf macht traege, dumm und ungesund.“ Das Volk brachte das in Form eines Chiasmus zum Ausdruck: Wer viel schläft, den schläfert viel.
Was aber ist hier das richtige Maß? Im Hauptwerk der mittelenglischen Literatur, den „Canterbury Tales“, spricht Geoffrey Chaucer von fünf Stunden. Ein altes englisches Sprichwort gesteht einem Mann sechs, einer Frau sieben Stunden Nachtruhe zu: Six hours for a man, seven for a woman, and eight for a fool. Das war für den rastlosen Napoleon Bonaparte (1769–1821) viel zu viel. Er soll die ihm bekannte Volksempfehlung folgendermaßen abgeändert haben: „Männer brauchen vier Stunden Schlaf, Frauen fünf und Idioten sechs.“ Der deutsche Volksmund postuliert eine generelle Schlafdauer ohne Ansehen der Person: Der Schlaf bei sieben Stund’ ist Jung und Alt gesund. Das entspricht der derzeitigen Praxis: „Die Schlafdauer hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auffallend verringert. Derzeit schlafen die Deutschen etwa sieben Stunden pro Nacht. Das ist über eine Stunde weniger als noch im Jahr 1991.“ Hier handelt es sich selbstredend um den Durchschnitt. Dass dieselbe Regel aber unterschiedslos für alle Altersstufen gelten sollte, wurde schon in verschiedenen Gesundheitsbüchern des 19. Jahrhunderts kritisch gesehen. Die Empfehlung in Reimform ist allerdings keine ursprünglich deutsche, sondern kommt – wie viele andere Gesundheitsregeln auch – von der Hochschule zu Salerno, die genau dasselbe einst auf Latein formulierte.
Beim Schlaf stellt sich aber nicht nur die Frage der Dauer. So soll dem Volksmund nach die Bettruhe unbedingt vor Mitternacht einsetzen: Eine Stunde Schlaf vor Mitternacht ist besser als zwei darnach bzw. Man kann nach Mitternacht nicht nachschlafen, was man vor Mitternacht versäumt hat. Erklärt wurde das von der alten Schulmedizin damit, dass der Lebensspender Sonne um Mitternacht am weitesten von der Erde entfernt ist und dieser Zeitpunkt daher am günstigsten für Ruhe und Erholung wie auch für die täglichen Ausdünstungen sei. Dem vermochte der Arzt Robert Rumpe im Jahre 1900 nicht mehr zu folgen:
Maßvoller Schlaf ist erquickend.
So sagt ein altes Wort: „Der Schlaf vor Mitternacht ist der beste“ … Wir fragen: Mit Recht? … Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, daß der Schlaf in seinem ersten Stadium am tiefsten und gesündesten ist, und daß der Schlaf um so leiser wird, d.h. um so eher durch äußere Sinneseindrücke beunruhigt werden kann, je länger er schon gewährt hat. Es ist dabei gleichgültig, zu welcher Stunde die Ruhe ihren Anfang nahm, ob um 9 Uhr Abends oder um Mitternacht, und insofern hat das genannte Volkswort keine präzise Berechtigung.
Dem pflichten heutzutage Schlafforscher insofern bei, als für einen erholsamen Schlaf nicht der Zeitpunkt, sondern das Erreichen von Tiefschlafphasen relevant ist.
Wie steht es dann mit einem Nickerchen zur Mittagszeit? Ist das der Gesundheit förderlich? Mitnichten, meint der Volksmund: Schlaf nach dem Mittagstisch ist so gesund wie fauler Fisch. Dieser Ansicht war schon Avicenna gewesen, der vor katarrhartigen Erkrankungen warnte, wenn man tagsüber schlief. Dem schloss sich die Hochschule von Salerno an, die ihren Lehrvers „Sit brevis aut nullus tibi somnus meridianus“, von dem das obige deutsche Sprichwort abgeleitet ist, in ähnlicher Weise begründet: Meid den schlaff zu Mittag, das Feber und unlust folgt jm nach, Wehtum des Haupts, der schnupff darzu, Diß brengt dir alles des Mittags ruh. Das wiederum ist eine bei uns ebenfalls sprichwörtlich gewordene alte Übersetzung einer weiteren Salernitanerregel. Gegen den Mittagsschlaf sprachen aber noch weitere Gründe, wie sie Oskar von Hovorka und Adolf Kronfeld in „Vergleichende Volksmedizin“ benennen:
Der Schlaf zur Mittagsstunde (bei entblößtem, der Sonnenhitze ausgesetzten Haupte) gilt mit Recht als nachteilig. Der mittägliche Schlaf (nach dem Essen) galt bereits im hohen Altertum als ungesund und gefährlich, weil während dieser Zeit Dämonen ihr Unwesen treiben sollen, z.B. der Dämon Meridianus im Psalm 90, 6. – So herrschte auch nach „Fränk. Merkur“ (1795, St. 39) in Bundorf bei Königshofen im Grabfelde die Sage vom gefährlichen „Unter“ oder der Mittagsstunde von 11–12, in welcher man den Spuk von Dämonen fürchten muß.
Offenbar war in den Mittelmeerländern weder diese noch die Furcht vor Krankheiten vorhanden, pflegt man doch dort seit jeher die Siesta. Für Südländer gilt also auch der deutsche Spruch: Ein Mittagsschläfchen tut der Gesundheit gut. Alten Leuten empfahl das sogar Galen, womit die Schola Salernitana ihm in diesem Punkt einmal nicht folgte. Die moderne Medizin hält es hier z.T. mit Galen und befürwortet ein erquickendes Mittagsschläfchen für alle. Dementsprechend verhalten sich die Deutschen, von denen inzwischen prozentual mehr dem Mittagsschlaf frönen als die Bewohner der Mittelmeerländer. Dieser sollte aber nicht allzu lang dauern, höchstens 30 Minuten, sonst greifen wiederum die alten Volksweisheiten Mittagsruh macht gern ein X für ein U bzw. Wer am Tage das Sofa gedrückt, den drückt nachts das Bett.
Wie beim Schlafen kann man auch beim Baden das Gegenteil des Gewollten erreichen. So lautet eine indirekte Warnung: Mancher ging ins Bad gesund und kam zurück als kranker Hund. Man konnte sich bei einem Badbesuch also Krankheiten einfangen, z.B. Hautekzeme oder gar die Krätze bzw. den Grind. So lautet eine Variante: Vielen geschieht, dass sie kräftig ins Bad fahren und räudig wieder heimkommen. Gemeint war damit das Aufsuchen eines öffentlichen Bades, wie das im Mittelalter in kleineren Orten meist samstags, in Städten an mehreren von der Obrigkeit festgesetzten Tagen üblich war. So heißt es spöttelnd in einem alten Liederbuch: „Es baden am Montag die trunckenen, am afftermontag die reichen, am mittwoch die witzigen, am Donnerstag die gryndig vnd lausig sind, am freytag baden die vngehorsamen, am samstag die hochvertigen.“ In einem anderen Lied, einem speziellen Badelied, das bei Karl F. W. Wander angeführt ist, erfährt man, dass die Leute in so einer öffentlichen Badstube nicht bloß im Badzuber saßen, um den Körper mit Wasser zu reinigen:
So man gen Bad sitzet ein, thut man krauen und kratzen fein, man pflegt auch zu schröpfen in dem Bad, damit man das böse Blut komm ab. Der Brauch im Bad ist auch der, dass man sauber zwag und scher. Eh’ man nun geht aus dem Bad, prusst man sich fein sauber ab.
Da bei diesem Anlass also zugleich Haupthaar und Bart geschoren wurden, bedurfte es nicht nur eines Baders bzw. Barbiers als Leiter einer Badstube, sondern auch einschlägigen Hilfspersonals. Eine Breslauer Bader-Innung vom Jahre 1487 nennt als solche u.a. Scherer, Lasser (d.h. Aderlasser), Badeknechte, Tschurer (d. i. Kratzer) und Reiberinnen. Zu jener Zeit begann sich aber die Syphilis in Europa zu verbreiten, so dass man sich in den öffentlichen Badstuben, die oft zu Orten von Vergnügungen anderer Art geworden waren, nicht nur mit einer Hautkrankheit wie der Skabies anstecken konnte. Dann galt erst recht: Mancher geht gesund ins Bad und kommt zurück mit schwerem Schad’. Das öffentliche Bäderwesen erfuhr dadurch einen allmählichen Niedergang.
Erst im 18. Jahrhundert erfolgte eine Renaissance. Der schlesische Stadtphysicus Johann Siegmund Hahn (1664–1742), der Begründer der Hydrotherapie in Deutschland, warb für Kaltwasserkuren. Sein schlesischer Landsmann Vincenz Prießnitz (1799–1851) errichtete später die erste Kaltwasser-Heilanstalt. In Wien gab es 1871 die erste Flussbadeanstalt. So meinte denn auch Deutschlands größter Sprichwortsammler Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803–1879): „Es ist unserer Zeit bestimmt gewesen, die heilenden, stärkenden Kräfte des kalten Wassers wieder zu erkennen und in ihre Rechte einzusetzen.“ Das geschah im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts vor allem durch den bayerisch-schwäbischen „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp (1821–1897), der anscheinend durch Bäder in der eiskalten Donau seine Tuberkulose loswurde.
Was kaltes Wasser sonst noch bewirken sollte, besagte schon das Sprichwort: Kalte Bäder machen warmes Blut. Das erinnert sehr an hippokratisches Gedankengut, die Wechselwirkung von kalt und warm oder trocken und feucht. In der Tat empfahl bereits Avicenna kalte Bäder, weil dadurch die innere Lebenswärme angeregt werde und der Badende nachher doppelt so kräftig sei. Mit dieser Ansicht stellte sich Avicenna überraschenderweise gegen Galen, der kalte Bäder insbesondere für das Wachstum Jugendlicher als schädlich einstufte. Auch der Wiener Arzt Johann Gottfried Bremser (1767–1827) riet 1806 vom Kaltbaden ab: „Wer lang im kalten Bade sich aufhält, empfindet darauf große Mattigkeit, und sein Gesicht ist blaß.“ Derartige Warnungen fanden wiederum im Volksmund ihren Niederschlag: Kalt Baden macht Schaden. Die Ärzteschaft sprach sich deshalb oft für lauwarme Bäder aus, die aber nicht zu lange dauern sollten. So warnte Avicenna bei zu langem Baden vor einer Herzschwächung und der im späten Mittelalter bedeutendste Volksprediger im deutschsprachigen Raum, Johann Geiler von Kaysersberg (1445–1510), pflichtete ihm bei: „Man sol meide dick vil oder lang ze baden.“ Meist befürchtete man eine Austrocknung des Leibes, was in einem modernen Spruch noch anklingt: Baden trocknet die Haut aus. Daran ist insofern etwas dran, da der Säureschutzmantel der Haut beeinträchtigt und diese zu sehr entfettet werden kann, allerdings nur bei zu ausgiebigem Baden; kurze Bäder galten hingegen schon von jeher als den „Leib feuchtigend“. Doch selbst hier erhob der Volksmund Widerspruch: Wer lange badet, der lebt lange. Zu dem Thema schrieb der vorhin erwähnte Parömiograph Wander im Jahre 1867:
Eine Badekur im Mittelalter dauerte zwar nicht so viel Wochen als in unsern Tagen, dagegen dauerten die einzelnen Bäder länger. Während jetzt ein Bad dreissig bis fünfundvierzig Minuten dauert, kam es vor, dass die Leute bis zu vier Stunden täglich badeten. In Ems fing man mit einer Stunde an, und legte jeden Tag bis zu zehn Stunden eine Stunde zu. Es wird sogar eines Falles aus jener Zeit gedacht, in welchem ein Wassersüchtiger ohne Unterbrechung zehn Tage lang im Bade blieb, in demselben ass und schlief.
Mit Ems ist der europaweit geschätzte Kurort Ems an der unteren Lahn gemeint, der seit 1913 den Zusatz „Bad“ führt.
Wenn es lediglich um das Waschen eines bestimmten Körperteils ging, hatte der Volksmund auch dafür eine konkrete Empfehlung parat: Vor dem Essen, nach dem Essen, Händewaschen nicht vergessen. Eine Variante davon, nämlich Vor dem Schlafen, nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen, hat in neuerer Zeit das einst übliche Wer zeitig spült den Mund, der bleibt gesund ersetzt. Die Notwendigkeit des Händewaschens begründete man im 18. Jahrhundert folgendermaßen: „Es ist ein sehr vnrein und vergifft ding vmb die Hände am morgen/von wegen der vnreinen vnd bösen Geistern/die auff den Händen ruhen/biß sie mit Wasser abgeschwenckt werden.“ Häufiges Händewaschen zur Erhaltung der Gesundheit hatte indes schon die Schola Salernitana in Versform empfohlen: „Si fore vis sanus, ablue saepe manus“. Das ergab dann im Deutschen: Willst du bleiben gesund, wasche auch Hände und Mund.
Hingegen hat der Reim Hab reine Hand und höfischen Mund, so bleibt dein Leib und Seel gesund nichts mit Reinlichkeit im eigentlichen Sinne zu tun. Vielmehr bedeutete „reine Hände haben“ so viel wie „frei von Schuld sein“ und einer, der einen „höfischen Mund“ hatte, drückte sich so gesittet aus, wie es sich an einem Fürstenhof gehörte. Im alten deutschen Recht war denn auch „unhöfischer Mund“ mit „Ehrverletzung“ gleichzusetzen.
Die Füße müssen warm gehalten werden.
In gewisser Hinsicht medizinisch relevant ist wiederum die Aussage Warme Hände, kalte Liebe; kalte Hände, warme Liebe. Dazu meinte Wander: „Die in diesem Sprichwort enthaltene Volksansicht scheint anzunehmen, dass das aus den Endgliedern oder Gliederenden (Extremitäten) zurückgetretene Blut im Herzen eine grössere Glut der Liebe errege.“ Das Gegensatzpaar „Kalt–Warm“ erinnert an hippokratische Grundsätze, die zudem bei einem ähnlichen Spruch zum Ausdruck kommen: Kalte Füße, warmes Herz. Hier gilt erst recht der Umkehrsatz Warme Füße, kühler Kopf. Dessen Variante Füße warm, Kopf kühl! wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts wie folgt gedeutet: „D.h. Bewegung, Thätigkeit, frische Luft, keine Spirituosa, keine Leidenschaft, kein nächtliches Schwärmen.“
Und damit wären wir bei der populärsten deutschen Gesundheitsregel überhaupt: Kopf kalt, Füße warm, macht den besten Doktor arm. Sie war in zahlreichen Versionen im gesamten deutschen Sprachraum verbreitet und ist heute noch den meisten bekannt. Hergeleitet werden kann sie direkt von Hippokrates, der genau diesen Rat gab: „Wer stark, gesund und jung bleiben und seine Lebenszeit verlängern will, der … halte den Kopf kalt, die Füße warm.“ Warum aber sollte man sich so verhalten? Waren damit tatsächlich Spirituosen- und Nachtschwärmverbote gemeint?
Wie die Herleitung von den hippokratischen Schriften zeigt, erfolgte der Rat ursprünglich aus humoralen Aspekten heraus. Man glaubte nämlich, eine wärmende Kopfbedeckung führe zu einem Überfluss von Säften im Kopf, eine Ansicht, die schon Avicenna vertrat. Die unabdingbare Wärme der Füße musste durch einen kalten Kopf ausgeglichen werden. Ein Grund, die Füße warm zu halten, war, dass sie angeblich die geringste Körperwärme aufweisen: „Vom Herzen, welches das erwärmende Blut in alle Theile des Körpers treibt, sind die Füße am weitesten entfernt, und die natürliche … Wärme ist in ihnen … gewöhnlich am geringsten.“ Hier ging es also um das Tragen einer Kopfbedeckung einerseits sowie – vor allem in der Neuzeit – um das von Schuhwerk andererseits. Mithin wird das einschlägige Sprichwort oft lediglich als „Bekleidungsregel“ apostrophiert.
Andererseits verweist man in diesem Zusammenhang auch auf einen gewissen Charakterzug, nämlich im Gegensatz zu einem Hitzkopf einen kühlen Kopf zu bewahren: „Den Kopf soll man nach einer alten medizinischen Regel stets kalt halten; dann bleibt er nämlich klar und man stürzt sich nicht über Hals und Kopf [sic!] … in Unternehmungen, die einem später viel Kopfzerbrechen verursachen.“ Ist „kühl“ in wortwörtlichem Sinne gemeint, sollte man den Kopf allerdings – so die moderne Medizin – keinesfalls so kalt werden lassen, dass es zu einer allgemeinen Unterkühlung kommt.
Doch lassen sich ein „kalter“ Kopf auch als „fieberfrei“ und „warme“ Füße als „nicht feucht“ interpretieren. Dass bei kalten oder nassen Füßen der Körper zu stark auskühlt, die Schleimhäute nicht ausreichend durchblutet werden und dadurch das Immunsystem geschwächt wird, so dass man sich leicht Erkältungskrankheiten zuziehen kann, war durchgehend Konsens: Eine Erkältung beginnt mit kalten Füßen.
In England und Frankreich aber empfahl der Volksmund, nicht nur die Füße, sondern ebenso den Kopf warm zu halten. Hierfür wusste man nicht minder gewichtige Argumente beizubringen. So hielt man eine Kopfbedeckung sowohl gegen Sonnenhitze wie Winterkälte für nützlich. Darüber hinaus empfahl man des Nachts Schlafmützen (engl. „nightcaps“), um sich u.a. vor kalten Luftzügen in undichten Häusern zu schützen. Sprichwörtliche Empfehlungen, neben den Füßen den Kopf gleichfalls warmzuhalten, gab es zudem in Norddeutschland. Ein regional nicht begrenzter Spruch riet hierzulande gerade bei kalten Füßen zum Tragen einer Mütze: Wenn du kalte Füße hast, zieh’ eine Mütze auf. Dazu heißt es: „Über den Kopf verliert der Körper gut 30 Prozent seiner Wärme – in der Regel steckt da oben doch die meiste Energie. Der alte Spruch ‚Wenn du kalte Füße hast …‘ ist gar nicht so abwegig.“ Eine Mütze schützte demnach vor Wärmeverlust, so dass nach dieser Theorie auch die am weitesten entfernten Füße noch die nötige Wärme erhielten.
Nichtsdestotrotz waren Sprichwörter wie Den Kopf halt kühl, die Füße warm, macht dich gesund, den Doktor arm, welche einen kühlen, kalten oder frischen Kopf, ohne Hut oder Mütze, medizinisch für angebrachter hielten, in Deutschland weitaus in der Mehrzahl. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Versionen um Reduktionen längerer, früher belegbarer Sprüche wie Kopf kalt, Füße warm, Leib offen lässt ein hohes Alter erhoffen oder Halt Kopf frisch, Füße warm, Leib offen und lass den Doktor laufen. Das zusätzliche Element „Leib offen“ ist ein Hinweis auf die Wichtigkeit eines regelmäßigen Stuhlgangs. Ein Dreispruch dieser Art soll denn auch die Maxime des niederländischen Mediziners und Botanikers Herman Boerhaave (1668–1738) gewesen sein. Dieser ist übrigens eine der derzeit 130 großen Persönlichkeiten „teutscher Zunge“, die in der Gedenkstätte „Walhalla“ bei Regensburg dauerhaft mit einer Marmorbüste geehrt werden. Angeblich hat Boerhaave sogar ein Vermächtnis hinterlassen. So heißt es bei Schipperges:
In Boerhaaves Nachlaß, dem Testament des berühmtesten Arztes seiner Zeit und Lehrers der gesamten europäischen Ärztedynastie, fand man ein versiegeltes Manuskript mit der Aufschrift: ‚Die einzigen und tiefsten Geheimnisse der Arzneikunst‘. Das Geheimnis sollte sich erst lichten, als es zur Versteigerung der Bibliothek des großen Gelehrten kam. Tausende von Gulden zahlte ein Engländer für das mysteriöse Buch. Und was enthielt es? Leere Blätter – aber auf der letzten Seite stand ein einziger Satz: ‚Halte den Kopf kalt, den Leib offen, die Füße warm, so kannst du aller Ärzte spotten!‘
Bei Kopf und Füßen war also besondere Vorsicht geboten; das galt erst recht für einen Teil des Kopfes, die Augen. So besagt ein alter Volksreim: Auge, Glaub’ und Glimpf leiden keinen Schimpf. Die Augen vertragen demnach, genauso wie ein guter Ruf bzw. „Glimpf“, keinen Scherz. Vor allem sollte man nicht die Finger zu Hilfe nehmen: Wem die Augen sollen gesunden, der halte die Finger hübsch gebunden. Das brachte man zudem mit dem Spruch Die Augen muss man nicht anrühren, ausgenommen mit dem Ellenbogen zum Ausdruck. Die Warnung Nichts ist gut für die Augen konnte sich allerdings ebenso auf das „Augennichts“ beziehen. Dieses Zinkoxyd, wegen seiner lateinischen Bezeichnung „Nihilum album“ volkstümlich „Nichts“ bzw. „Nix“ genannt, verwendete man früher bei Augenleiden. Eines der gefährlichsten war der graue Star, bei dem der Volksmund folgendermaßen warnte: Es ist besser, man behält den Star in den Augen, als dass man denselben unter Lebensgefahr sticht. Durch einen Stich der Augenlinse versuchten nämlich bis zum 19. Jahrhundert eigene Spezialisten, die Starstecher, Abhilfe zu schaffen. Eine solche Staroperation war aber höchst gefährlich und Komplikationen nicht selten.
Weniger riskant ist ein Stechen anderer Art, das zwar nach Okkultismus klingt, laut Aussage von Augenärzten unserer Zeit aber durchaus Wirkung zeitigt: Gold an den Ohren zieht das Rot aus den Augen. So soll das manchmal ein Eitern auslösende Durchstechen der Ohren sowie das anschließende Tragen goldener Ohrringe eine Entzündung aus den Augen ablenken. Generell galt für entzündete wie überhaupt kranke bzw. empfindliche Augen: Licht ist für kranke Augen nicht bzw. Grell Licht die Augen sticht. Hier verwendete man einst auch häufig „blöd“ im Sinne von „schwach/schlecht“: Wahrheit und Sonnenlicht vertragen blöde Augen nicht. Bekommen soll ihnen jedoch etwas anderes: Möhren sind gut für die Augen. Dass man insbesondere nachts durch den Verzehr von Karotten besser sehen kann, ist allerdings ein Mythos, den angeblich der britische Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg verbreitete, um die nächtlichen Erfolge britischer Piloten zu begründen. In Wirklichkeit sollte damit dem Feind der möglich gewordene Einsatz von Radar verheimlicht werden. In früheren Zeiten hatte man zur Verbesserung der Sehkraft aber ohnehin nicht auf Möhren, sondern auf bestimmte Heilpflanzen zurückgegriffen (vgl. dazu Kap.7).
Von den Augen nun zu Nase und Mund. Hier wird aus medizinischer Sicht zum Gegenteil von „Augen zu, Mund auf“ geraten: Geschlossener Mund hält gesund. Wander weist in diesem Zusammenhang auf einen interessanten Sachverhalt hin: „Der Titel einer (Leipzig 1870) von G. Catlin herausgegebenen Schrift, in der namentlich das Athmen durch die Nase … empfohlen wird, weil die Nase den natürlichen, die Athmungsluft wärmenden, reinigenden und den Wind abhaltenden Respirator bilde.“ Ähnlich äußerte sich 1893 der Augsburger Königliche Gymnasialprofessor P. B. Sepp: „Auf der Strasse überhaupt, besonders aber wenn du aus dem warmen Wohnzimmer oder aus der Schule kommst, sollst du längere Zeit den Mund geschlossen halten.“ Volkstümlich ist der Rat nicht nur in Form des besagten Titels geworden. So hieß es etwa auch: Mund geschlossen, Potschi [d.i. Po, Hintern] offen, hat der Doktor nichts zu hoffen bzw. Die Zähne vor die Zunge erhält gesund die Lunge.
Machte man trotzdem den Mund auf, so konnte die Zunge diagnostischen Zwecken dienen: Man sieht an der Zunge, ob der Magen gesund ist. Dazu findet sich 1909 in einer volksmedizinischen Publikation folgender Vermerk: „So ist das Aussehen der Zunge beim Volke noch heute in großem Ansehen, und viele glauben, daß der Arzt bereits aus der Beschaffenheit der Zunge die Krankheit erkennen könne.“
Weit mehr als die Lunge stand bei der Humoralpathologie die Leber im Mittelpunkt. Das wichtigste Stoffwechselorgan des menschlichen Körpers wurde beim Hippokratismus nicht nur als Verdauungsorgan (vgl. Kap. 2), sondern gleichermaßen als Sitz des Gemüts (vgl. Kap. 3) angesehen. Insofern spielte sie, wie erwähnt, auch bei sexueller Leidenschaft eine Rolle.
Das englische Pendant zu Man muss die Milch von der Leber schweifen, nämlich Wash thy milke off thy liver, wurde im 17. Jahrhundert als Aufforderung angewendet, seine Feigheit abzulegen: „Purge yourself of cowardice.“ Und to be white-livered hat noch heute im Englischen – ebenso wie avoir le foie blanc im Französischen – die Bedeutung „feige sein“. Personen mit einer vermuteten „weißen Leber“ waren demnach ein Sinnbild für „Feigheit“. Die Milch von ihrer weißen Leber (=Milchleber) zu spülen, befreite diese Personen daher vermeintlich von ihrer Feigherzigkeit. Eine solche Verwendung ist für das deutsche Pendant „die Milch von der Leber waschen“ nicht überliefert. Bei uns wurde zudem die Redensart „eine weiße Leber haben“ ganz anders gebraucht (vgl. Kap. 5). Ein modernes Sprichwort über die Leber besagt, dass ihr Kranksein sich in Schlaffheit und Abgeschlagenheit äußert: Der Schmerz der Leber ist Müdigkeit.
Für den im Hippokratismus vor der Leber als erstes Verdauungsorgan geltenden Magen gibt es ebenfalls sprichwörtliche Hinweise, so etwa Von den meisten Klagen liegt die Quell’ im Magen. Um hier keinen Anlass zur Klage zu haben, konnte man sich laut Volksmund z.B. an kuriose, mitunter aber durchaus ernst gemeinte Gesundheitstipps wie Dreck/Sand/Holzkohle reinigt den Magen halten. In der Mehrzahl der Fälle lagen Magenprobleme aber an einer übermäßigen Nahrungszufuhr: Mund und Magen nehmen einander beim Kragen. Dass sich die beiden bekriegen, wird von Wander folgendermaßen kommentiert: „Ich esse, was mir schmeckt, sagt der Mund; und ich leide, was ich muss, erwidert der Magen.“