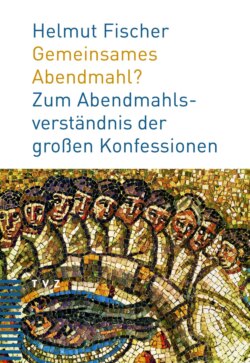Читать книгу Gemeinsames Abendmahl? - Helmut Fischer - Страница 6
Оглавление|13| I Die Mahlgemeinschaften Jesu als seine Botschaften
Die Botschaft von der anbrechenden Gottesherrschaft
Wenn wir vom (letzten) Abendmahl Jesu sprechen und damit die letzte Mahlgemeinschaft besonders hervorheben, so ist dem zu entnehmen, dass Mahlgemeinschaften für Jesus offenbar auch vorher eine besondere Bedeutung hatten. Das bestätigen sogar Jesu Gegner, die ihn mit dem asketischen Bußprediger Johannes dem Täufer vergleichen. Sie sagen: Johannes hat nicht gegessen und nicht getrunken. Dieser Jesus aber tut das reichlich, sogar in der Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Er ist ein »Fresser und Säufer« (Mt 11,19).
Das letzte Mahl Jesu, von dem sich unser gottesdienstliches Abendmahl herleitet, steht offenbar in einer langen Reihe von Mahlzeiten, die Jesus mit unterschiedlichen Menschen gefeiert oder zu denen er selbst eingeladen hat. Ein Blick auf diese Mahlzeiten wird uns verstehen helfen, in welchem Deutungshorizont das letzte Abendmahl zu sehen ist.
Da ist zunächst die Geschichte von der wunderbaren Speisung der fünftausend. Sie steht im Markusevangelium direkt hinter der Geschichte von Johannes dem Täufer, den die Bibel als strengen Asketen schildert. Der Kontrast zu Johannes wird damit auffallend deutlich betont. Die Geschichte von der wunderbaren Speisung wird in den Evangelien in sechs verschiedenen Versionen überliefert. Das zeigt, wie wichtig man ihre Botschaft nahm. So unterschiedlich diese sechs Versionen im Detail auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Sie erzählen, wie Menschen, die sich |14| in einer akuten Situation des Mangels befinden, durch Jesus Nahrung erhalten. Dabei wird aber kein Schlaraffenland geschildert. Es heißt nur ganz nüchtern: »Und alle (fünftausend, bei Matthäus noch zusätzlich die Frauen und Kinder) aßen und wurden satt« (Mk 6,42). Nach der Speisung wurden noch zwölf Körbe an Brotbrocken eingesammelt. Diese Überfülle an Nahrung stand den Austeilenden zur Verfügung, obwohl jede rationale Planung und Vorsorge fehlte, denn die Jünger hatten ja nichts zu verteilen als fünf Brote und zwei Fische.
Die gleiche Überfülle begegnet uns in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana (Joh 2,11). Hier steht nicht die unerschöpfliche Menge an der Grundnahrung Brot im Mittelpunkt, sondern der Überfluss an erlesenstem Wein, dem Symbol des Festes und der Freude.
Die jüdischen Hörer verstanden sofort, dass ihnen mit diesen Geschichten keine Zauberkunststücke Jesu vorgeführt werden sollen. Sie verstanden diese Geschichten auch nicht als Reportagen über spektakuläre Vorfälle, sondern als Zeichen und als Hinweise darauf, was sich in der Mahlgemeinschaft mit Jesus in Wahrheit ereignet. Die Geschichte von der Hochzeit zu Kana wird ausdrücklich nicht als Wunder bezeichnet. Sie schließt vielmehr mit dem bedeutungsvollen Satz: »Das tat Jesus als Anfang der Zeichen … und seine Jünger glaubten an ihn« (Joh 2,11).
Wenn die zentrale Botschaft einer Zeichenhandlung in der Sprache der darin enthaltenen Zeichen zu suchen ist, so ist in erster Linie auf die Bedeutung dieser Zeichen zu achten. Jüdische Menschen wussten aus ihrer religiösen Tradition, dass der Überfluss an Nahrung nicht nur das Kennzeichen der paradiesischen Urzeit war, sondern auch als Charakteristikum der so sehnlich erwarteten Endzeit |15| galt. So verstanden sie die Botschaft der Speisungsgeschichten recht gut. Sie lautet nämlich: In den Mahlgemeinschaften mit Jesus wird offenbar, dass die Zeit des Heils bereits angebrochen ist. In der Tischgemeinschaft, die aus dem lebt, was sie von Jesus empfängt, ist die neue Zeit als die Herrschaft Gottes schon gegenwärtig.
Diese Botschaft bestätigt auch der kurze Text zur Fastenfrage (Mk 2,18–20). Die Leute, so heißt es dort, fragten Jesus, weshalb seine Jünger nicht fasten, wie das die Jünger der Pharisäer und des Johannes tun. Jesus antwortete: »Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist?« Das können und sollen sie natürlich nicht, wenn die Zeit des Heils und damit die Zeit der Freude da ist. In der Zeichensprache des Judentums und Jesu stehen Hochzeitsmahl, Hochzeitsfreude und Wein für die Heilszeit der Gottesherrschaft.
Halten wir als Zwischenergebnis fest: Für die Mahlgemeinschaft, zu der Jesus einlädt, ist die üppige Fülle, das Gegenteil von Mangel, kennzeichnend. Diese Fülle steht für die Zeit des Heils, die mit Jesus gekommen ist. Gottesherrschaft in unserer Welt wird als heilbringende Herrschaft sichtbar und erfahrbar in der Art, in der Jesus als Mensch unter seinesgleichen lebt und wirkt. Daran wird deutlich, dass die Herrschaft Gottes, die mit Jesus anbricht, sich nicht auf die Angst erregende und zerstörerische Macht von Heeren und von Waffen gründet, sondern auf den Mut und auf die Kraft der Liebe, durch die auch unter verschiedenartigen Menschen Gemeinschaft entsteht.
|16| Die Botschaft vom Heil für die Sünder
Was ein Mensch tut oder unterlässt, das erhält seine volle Bedeutung erst in jenem kulturellen Zusammenhang, in dem es geschieht. Mahlzeiten sind in allen Kulturen weit mehr als nur gesellige Veranstaltungen, bei denen man Nahrung aufnimmt. In den meisten Kulturen sind gemeinsame Mahlzeiten auch symbolische Handlungen, mit denen eine Gemeinschaft ihr Verhältnis zu Gott und ihre Beziehungen untereinander zum Ausdruck bringt.
Im Judentum hatte jede gemeinsame Mahlzeit ihre religiöse Bedeutung. Sie galt als ein Bekenntnis zu Jahwe, dem einen Gott, der dem Land die Fruchtbarkeit gibt und den man daher auch als den Gastgeber einer jeden jüdischen Mahlzeit sah. Das drückt sich in den Tischgebeten aus, die Jahwe als den Schöpfer aller Gaben preisen. Die jüdische Mahlgemeinschaft ist deshalb stets eine Gemeinschaft, die sich zu Jahwe bekennt. Jede jüdische Tischgemeinschaft ist also eine Bekenntnisgemeinschaft. Das schließt die Tischgemeinschaft von Juden mit Heiden grundsätzlich aus.
Den Juden war es also nicht erlaubt, mit Nichtjuden zusammen zu essen oder zu trinken. Fromme Juden vermieden es sogar, mit jüdischen Menschen zu speisen, deren religiöse Untadeligkeit und Reinheit sie anzweifelten. Gänzlich unmöglich war es für sie, sich mit Zolleintreibern, Kollaborateuren oder Frauen zweifelhaften Rufs an einen Tisch zu setzen. Diese Leute galten ihnen als Sünder. Die Gemeinschaft mit ihnen sprengte die Bekenntnisgemeinschaft und gefährdete so das Verhältnis der gesamten israelitischen Glaubensgemeinschaft zu Gott.
Genau das, was die Gesetze der jüdischen Religion so streng verbieten, das tat Jesus. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte |17| von der Berufung des Zöllners Levi (Mk 2,13–17). Darin heißt es: »Und es geschieht, dass er in dessen (des Zöllners) Haus bei Tisch sitzt. Und viele Zöllner und Sünder saßen mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch. Es waren nämlich viele, und sie folgten ihm.« Als die Schriftgelehrten das sahen, sagten sie entrüstet zu Jesu Jüngern: »Mit den Zöllnern und Sündern isst er!« Das verstößt doch gegen die elementarsten jüdischen Gesetze!
Jesus vermittelte seine Botschaften eben nicht nur durch Worte, sondern auch durch symbolische Handlungen oder durch Handlungen mit symbolischen Hinweisen. Seine Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern war eine solche symbolische Handlung. Die Botschaft dieser zeichenhaften Handlung muss in den Ohren seiner jüdischen Zeitgenossen geradezu schrill geklungen haben.
Die jüdische Religion gründet in dem Glauben an den einen und einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Israel weiß sich von diesem Gott aus allen Völkern zu seinem Volk erwählt, und es weiß sich durch einen göttlichen Bund exklusiv mit ihm verbunden. Der Bund besteht, in einer Art von wechselseitiger Verpflichtung, darin, dass Jahwe zu Israel steht und dass Israel die Gebote Jahwes hält und nach dessen Gesetzen lebt. Zur Zeit Jesu waren das 248 Gebote und 365 Verbote. Israeliten, die diese Vorschriften nicht einhalten, gefährden nicht nur ihr eigenes Heil; sie setzen darüber hinaus den göttlichen Bund und damit die gesamte Existenz Israels aufs Spiel.
Vor diesem Hintergrund kann man verstehen, dass die frommen Juden entsetzt waren, als sie Jesus mit Zöllnern und religiös und moralisch zweifelhaften Leuten an einem Tisch sahen, denn er verstieß damit gleich mehrfach gegen die Gesetze des göttlichen Bundes. Sie verstanden sehr wohl, |18| was er mit dieser Symbolhandlung ausdrücken wollte, nämlich: Gott grenzt niemanden aus, auch die nicht, die durch religiöse Gesetze von Menschen ausgegrenzt und abgewertet werden. Und die Menschen, mit denen Jesus gegen die geltenden Grundregeln Mahlgemeinschaft hielt, verstanden noch mehr. Sie erfassten die tiefere Botschaft: Hier und heute hat sich uns der lebendige Gott in seinem wahren Wesen gezeigt, nämlich als ein Freund und Bruder auch derer, die sich verloren und verirrt haben und die von den strengen Hütern der Religion längst abgeschrieben sind.
Dieser Kern der Symbolhandlung Jesu ist der vielleicht schwerste Angriff auf das Selbstverständnis des damaligen jüdischen Glaubens. Denn ihre Botschaft lautet: Gottes Liebe hängt nicht von meinen religiösen Vorleistungen ab. Gottes Liebe kann man sich nicht verdienen, auch nicht dadurch, dass man alle 613 Vorschriften genauestens erfüllt. An den religiös Abgeschriebenen verdeutlicht Jesus, dass Gott allen Menschen nahe sein will, dass er ihre Gemeinschaft sucht und sie in seine Gemeinschaft ruft.
Diese religiös Randständigen begriffen und erfuhren an sich selbst, was die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit Gott in ihrem Leben und für ihr Leben bedeutet, nämlich: Wer Liebe erfährt, der wird dadurch selbst zur Liebe stark gemacht. Das kommt eindrucksvoll in der Geschichte vom Zöllner Zachäus (Lk 19) zum Ausdruck. Auch hier heißt es: Als die Leute Jesus in des Zöllners Haus gehen sahen, »murrten (sie) und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt«. Als sich aber Zachäus in so selbstverständlicher Weise von Jesus angenommen und in seiner Gemeinschaft gewürdigt sah, »trat (er) vor den Herrn und sagte: Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst |19| habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren« (Lk 19,8f). So also ereignet sich Gottes Gegenwart, so wird Gottes Herrschaft im menschlichen Leben wirklich! Die Reaktion des Zachäus auf die Gemeinschaftserfahrung mit Jesus macht deutlich, in welcher Weise sich Gott als gegenwärtig erweist und Gottes Herrschaft reale Gestalt annimmt.