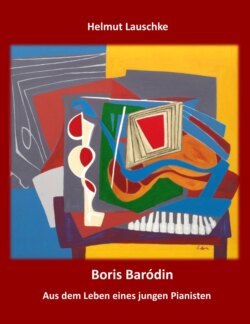Читать книгу Boris Baródin - Helmut Lauschke - Страница 3
Musik, Begegnungen, Hilfe zur Befreiung
ОглавлениеAus dem Leben eines jungen Pianisten
Boris Baródin saß am Flügel in der Knesebeckstraße 17 in Berlin-Charlottenburg. Es war ein regnerischer Herbstabend. Seit Wochen regnete es, und Boris hatte sich für sein nächstes Konzert vorzubereiten, dass er in Warschau und danach in Moskau zu geben hatte. Für die Vorbereitung blieben ihm noch knapp zwei Wochen. Er hatte sich bei seiner Asientournee eine Erkältung mit heftigen Hustenattacken zugezogen, die ihn hartnäckig in Mitleidenschaft nahmen. So saß er mit erhöhter Temperatur am Flügel und probte die schwierigen Passagen am B-Dur, dem zweiten Klavierkonzert, Opus 83, von Brahms. Damit das Schwitzwasser nicht auf die Tasten tropfte, hatte er den roten Seidenschal, rot war seine Lieblingsfarbe, zusammengerollt über die Stirn gebunden und die Enden über dem Hinterkopf verknotet. Die Medikamente zur Fiebersenkung und Hustenbekämpfung, die ihm die Hausärztin, Dr. Gaby Hofgärtner, vor einer Woche verschrieben hatte, schienen trotz regelmäßiger Einnahme wenig zu helfen. Boris hatte deshalb um einen neuen Termin gebeten, den er aufgrund seiner beruflichen Besonderheit für den nächsten Tag, einem Freitag für elf Uhr bekam, bei dem er die Ärztin bitten wollte, ihn gründlich zu untersuchen, um etwas Ernsthaftes auszuschließen, was die Ursache sein könnte, dass sich die Rekonvaleszenz über das normale Maß hinaus verzögerte. Denn eine Erkältung mit Husten war für ihn nicht ungewöhnlich, wenn er in den Monaten eines verspäteten Sommers oder früh einsetzenden Winters auf Konzertreisen war.
Boris saß am Flügel und probte an der Solo-Kadenz, als gegen acht das Telefon läutete. Es war seine Mutter Anna Friederike Elbsteiner, die ihn aus Hamburg anrief, wo sie mit dem Kaufmann und Frühwitwer Gerald Elbsteiner in einem vornehmen Hause in Blankenese mit unverbautem Blick auf die Elbe wohnte. Sie hatte den fünf Jahre älteren Kaufmann vor vier Jahren auf einer zweiwöchigen Kreuzfahrt durchs Mittel- und Schwarze Meer kennengelernt und vor drei Jahren geheiratet. Gerald Elbsteiner hatte zwei Töchter aus erster Ehe, von denen Eleonore, die ältere, mit einem Amerikaner verheiratet in Houston und Alaine, die jüngere, unverheiratet mit einem Maler des gleichen Alters in Südfrankreich zusammenlebte. Die Mutter war, wie sie es immer war, um den Gesundheitszustand ihres Sohnes sehr besorgt. Der Kontakt zwischen Mutter und Sohn war von jeher eng. So gehörte der tägliche Anruf zur Routine, der von beiden Seiten erwünscht war, aber häufiger von der Mutter als vom Sohn ausging. Diesmal bestand die Mutter darauf, dass sich Boris von einem Spezialisten untersuchen lassen solle, weil der Husten, der härter war als sonst und das Telefonieren störend attackierte, länger anhielt als gewöhnlich, was für seine Konzerte äußerst lästig sei. “Deine häufigen Erkältungen mit dem Husten hast Du von deinem Großvater geerbt.” Das sagte Anna Friedrike jedesmal zu ihrem Sohn, wenn er hustete, und verwies dabei auf die anfällige Lunge, wie sie es nannte, und auf ihren Vater, Eckhard Hieronymus Dorfbrunner, den Prediger von Breslau, der nach dem verlorenen Weltkrieg eine Stelle als Prediger nicht mehr fand und als Predigerersatz Lehrer für Deutsch, Geschichte und Geographie an der Ernst Thälmann-Grundschule in Bautzen war, um sich und die Familie am Leben zu halten. Manchmal sprach Anna Friederike Elbsteiner, geborene Dorfbrunner, von der Immunschwäche, die bei ihrem Vater von dem praktischen Arzt Dr. Bodenbrecht diagnostiziert und als Ursache für die erhöhte Anfälligkeit der Luftwege für Bakterien und Viren der verschiedensten Arten angesehen wurde.
Diese “Immunschwäche” hatte sich bei Boris Baródin wegen der ständigen Erwähnung vonseiten der Mutter, selbst bei dem leisesten Husten, den er nicht unterdrücken konnte, wenn er mit ihr telefonierte, ins Hirn festgesetzt. Sie hat wie eingemeißelt einen festen Platz im Hirn eingenommen, und bei jeder Erwähnung schüttete er im Stoß sein Adrenalin aus und bekam einen roten Kopf, für den er sich schämte, auch wenn es die Mutter am anderen Ende der Leitung in dem vornehmen Bürgerhaus in Blankenese mit dem ungetrübten Blick auf die Elbe weder sehen noch die Schweißabsonderung in ihrer Geruchsschärfe riechen konnte.
Bei dem Telefonat teilte Boris der Mutter mit, dass er einen Brief von Vater Ilja Igorowitsch Tscherebilski, dem ehemaligen Bautzener Stadtkommandanten der Roten Armee, erhalten habe. Der Brief sei von der Krim abgeschickt worden, wo der Vater in einer Datscha für die hohen Offiziere einen mehrwöchigen Urlaub verbringe. Er schrieb, dass er geschieden sei und mit einer jüngeren Lettin, die er in Leningrad kennengelernt hat, zusammenlebe. Seine Gesundheit sei seit dem tragischen Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei angeschlagen. Er leide unter Kopfschmerzen und einem hohen Blutdruck, habe sich vor zwei Monaten wegen eines blutenden Magengeschwürs einer Notoperation in Moskau unterziehen müssen. Ilja Igorowitsch freue sich auf das Brahms’sche Klavierkonzert, dass sein Sohn mit der Moskauer Philharmonie spielen werde. Er selbst habe sich in seiner Jugend an diesem Konzert probiert, es aber seiner spielerischen Schwierigkeit wegen bald wieder zur Seite gelegt. Anna Friederike sprach immer mit tiefer Empfindung von Ilja Igorowitsch und kam ins Schwärmen, wenn sie von seinen musikalischen Exkursionen auf dem Flügel in Bautzen erzählte. “Er ist ein gebildeter und hoch musikalischer Mensch”, pflegte sie zu sagen, wenn die Rede auf seinen Vater kam.
Boris hatte seine Zweifel, ob seine Mutter eine glückliche Ehe mit Gerald Elbsteiner führe. Sie erwähnte lediglich, dass er ein tüchtiger Geschäftsmann sei und vor einigen Wochen bei einer Auktion in Paris einen Seurat für 37 tausend DM ersteigert habe. Auch sei die Renovation des Hauses fast abgeschlossen, das diesmal einen hellbraunen Außenanstrich bekommen habe. Mehr ließ Anna Friederike über ihr Privatleben nicht verlauten. Er hatte seine Vermutung, dass Wesentliches nicht ausgesprochen wurde, was sich in ihr angesammelt hatte. Doch wollte er da nicht hinein fragen, um ihr nicht noch einen Schmerz zuzufügen. So ließ er es bei der Frage nach ihrer Gesundheit bewenden, wie er es bei den Telefonaten in den letzten Monaten schon tat. Auf diese Frage erklärte Anna Friederike auch diesmal, dass sie sich bis auf gelegentliche Schlafstörungen, die sie auf das feuchte Klima in der norddeutschen Bucht schob, gesund fühle. Nachdem Boris seiner Mutter versprach, einen Spezialisten wegen seiner anhaltenden Erkältung aufzusuchen, wurde das Gespräch beendet.
Er ging in die Küche, brühte chinesischen Kräutertee auf, gab eine Löffelspitze Ingwer in die gefüllte Tasse, kehrte zum Flügel zurück und setzte die Tasse auf den Tisch mit den Notenbergen, der in Reichweite links neben der Klavierbank stand. Die ersten Takte aus der Kadenz im ersten Satz waren gespielt, als es an der Tür läutete. Boris ließ es dreimal klingeln, weil er sich nicht in der Verfassung fühlte, irgendeinen Besuch zu empfangen. Der rote Schal war über der Stirn schweißdurchnässt, als er sich nach dem dritten Klingelzeichen erhob, noch einen Schluck Tee aus der Tasse nahm und zur Tür ging. Es war Claude, ein begabter Schüler, den er seit fünf Jahren unterrichtete. Claude stand aufgeregt vor der Tür. Boris führte ihn ins Musikzimmer, sein Arbeitszimmer. Sie setzten sich in die beiden schmalen Sessel in der kleinen Klubecke, die dem Flügel gegenüber neben dem hohen Fenster war. Boris bot ihm vom chinesischen Kräutertee an, den sich Claude, der blass im Gesicht war, wortlos einschenken ließ. Olga, seine junge Freundin, eine russische Emigrantin aus Leningrad, die seit zweieinhalb Jahren ohne deutschen Pass in der Bundesrepublik lebt, sei von einem Dealer in einem dunklen Hausflur in Wedding zusammengeschlagen worden, weil sie ihm das Heroin, das sie von ihm vor einer Woche bezogen hatte, nicht zahlte, weil ihr das Geld fehlte. Sie liege mit einem geschwollenen Gesicht, Hämatomen über der Brust und Hautschürfungen an Hals und den Armen im Bett. “Sie soll Anzeige bei der Polizei erstatten und sich von einem Arzt behandeln lassen.” Das war der Vorschlag von Boris, den er dem begabten Schüler mit allem Nachdruck gab. Claude schüttelte den Kopf: “Zur Polizei kann Olga ohne Pass oder Aufenthaltsgenehmigung nicht gehen. Da kommt sie als Emigrantin ohne Papiere gleich in die Zelle und auf die Liste der Illegalen, die nach Russland wieder abgeschoben werden.” Boris wischte sich den Fieberschweiß von der Stirn: “Dann kann sie also gar nichts machen, sondern nur darauf warten, dass sie wieder zusammengeschlagen wird.” “So ist es”, bemerkte Claude mit blassem Gesicht, in dem die Augenlider zuckten.
Boris spürte, dass zwischen Claude und Olga eine engere Beziehung war. Eine Gleichgültigkeit gegenüber der illegalen russischen Emigrantin Olga Zerkow gab es nicht. Eine solche, in der bundesrepublikanischen Gesellschaft verbreitete Einstellung war hier nicht erwünscht und auch nicht zulässig. Dafür hatten beide, Lehrer und Schüler, Boris Baródin und Claude Zerbal noch den Anstand vor dem Menschen im Allgemeinen und das Mitgefühl zu dem Menschen, der in Not geraten war, im Besonderen, wenn auch bei Claude noch etwas anderes, etwas Persönliches dazukam. “Was können wir dann tun?”, fragte Boris und wischte sich den Schweiß von der Stirn. “Das weiß ich auch nicht”, erwiderte Claude mit dem nervösen Augenzwinkern. Dann sagte er besorgt: “Der Kerl, der Türke, wird wiederkommen und das Geld eintreiben, und wenn es mit Prügel ist. Doch ich habe das Geld nicht, um es Olga zu geben, um sie freizukaufen.” “Wieviel muss sie denn zahlen?”, fragte Boris, einen Schluck kalten chinesischen Tee aus der Tasse trinkend. Dabei sah er in das ratlose Gesicht von Claude, der den Freikauf von Olga aus eigener Tasche nicht bewältigen konnte. “Die Summe ist auf etwa 900 DM angelaufen”, sagte Claude mit leiser, besorgter Stimme. “Das Geld kann ich dir geben, aber erst morgen, weil ich es von der Bank holen muss”, sagte Boris. “Seit wann nimmt Olga denn Drogen?”, fragte er. Sie beschafft das Heroin für einen Bekannten, der versprochen hat, ihr eine zurückdatierte Aufenthaltsgenehmigung zu beschaffen, damit sie damit einen deutschen Pass beantragen kann”, antwortete Claude. Boris machte ein ernstes Gesicht: “Dann hat sich Olga von diesem Typen abhängig gemacht. Die ganze Sache ist sehr dunkel und wird eines Tages entdeckt werden. Dann kommt eine harte Strafe auf beide zu und Olga wird, weil sie illegal in Berlin ist und mit dem Betrug eine zweite Straftat begangen hat, sofort und unwiderruflich in ihr Heimatland abgeschoben, wo sie das zweite Mal und wahrscheinlich noch härter bestraft wird.” Die Hände von Claude zitterten. Sein Gesicht wurde aschfahl, als er mit leiser Stimme sagte, wobei er sich in unregelmäßigen Abständen verschluckte, dass Olga eine Halbwaise sei. Ihr Vater war Soldat in der Roten Armee und kam bei einer Militärübung ums Leben. Die Mutter habe eine Lungentuberkulose, die sich trotz Medikamente nicht bessert. Sie arbeite in einer Blumenbinderei und verkaufe zweimal in der Woche Blumen auf dem Markt, um sich mit dem kleinen Erlös am Leben zu halten, wobei das Geld zum Teil für die Medikamente draufgehe. Die Mutter habe ihr zur Emigration in die Bundesrepublik geraten, damit sie sich hier ein besseres Leben aufbauen könne. Sie sagte: “Hier haben wir keine Zukunft. Mich wird die Tuberkulose vertilgen, und du sitzt dann alleine da. Helfen wird dir hier keiner.”
Boris machte ein betroffenes Gesicht. Er wusste, dass viele Mädchen aus den Ländern des Ostblocks unter falschen Versprechungen in die Bundesrepublik eingeschleust und hier in die Prostitution getrieben werden. Der Traum vom besseren Leben weicht schnell der Erkenntnis vom Höllendasein, wenn sie in totaler Abhängigkeit ohne oder mit gefälschten Papieren in erbärmlichen Unterkünften leben und machtlos den oft brutalen Geschäften und Machenschaften ausgeliefert sind. Da müssen sie sich Prügel und Vergewaltigungen wehrlos gefallen lassen. Dagegen können sie nichts machen. Denn die einzige Alternative ist das Abschieben durch die Behörde wegen des illegalen Aufenthalts. Und das fürchteten sie am meisten, in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. So nehmen sie das rechtlose, unmenschliche Sklavenleben, als “heiße” Ware im Dschungel des blühenden Sexgeschäfts verkauft zu werden, ohne ein Widerwort hin. Unter den miserabelsten Bedingungen in der Bundesrepublik lassen sie sich im Wissen der totalen Abhängigkeit von den Bossen und Zuhältern deren willkürliche Misshandlungen gefallen.
In seiner Sprachlosigkeit ging Boris zum Flügel und spielte den zweiten Satz, das d-Moll ‘Allegro appassionato’. Er drückte das Gefühl des Schmerzes “brahmsisch” in die Tasten. Der Schweiß tropfte von der Stirn, weil er sich das Stirntuch nicht umgebunden hatte. Der Weltschmerz tönte in weiten elegischen Bögen. Im Wechsel zwischen Dur [F; B] und Moll [d; g] war die Atmung der Welt zu spüren. “Wunderbar!”, murmelte Claude, der seinen jungen Lehrer ob seiner außergewöhnlichen Musikalität zutiefst bewunderte. Rasch hatte die “Ton-Atmung” den Raum gefüllt, und Boris atmete ihr mal erleichternd heiter, als riss die Wolkendecke auf, mal angestrengt und schwer zu, wenn sich Neues und Schweres in ‘violetten’ Tonfarben ankündigte und sich auf den elegischen Bögen auslegte, auf diesen Bögen wie über eine Brücke von Pfeiler zu Pfeiler zog. Die Brücke, die gesucht und nötig ist, um von einer Seite auf die andere Seite zu kommen, wenn ein Tal, eine Schlucht, ein Abgrund zu überqueren ist. Das Gefühl bedarf der Brücke, um nicht haltlos abzustürzen beziehungsweise sich himmelwärts in Luft aufzulösen. Das Wort im menschlichen Zuspruch weist auf die Brücke mit dem Überschreitbaren, versucht zu sagen, dass nicht alles verloren ist, dass es die Hoffnung und Liebe gibt. Stärker als das Wort, selbst das Wort der größten Zuneigung und des tiefsten Mitempfindens, weil ausgefüllter, harmonietragender, herznäher und gefühlvoller, sprechen die Töne in der vertikalen Verknüpfung der Sept- Non- und anderen Akkorde sowie die horizontalen Reihungen mit den Ausladungen der elegischen Bögen vom tröstenden Dasein der Brücke. Diese Brücke hatte wohl Boris im Sinn, als er im zweiten Teil des Satzes fester die Akkorde mit der linken Hand griff als im ersten Teil. Er träumte und schwitzte beim Spielen. Er verzog die Lippen, hob und senkte den Kopf, aber drehte ihn nicht. “Da kommt die Hoffnung!”, sagte er, und seine Augen begannen zu leuchten vor Erleichterung und Freude. “Da durchatmet die Musik das Leben tief innen. Ist das nicht wunderbar?! Das ist die beste Botschaft, die ich dir heute Abend mitgeben kann”, sagte er und wandte das Gesicht zu Claude in der Klubecke, der von dem Spiel verzaubert war. Da war ihm selbst das Problem mit Olga, das doch ein Existenzproblem erster Güte war, aus dem Kopf entglitten. Auch leuchteten seine Augen, als hätte sich das Problem gelöst, hätte Olga eine ordnungsgemäße Aufenthaltsbescheinung, bräuchte sie nicht mehr den teuren “Stoff” für den Kerl beschaffen, der ihr so große Versprechungen bezüglich der Ausweispapiere gemacht hatte und weiter machte, wenn und solange er den “Stoff” gratis bekam, hätte Olga diesen lästigen Kerl endlich vom Hals, würde ihre Schulden bei dem Türken bezahlen und hätte sich vor ihm und seiner Prügel nicht mehr zu fürchten.
Claude zeigte keine Zeichen des Gehens. Vielmehr saß er regungslos mit verklärtem Blick in der Klubecke und hörte sich noch den ‘Andante’-Satz an. Da ergriff ihn die Sensibilität und Feinheit der tonalen Versetzungen zwischen Dur und Moll mit den elegischen Ausziehungen. Er versuchte die Atmung auf das musikalische Hinundherschwingen abzustimmen, im Ein- und Ausatmen das Bewusstsein zu halten und zu stärken, dass es die Brücke über die Schlucht gibt, an die man sich halten und die man betreten kann, wenn man von der einen Seite zur anderen, von der dunklen zur hellen, von der schwermütigen zur heiteren Seite will ohne den gefürchteten Absturz von Gefühl und Leben. Keiner hätte diese Atmung mit der Sensibilität für Frieden und Sanftheit oder so schwingungsvoll in der Bestimmtheit des Wollens, des Lebenwollens so voll und fein in den Raum gespielt wie Boris, dachte Claude im stillen Staunen. Und Boris spielte mit geschlossenen Augen. Das Notenbuch brauchte er nicht zum Lesen, die Blätter wurden nicht umgeschlagen. Die Finger taten es besser als beim Lesen. So brachte das Spiel die große Botschaft vom Frieden in den Raum, von der Bedeutungsfülle der ruhigen und rhythmischen Atmung. Es war die großartige Offenbarung von der Einmaligkeit mit der weiten Öffnung des Genies.
“Claude, sei mir nicht böse, aber nun muss ich ins Bett; ich fühle mich nicht wohl”, sagte Boris mit verschwitzter Stirn und blickte auf die ruhenden Tasten nach Beendigung des ‘Andante’-Satzes. “Entschuldige, dass ich nicht selber drauf gekommen bin”, erwiderte Claude, der sich aus dem Sessel erhoben hatte, “aber dein Spiel hat mich in eine Welt gehoben, in der ich gerne länger geblieben wäre. Sie war so groß wie die Weite der Frühlingswiese, über der das Blütenmeer in sanften Wellen wog und der frische Duft die Ankunft der Hoffnung verhieß. Du hast die schöne Welt in den Raum gespielt, nach der ich mich sehnte.” “Diese Welt findest du auch in der Beethoven-Sonate, an der du arbeiten sollst. Tu es mit ganzer Hingabe, und die schöne Welt kommt auf dich zu, wird in dir lebendig”, sagte Boris mit einem sanften Lächeln. Darauf meinte Claude, dass es ihm gegenwärtig schwerfalle, sich auf das Klavierspiel zu konzentrieren, solange das Problem mit Olga nicht gelöst sei. “Dabei werde ich dir helfen und tun, was in meinen Kräften steht”, versuchte Boris seinen Schüler zu beruhigen, ihn zur Arbeit an der Sonate zu ermuntern und zu stärken. Denn er war von der musikalischen und technischen Begabung von Claude überzeugt.” “Geh ans Klavier und übe, damit aus dir ein Pianist wird, dessen Spiel die Menschen mit Freude und Begeisterung erfüllt. Doch ins Üben muss Stetigkeit kommen, dann kommt auch der Erfolg.
Bedenke, dass die Welt der Musik nicht nur schöner ist, sie ist durch ihre Herznähe um ein Vielfaches größer als die äußere Welt, in der wir stehen.” Bei dieser Anmerkung der prinzipiellen Art über die Bedeutung des stetigen Übens wischte sich Boris einige Male den Schweiß von der Stirn. Claude hatte ihn wohl verstanden und dankte dem Lehrer für die Ermahnung, aber noch mehr für die Hilfsbereitschaft in Sachen Geld, um Olga's Schulden zu bezahlen. Er verabschiedete sich und wünschte Boris die gute Besserung. “Komm morgen Nachmittag gegen drei; dann habe ich auch das Geld.” Mit diesem Schlusssatz brachte Boris seinen Schüler an die Tür und gab ihm zum Abschied die Hand. Sie fühlte sich heiß und feucht an. Die depressive Stimmung bei Claude entging ihm nicht. Er überging sie, indem er ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gab und ihn dabei anlächelte, um ihm die Zuversicht mit auf den Heimweg zu geben.
Die Bettlake war nass, als Boris nach einer schlaflosen und durchschwitzten Nacht die Quecksilbersäule herunterschlug und das Thermometer in die rechte Achselhöhle schob. Es waren über 38 Grad Celsius, als er vor dem Versuch des Einschlafens, es war halb elf geworden, die Temperatur gemessen hatte. Er hatte noch einmal eine Tablette zur Fiebersenkung zerkaut und mit Mineralwasser heruntergespült, weil er alles tun wollte, was ihm die Ärztin Dr. Gaby Hofgärtner verordnet hatte. Auch sehnte er sich nach einer ruhigen Nacht, denn seit drei Nächten hatte er nicht mehr richtig geschlafen. Und zum Fieber kamen die Fieberträume, in denen es nicht nur um technische Fehler beim Vortrag des Klavierkonzertes ging, sondern ihm den Blackout mit dem Verlust der Erinnerung über eine ganze Passage der Kadenz des ersten Satzes ins fiebernde Bewusstsein suggerierte, was ihn stöhnen, dann aufschreien ließ, dass ihn Frau Müller, die freundliche Mieterin in der nächst höheren, der zweiten Etage, besorgt am Morgen, es war vor zwei Tagen, fragte, ob ihm etwas zugestoßen sei. Auch in dieser Nacht wurde er vom Blackout geplagt, diesmal im letzten Satz, dem ‘Allegretto grazioso’, dort, wo der Presto-Schlussteil einsetzt. Da klappte nichts: die Dezimen der linken Hand vergriff er ebenso wie die Oktavläufe und Oktavsprünge der rechten Hand. Diese Träume haben ihn stark mitgenommen. Sie haben ihn verunsichert, ja erschüttert. Am Morgen stand ihm der Angstschweiß im Gesicht. Er fühlte sich gedrückt und unfähig, das große Konzert vorzutragen. Dabei wusste er, dass Musiker unter diesen Alpträumen leiden, auch wenn sie kein Fieber haben, und das meist dann, wenn der Konzerttermin nicht mehr weit ist und immer näher rückt.
Das Quecksilber stieg an diesem Morgen wieder bis 38 Grad. Boris hängte sich den Bademantel um und legte ein Handtuch um den verschwitzten Hals. Er ging ins Bad und betrachtete das gerötete Gesicht im Spiegel. Bei der Betrachtung sah er, dass der Hals geschwollen war. Er fühlte ihn ab und spürte einen Druckschmerz unter dem Kieferwinkel. Beim Blick in den geöffneten Mund sah er, dass die Mandeln geschwollen und gerötet waren. Auch waren auf ihnen stecknadelkopfgroße, grauweiße Eiterpunkte zu sehen. Da es nicht das erste Mal war, dass die Mandeln entzündet waren, stellte er vor dem Spiegel die Diagnose der eitrigen Tonsillitis. “Warum hat nicht Mutter die Mandeln rausnehmen lassen? Nun machen sie Probleme, wenn ich sie wirklich nicht gebrauchen kann”, dachte er mit leichter Verärgerung. Er ging in die Küche, rührte zwei Löffel Kochsalz in ein Glas mit aufgekochtem Wasser, ging ins Bad zurück und gurgelte mehrmals das Salzwasser im Rachen bei hochgestrecktem Kopf, sah im Spiegel, dass sich an den Mandeln nicht verändert hatte, putzte die Zähne, wusch das Gesicht, ging wieder in die Küche und machte sich einen Kamillentee. Während das Wasser zum Kochen gebracht wurde, setzte er sich an den Flügel und spielte die Passagen aus dem Brahms-Konzert, die ihm im Fiebertraum aus den Fingern wie aus der Erinnerung genommen waren. Es klappte, wenn auch nicht zur vollen Zufriedenheit, denn der Tonfluss, das “Asyndeton” war nicht so, wie es sein sollte und auch schon war. Doch Boris fand das Selbstvertrauen zurück, strafte den Alptraum Lügen und nahm sich ernsthaft vor, die Ärztin gegen elf aufzusuchen, sich gründlich untersuchen zu lassen und das Antibiotikum gegen die Tonsillitis verschrieben zu bekommen, um vom Fieber und den nächtlichen Alpträumen befreit zu werden. Mit diesen Träumen wollte er sich nicht länger herumquälen, die ihm die Unfähigkeit des Klavierspielens mit dem Blackout suggerierten. So musste er etwas Wirksames zur Stärkung seiner Kräfte unternehmen, um seine Übungen erfolgreich fortzusetzen. Das Konzert musste inwendig wie auswendig sitzen; musste musikalisch und technisch beherrscht werden. Die Partitur musste bis zur letzten Note und dem letzten Detail im Gedächtnis, die technische Problemstellung in den Fingern gelöst sein. Letzteres musste das Ohr und Gemüt im Zuhören durch die Selbstverständlichkeit der spielerischen Leichtigkeit, als hätte es nie ein Problem gegeben, treffen, überzeugen, mitreißen, einnehmen, “sprachlos” machen, damit es den Pianisten im Werk als “Held” bewundern und feiern kann. Denn ob Brahms oder Beethoven, beide treten nicht mehr auf die Bühne, würden sie es tun, man würde großartige Pianisten erleben, die ihre großartigen Tonschöpfungen selbst im Solopart vortrügen. [So verzauberte der junge Beethoven in Wien die Zuhörer durch sein Klavierspiel, die ihm den künstlerischen Beinamen: ‘der Teufelspianist’ oder ‘der Paganini des Klaviers’ gaben.] Das wusste Boris sehr wohl. So durfte auch bei seinem Vortrag nicht erst gesucht oder nachgedacht werden. Der vortragende Pianist ist der Mittelpunkt, auf den alles zugeschrieben ist, auf den alle hören und schauen, wie er’s macht; er ist der Kronzeuge und Beherrscher des gigantischen Tonwerks, der sich vom Orchester tragen lässt. Beim Spiel der Finger mit den Tasten ist der Pianist die ‘Verkörperung’ des Tonwerks. In diesem Gebäude gibt er den Ton an. Der Dirigent verfolgt sein Spiel mit ‘gespitzten Ohren und führt den großen, im Halbrund um den Flügel sitzenden Klangkörper dem Pianisten mit größter Aufmerksamkeit zu und dann wieder weg, wenn der Solopart mehr zu sagen hat oder es allein sagen soll, wie beim Vortrag der Kadenz. Darum war es dringend erforderlich, dass Boris zu Kräften kam und das in allen Bereichen seiner künstlerisch empfindsamen Individualität, denn die kurze Zeit bis zur Aufführung in Warschau drängte.
Es war Freitag. Boris saß zehn vor elf im Wartezimmer der Ärztin Dr. Gaby Hofgärtner. Die Arzthelferin Margit Hoffmann begrüßte ihn freundlich mit den Worten: “Guten Tag, Herr Baródin. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz. Es wird nicht lange dauern. Frau Doktor Hofgärtner weiß, dass Sie für elf Uhr bestellt sind.” Boris nahm Platz und richtete sein Augenmerk auf die Arzthelferin, das beim Telefonieren mit dem Festmachen von Terminen als auch beim Herausziehen der Karteikarten aus dem Karteischrank. Sie gab eine gute Figur ab, wenn sie schrieb oder irgendwelche Eintragungen machte. Die Arzthelferin war eine hübsche junge Frau, deren Alter Boris auf etwa zwei- bis fünfundzwanzig Jahre schätzte. Sie hatte ein schönes, ovales Gesicht mit dunklen Augen und dunklem Haar. Auch hatte sie schön ausgeformte, lange Finger an weichen, schmalen Händen. Als Pianist bestätigte er ihr, ohne es ihr zu sagen, die richtigen Hände für’s Klavier.
Nach etwa zehn Minuten verließ eine Patientin, die schon die Mitte ihres Lebens erreicht haben musste, das Sprechzimmer. Sie schaute Boris ins Gesicht und grüßte ihn mit Namen. Er grüßte zurück, ohne jedoch ihren Namen nennen zu können. Da ihm das fast täglich geschah, hatte er sich daran gewöhnt. Er wünschte dieser Patientin gute Genesung und einen guten Tag, als die Arzthelferin ihn mit den Worten: “Herr Baródin bitte!” zum Eintreten ins Sprechzimmer aufforderte. Dr. Gaby Hofgärtner, eine sympathische Erscheinung der Anfangvierziger, saß hinter dem Schreibtisch und machte ihre Notizen auf der Karteikarte der Patientin, die, das hörte Boris wohl, die Tür zum Betreten wie Verlassen der Praxis leise und gedankenvoll schloss. “Nehmen Sie doch Platz, Herr Baródin”, sagte Frau Dr. Hofgärtner, während sie die Eintragungen machte. Boris setzte sich auf den Patientenstuhl links neben dem Schreibtisch, als die Ärztin sich aus ihrem Stuhl erhob, zum Waschbecken ging und sich die Hände wusch. Sie war eine hochgewachsene Frau mit aufmerksamem Gesicht, in dem Züge der Nervosität im Spiel der Lippen nicht zu verkennen waren. Von fraulich hervortretenden Brüsten konnte man bei ihr nicht sprechen. Überhaupt fanden sich an ihr maskuline Züge. Bei genauer Betrachtung hatte sie ein eher scharf geschnittenes Gesicht mit einer relativ langen Nase und scharf gezogenen Lippen, die dünner ausgefallen waren, als sie Frauen sonst trugen. Im stramm zurückgekämmten Haar waren dünne Grausträhnen, und auf dem leicht vortretenden Kinn lag ein feiner Bartflaum.
Dr. Hofgärtner hatte ein blendend weißes Gebiss, das sie zur Schau brachte, wenn sie lachte, was sie gerne tat. Für einen Spaß oder eine ironische Bemerkung war sie jedes Mal zu haben. “Lachen ist Medizin. Wer lacht, der lebt gesünder.” Das war ein Satz, den diese Ärztin ihren Patienten gab, wenn sie den Eindruck einer beginnenden Depression hatte. Dann fragte sie: “Haben sie heute schon gelacht?” Wenn der Patient oder die Patientin dies verneinte, dann sagte sie: “dann haben sie etwas Wichtiges versäumt.” Stellte die Ärztin ein erhebliches Lachdefizit fest, dann machte sie zweierlei: erstens den Eintrag in die Karteikarte: Neigt zur Depression; und zweitens: “ich erzähle ihnen etwas Lustiges, damit wir darüber lachen können”. An lustigen Geschichten hatte Frau Dr. Hofgärtner ein unerschöpfliches Reservoir. Das Geschichtenerzählen war Teil ihrer Therapie, soweit es die seelische Verfassung des Patienten betraf. Diese Verfassung spielte ihrer Meinung nach eine große Rolle sowohl im Krankwerden, während der Krankheit, als auch in der Bemühung, gesund zu werden. Dabei sollte der Patient oder die Patientin ärztlich unterstützt werden.
Dr. Hofgärtner schaute Boris ins fiebernde Gesicht. “Na, Sie hat es ja ordentlich erwischt, das sehe ich ihrem Gesicht an”, sagte sie mit markanter Stimme, die von der Stimmlage her von einem Mann hätte kommen können. Boris fand diese Bemerkung so banal wie flach. Er war nicht ganz ihrer Meinung und sagte: “Auch wenn es mich stark erwischt hat, um bei diesem Wort zu bleiben, ordentlich finde ich das weniger als im höchsten Grade störend für meine Konzertvorbereitung. Mir bleiben nur noch knapp zwei Wochen zum Üben, dann muss der Brahms vom Flügel perlen. Doch, das sehen Sie mir an, dass ich in meiner gegenwärtigen Verfassung ein Werk wie das Brahms-Konzert nicht vom Flügel perlen kann. So sitze ich tief in der Klemme.” “Das verstehe ich voll und ganz”, erwiderte die Ärztin, “da muss noch ein bakterieller Infekt sein, der sich auf den grippalen Infekt draufgesetzt hat.” Boris: “So ist es, und mich wundert, dass Sie es dem geschwollenen Hals nicht gleich angesehen haben.” Darauf sagte Dr. Hofgärtner, dass ihr der geschwollene Hals schon aufgefallen war: “Ich wäre auf den Hals noch zu sprechen gekommen. Doch zunächst hat der Patient das Wort.” Boris zweifelte an dieser Aussage und lenkte ein, um schneller zur zweiten Stufe, der Untersuchung zu kommen. Er sagte: “Heute Morgen habe ich vor dem Spiegel die Diagnose der eitrigen Tonsillitis gestellt. Ich darf Sie deshalb bitten, mich noch einmal zu untersuchen und mir das richtige Antibiotikum zu verschreiben.” Er erwähnte kein Wort von den nächtlichen Träumen mit dem Blackout, die ihn so stark mitgenommen hatten. Doch da hielt er sich zurück, denn ein Missverständnis wollte er aus beruflichen Gründen nicht erst aufkommen lassen. “Wer versteht schon die Ängste und Sorgen eines Pianisten vor einem Konzert”, dachte er und verstummte. Dr. Gaby Hofgärtner sah ihn schweigend an. Offensichtlich erwartete sie weitere Bemerkungen, die Boris machen würde in Hinsicht auf die Vorbereitungen für das Konzert. Sie wusste, Boris hatte es ihr bereits gesagt, dass er in Kürze das zweite Klavierkonzert von Brahms in Warschau und danach in Moskau spielen würde.
Sie sah ihn an und wartete noch eine kurze Zeit. Doch Boris schwieg und sah in Gedanken auf das Schlauchstethoskop auf ihrem Schreibtisch. “Da wollen wir mal schauen”, sagte sie, stand auf, holte das Laryngoskop aus der obersten Schublade des Schreibtisches, klappte den Mundspatel auf, prüfte das Licht im Birnchen und stellte sich vor den sitzenden Patienten. “Machen Sie den Mund weit auf”, sagte sie und drückte mit dem Metallspatel die Zunge nach unten. “Sie haben die richtige Diagnose gestellt”, sagte sie und zog den Spatel aus dem Mund des Patienten. “Nun möchte ich noch einmal die Lungen abhören.” Boris stand auf, zog Jacke und Hemd aus und stellte sich vor die Ärztin, die ebenso groß wie er war, nämlich einmeterachtzig. “Bitte durch offenen Mund tief ein- und ausatmen.” Boris tat wie gefordert. “Der Lungenbefund hat sich nicht verschlechtert. Ich höre zwar noch ein Giemen und Pfeifen, vor allem in den unteren Abschnitten beider Lungen. Aber eine Lungenentzündung kann ich nicht feststellen. Legen Sie sich nun auf die Liege, dass ich den Blutdruck messen, das Herz abhören und den Bauch abtasten kann.” Boris legte sich auf die Untersuchungsliege und hielt den linken Arm gestreckt nach oben, um den Dr. Hofgärtner die Manschette zum Blutdruckmessen wickelte. “Der Blutdruck ist mit 135 über 90 im Normbereich.” Dann hielt sie den rechten Zeige- und Mittelfinger auf die Speichenarterie von Boris oberhalb vom linken Handgelenk, schaute auf ihre Armbanduhr und zählte die Pulsschläge pro Minute, wofür sie fast fünf Minuten brauchte. “Der Puls ist mit 96 Schlägen pro Minute beschleunigt. Das steht ihnen in Anbetracht des fieberhaften Infektes zu.” Sie hörte das Herz ab, an dem keine abnormen Geräusche über den Herzklappen waren, und tastete schließlich den Bauch ab, wobei sie sagte, dass die Leber leicht vergrößert sei. “Doch die Leber tut mir nicht weh”, erwiderte Boris auf ihre tastdiagnostische Feststellung. “Das mag sein”, sagte Dr. Hofgärtner, “die Leber ist bei entzündlichen Erkrankungen jeglicher Art oft vergrößert. Die Schwellung, die nicht schmerzhaft sein muss, geht wieder zurück, wenn der Körper von der Entzündung befreit ist.”
Boris hörte sich den diagnostischen und prognostischen Kommentar an, ohne ein Wort zu sagen. Denn eine diagnostische Bemerkung von seiner Seite wäre hier sicherlich fehl am Platz gewesen. “Sie können sich anziehen.” Boris erhob sich von der Liege und zog Hemd und Jacke wieder an. Da er kein Schlipsverehrer war, hatte er auch keinen Schlips bei sich. Dr. Hofgärtner saß am Schreibtisch und notierte die Befunde in die Karteikarte. Boris setzte sich auf den Patientenstuhl links neben dem Schreibtisch. “Die Diagnosen lauten”, fasste die Ärztin die Untersuchung zusammen und schaute dem Patienten mit Bestimmtheit ins Gesicht: “1. eitrige Tonsillitis; 2. Bronchitis rechts wie links, stärker in den unteren Lungenabschnitten. Ich verschreibe ihnen ein wirksames Penicillinpräparat, das Sie rasch von beidem kurieren wird”, fasste sie ihre therapeutische Maßnahme zusammen. Sie ergänzte den Therapieplan mit dem Hinweis, das Rauchen einzustellen, dem Boris als Nichtraucher mit größter Leichtigkeit zustimmte. Ein neuer Termin wurde für den folgenden Dienstag vereinbart. Arzthelferin Margit Hoffmann machte den entsprechenden Eintrag in die Einbestellungskladde, deren Deckel mit braunem Kunstleder und der Jahreszahl 1972 überzogen war. Beim Verlassen der Praxis wünschte die Arzthelferin mit einem charmanten Lächeln dem ihr offensichtlich sympathischen Patienten die gute Besserung.
Boris ging in die nächste Apotheke, die Langerhans-Apotheke [nach dem Entdecker der endokrinen Inseln in der Bauchspeicheldrüse benannt], die wenige Häuser von der Praxis von Dr. Gaby Hofgärtner entfernt war. Er trat ein und atmete den Geruch aus dem Gemisch aus Kräutern, ätherischen Ölen, dem Baldrian (Radix valerianae), Penicillin und anderer Medizin tief ein, das ihm zusagte, ihn neugierig machte und seine Lebensgeister schlagartig weckte. Den Atemzügen beim Eintreten gab er die ganze Aufmerksamkeit, weil ihm bei dem “blumigen” Geruchskorb in den Sinn kam, dass so das Gesundwerden riecht. Da berührten Heilgeister die Riechknospen in der Nasenschleimhaut. Manchmal glaubte Boris, wenn er in der Apotheke etwas zu besorgen hatte, diese Heilgeister auch auf der Zunge zu schmecken. Hinter dem Tresen stand Herr Brockmann, der untersetzte und beleibte Apotheker, ein stiller, freundlicher Herr der Mittfünfziger, der sich die Brille in kurzen Intervallen auf dem schmalen Rücken seiner leicht nach links verbogenen Nase zurecht beziehungsweise nach oben schob, als er einer älteren, etwas tütteligen Kundin, die offenbar auch schwerhörig war, die auf dem Rezept verschriebenen Medikamente nebeneinander auf den Tresen stellte und ihr die Häufigkeit der Tabletten- und Tropfeneinnahme pro Tag sorgfältig und lauter als normal mit hochgezogener Stirn erklärte. Dabei kamen seine buschigen, dunklen Augenbrauen, in denen das Grau das Überschrittenhaben der Lebensmitte signalisierte, noch stärker zur Geltung. Vielleicht hatte er, wenn die Stirn hochgezogen war, die Nebenwirkungen eines jeden Medikaments im Sinn, dachte Boris, der das Nebeneinanderstellen der Heil-, Schmerz- und Aufbaumittel, wie sie zur Behandlung alter Menschen in der Geriatrie üblich sind, mit Geduld und Interesse verfolgte. Auch hob er die Brille der Kundin vom Boden auf, die ihr beim Anblick auf die stattliche Zahl der verschiedenen Medikamente und beim Zuhören auf die Erläuterungen des Apothekers, der die Probleme mit seiner ständig runterrutschenden Brille hatte, heruntergefallen war.
Nachdem die Kundin bezahlt, sie das Wechselgeld, das ihr Herr Brockmann an der Kasse zurückgab, gezählt und das braune Lederportemonnaie in die braune Lederhandtasche gesteckt und die Handtasche sorgfältig geschlossen hatte und schließlich die Apotheke mit der grünen Plastiktüte und den Medikamenten verließ, sie stand noch im Eingang und drehte sich der Apotheke erneut zu, um die Tür zu schließen, schob der Apotheker die Brille auf seiner schiefen Nase nach oben und wandte sich dem nächsten Kunden zu. “Was kann ich für Sie tun?”, war seine in die Stereotypie abgerutschte Routinefrage. Er nannte den Kunden nicht beim Namen, obwohl er die ältere, vertüttelte Kundin mit Namen verabschiedete, nachdem er ihr das Wechselgeld gegeben und die Medikamente im grünen Plastikbeutel verstaut hatte, und Boris nicht das erste Mal in dieser Apotheke war. Boris legte das Rezept seiner Ärztin auf den Tresen, das der Apotheker mit wichtiger Miene und hochgezogener Stirn begutachtete. Auch schob er die Brille mit der linken Hand nach oben, als er das Rezept nach Begutachtung in der rechten Hand hielt. “Sie sind nicht der erste”, sagte er zu Boris, während er auf die Tür und den nächsten, eintretenden Kunden, eine Frau mit zwei kleinen Kindern, schaute, “bei vielen war die Grippe nicht kuriert; da hat sich in opportunistischer Weise eine bakterielle Infektion draufgesetzt. Etliche Kunden klagen nun über Pharyngitis oder Bronchitis mit Schluckbeschwerden und Hustenanfällen. Bei den Kindern ist die Tonsillitis weit verbreitet. Da haben die Hals-Nasen-Ohrenärzte Hochkonjunktur, die vereiterten Rachenmandeln zu entfernen.”
Boris hörte sich den Kommentar an, ohne darauf einzugehen, worauf der Apotheker mit hochgezogener Stirn vom Tresen zu den Regalen ging und nach den verschriebenen Medikamenten griff. Mit runtergerutschter Brille kam er zum Tresen zurück, stellte die Sachen nebeneinander und meinte, wobei er sich die Brille nach oben schob, falls das Penicillin aufgrund von Resistenzerscheinungen nicht anspricht, dann solle sich der Kunde ein synthetisches Penicillin der neueren Generation verschreiben lassen. Boris spürte, dass er nun etwas sagen sollte. “Ich werde es erst einmal mit dem einfachen Penicillin versuchen”, sagte er mit ruhiger und fester Stimme, um weiteren Diskussionen aus dem Wege zu gehen. Darauf meinte Apotheker Brockmann mit dem Seitenblick auf die nächste Kundin, die Mutter mit den zwei kleinen Kindern, dass er damit einverstanden sei. Als er die Preise an der Kasse eindrückte, sagte er mit diplomatischer Zunge, offensichtlich im Bestreben, den Kunden nicht zu verlieren, dass es vernünftig sei, erst mit dem Penicillin der alten Generation zu beginnen und nur dann zu wechseln, wenn sich keine Besserung einstellt. “Das macht einhundertzwölf DM und achtundfünfig Pfennig.” Den Kostensatz schloss der Apotheker nahtlos an seine Bemerkung über den sinnvollen Gebrauch der Antibiotika an. Boris zahlte den Betrag, bekam die Quittung, nahm den grünen Plastikbeutel mit den Medikamenten und verließ die Langerhans-Apotheke in der Potsdamer Straße. Dabei entging ihm nicht, dass Apotheker Brockmann ihn beim Verlassen mit dem Namen verabschiedete und ihm eine gute Besserung “bis zum nächsten Mal!” wünschte.
Boris machte noch eine Runde zur nächsten Konditorei. Er hatte nicht gefrühstückt und freute sich auf ein Stück Apfelkuchen mit Sahne und eine Tasse mit gutem Kaffee. An der zweiten Kreuzung bog er von der Potsdamer Straße ab und betrat nach hundertfünfzig Metern die Bäckerei und Konditorei Pollack. Schon beim Öffnen der Tür kam ihm der köstliche Geruch frisch gebackener Brötchen entgegen. Er ging an die Theke, sah sich die Auslagen an und bestellte sich ein Stück Apfelkuchen mit Sahne und ein Stück Käsekuchen, dazu eine Tasse Kaffee. Die junge Angestellte mit blütenweißer Schürze servierte ihm die Bestellung höflich und geschickt auf den zweiten der drei kleinen Tische mit den kleinen quadratischen Tischplatten, die Platz für zwei Kuchenteller und zwei Tassen, also für jeweils zwei Kunden gaben. Boris nippte an der Tasse mit dem heißen Kaffee, dem ein starkes Aroma entströmte und begann mit dem Apfelkuchen, den er dick mit Sahne bestrich. Der Fensterplatz gewährte einen freien Straßenblick, mit dem er die meist hektisch ablaufende Großstadtszene kurz nach zwölf verfolgte. Die Fußgänger waren in Eile, entweder nach Hause zu kommen und das Mittagessen herzurichten oder Besorgungen zu machen. Kinder kamen aus der Schule, und Mütter holten ihre Kleinen vom Kindergarten,
Der Eismann schob das Dreirad mit dem weißen Kühlkasten auf dem Bürgersteig entlang und schaute nach Käufern, die meist Jugendliche oder eben jene Mütter waren, die ihre Kleinen an der Hand führten beim Gang vom Kindergarten oder mit vollen Plastiktüten vom Einkaufen. Es gab magere und heruntergekommene Menschen, meist Männer, die offensichtlich ohne Arbeit waren und vielleicht auch keine Arbeit suchten, die auf der Straße lebten und sich vom Betteln ernährten. Sie waren schäbig gekleidet. Ihre Gesichter waren unrasiert und vom Wetter gezeichnet, die Haare waren wirr und versträhnt. Die Schuhe waren abgelaufen. Manche hoben abgerauchte Zigaretten auf und steckten sie in die Jackentasche. Andere holten etwas aus den Taschen, ob ein Stück Brot, das sie in den Mund steckten, oder einen ‘Flachmann’, den sie nach Losdrehen des Deckels an den Mund führten. Diese obdachlosen Kreaturen, denen das Schicksal gnadenlos im Nacken saß, waren die einzigen Langsamgänger, wenn von den Liebespaaren und ihren Verfolgern abgesehen wurde, mit denen um diese Zeit, wenn die Sonne statt des Mondes über der Stadt steht, kaum zu rechnen war. Die Langsamgänger der Schäbigkeit waren Menschen, die die Straßenszene aus dem ‘ff’ kannten und jeden Tag neu analysierten, wen der Passanten sie ansprechen und um eine Gabe bitten sollten. Es muss Alkoholisches im Flachmann sein, denn ein stark Heruntergekommener in verwahrloster Kleidung mit versträhntem braungrauen Vollbart, der gerade einen Schluck genommen hatte und den Verschluss der Flasche aufschraubte, schaute mit der Flasche in der rechten Hand durch das Fenster, hinter dem Boris sein Stück Käsekuchen verzehrte, und steckte ihm die belegte Zunge raus. Boris nahm es zur Kenntnis und nahm einen Einblick in den Aussteigermund mit dem ‘asozialen’ Gebiss, das nur wenige Zähne hatte, die eine Zahnbürste nicht sahen und als alte, skurrile, braun verschmierte Ruinenreste übriggeblieben waren. Mit dem ihm vergönnten Einblick in die Höhle der Verwahrlosung machte sich Boris sogleich seine Gedanken über Ursache und Konsequenzen eines Lebens, in dem die Regeln und Sitten einer scheinbar geordneten bürgerlichen Gesellschaft entgleist sind, das ohne Boden und Dach ist für das verwahrloste Dasein, dem die Straße den letzten Halt zum Aufenthalt gibt. Nur so konnte Boris die Sprache der herausgesteckten Zunge aus dem verwahrlosten Mund verstehen, indem er dem Rausstecken die Respektverweigerung mit der Ablehnung und Verachtung einer Gesellschaft zuordnete, die in der politischen Spiegelbetrachtung sich marktschreierisch ausnimmt, dass die Wände wackeln und die Fenster zum Luftholen geöffnet werden müssen.
Die Zeichensprache der rausgesteckten Zunge bei diesem ‘Straßenwesen’ war ein klarer Beleg, dass es mit und in der Gesellschaft nicht stimmte. Nach dem Höhlenblick in den ruinierten Mund schaute Boris dem Mann ins Gesicht mit den rissig–trockenen Lippen zwischen dem versträhnten, braungrauen Bart und den dunklen Augen mit dem trüben Blick unter der zerfurchten Stirn mit der wetterfesten Haut und dem wirren Kopfhaar. Es wurde ihm klar, dass der Flachmann zum permanenten Straßendasein gehörte, denn der Mann schwankte in keiner Weise, war also nicht betrunken. Der Inhalt des Flachmanns, der billige Schnaps, war die Medizin, dieses Dasein von Tag zu Tag neu durchzustehen. Der Inhalt, schluckweise genommen, gab ihm den Mut, die Zeichensprache mit der Zunge zu wagen und mit zunehmender Übung die Skrupel zu überwinden, diese Sprache der ‘besseren’ Gesellschaft gegenüber zu gebrauchen. Daran zweifelte Boris nicht, dass diese Sprache des Draußenseins echt und eindeutig genug war, um selbst von einem Tauben verstanden zu werden. Denn oft, besser gesagt viel zu oft, stellt sich die Gesellschaft gegenüber den Nöten der Armen und Verelendeten taub.
Boris gab dem Mann ein Zeichen, holte eine Zwanzigernote vom Wechselgeld der Apotheke aus der Jackentasche und zeigte es ihm. Darauf ging der Mann vor die Tür der Pollack’schen Bäckerei und Konditorei, während er den Rest Käsekuchen auf den Teller legte, vom Speiseraum zur Tür ging, sie öffnete und den Geldschein dem Mann gab. Der bedankte sich mit einem Diener und entschuldigte sich für die rausgesteckte Zunge. Er sagte: “Das kommt nicht alle Tage vor, dass es Menschen gibt, die durch die Tat helfen. So wolle der Herr bitte verstehen, dass die Zungensprache für mich eine Art Notwehr zur Rettung des letzten Restes der Selbstachtung ist. Denn die Gesellschaft hat für unser Dasein und unsere Probleme weder ein Ohr noch ein Verständnis noch einen Platz. Wir haben die Achtung und Beachtung durch die Straße verloren. Ich war gelernter Bauingenieur. Die Firma ging pleite, meine Frau trennte sich von mir, weil sie aus gutem Hause kam und ohne genügend Geld nicht leben wollte. Sie schmiss sich einem Pharma-Vertreter an den Hals, der das genügende Geld brachte. Er heiratete sie, beziehungsweise sie heiratete ihn. Sie leben in Hamburg. Seitdem bin ich für diese Frau gestorben. Von meinem kleinen Besitz ist mir nichts geblieben. Das hat sie mir geradeaus weggepfändet. Nun führe ich ein Leben, das kein Leben mehr ist. Meine Eltern drehen sich im Grabe um. Noch einmal Entschuldigung und vielen Dank.” Boris nickte ihm sein Verständnis zu. Der Mann ging fort, und Boris ging zum Tisch zurück, um den Käsekuchen fertig zu essen. Er bestellte noch eine Tasse Kaffee und sah dem Mann in seiner schäbigen Kleidung gedankenvoll hinterher, als er schließlich in der Menge der Passanten verschwand.
Für Boris war es ein Erlebnis, das ihn ergriffen hatte. Auch er setzte an der Gesellschaft aus, dass sie ungerecht, geistlos und materialistisch sei. Einkommen und Besitz entschieden über Achtung und Stand in der Gesellschaft. Während er bei der zweiten Tasse Kaffee die Verfolgung der Straßenszene wieder aufnahm, traf ihn die zweite Überraschung. Es waren Claude und Olga, die die Straße überquerten und auf die Bäckerei und Konditorei Pollack zugingen. Ob sie ihn am Tisch sitzen sahen, wie er durch’s Fenster auf die Straße sah, konnte Boris mit Sicherheit nicht ausmachen. Sie traten ins Geschäft, gingen auf die Theke zu, als wollten sie etwas kaufen, drehten die Köpfe zum Speiseraum und kamen an den Tisch. “Das ist ja eine Überraschung”, sagte Claude, “dass wir uns hier treffen.” “Setzt euch!”, erwiderte Boris, und die junge Serviererin mit der blütenweißen Schürze stellte den dritten Stuhl an den Tisch.
“Was treibt euch denn her?”, fragte Boris mit dem Quantum Neugier, wie es mit Olga weitergegangen ist, und wie es um sie steht. “Hunger ist’s, der uns hierher trieb”, antwortete Claude. “Für eine warme Mahlzeit im Restaurant reicht das Geld nicht”, erklärte er schlicht. Es war eine Erklärung, die keine Erläuterungen brauchte. “Dann bestellt euch einen Apfelkuchen mit Sahne und einen Käsekuchen. Die kann ich euch empfehlen und lade euch zum Kuchenessen ein”, sagte Boris. Dabei blickte er in das melancholische Gesicht von Olga mit den slawischen Merkmalen der betonten Jochbögen im fast quadratischen Gesicht mit den dunkelbraunen Augen, den leicht abstehenden Ohren und dem flachen Hinterkopf. Er gab die Bestellung für die beiden auf. Dazu bestellte er für jeden eine Tasse Kaffee. Claude bemerkte die Aufmerksamkeit, die Boris seiner Freundin gab. Da wollte er vermitteln. “Es hat sich seit gestern nichts Neues ereignet, was zu berichten wäre”, sagte er im ruhigem Ton. Doch entging Boris nicht das nervöse Zwinkern der Augen. Olga scheute sich, Boris ins Gesicht zu sehen. Sie hielt ihren Blick auf den Tisch gerichtet und schwieg. Sie schwieg auch, als Claude erwähnte, dass der türkische Dealer hinter ihnen beziehungsweise dem ausstehenden Geld her sei. Olga hielt ihren Blick auf den Tisch gerichtet, als Boris sagte, dass er im Anschluss zu seiner Bank, der Dresdner, gehen werde, um das Geld zu beschaffen. Die beiden aßen die Kuchen mit Heißhunger, dass Boris sie fragte, ob er noch Kuchen bestellen solle. Olga enthielt sich der Aussage, während Claude mit zwinkerndem Blick zugab, dass er noch ein Stück vertragen könnte. Boris gab der jungen Serviererin ein Zeichen, die an den Tisch kam, die Bestellung entgegennahm, zur Theke ging und drehenden Fußes zwei Teller mit Käsekuchen brachte. Boris, der die Verfolgung der Straßenszene dann fortsetzte, als sich die beiden ein Kuchenstück in den Mund schoben, dachte über die Welt, die beiden und sich selbst nach. Er fragte sich, was die Zukunft für alle und für ihn im Besonderen bereithält. Er tat es still, um den beiden das Kuchenessen nicht zu vermiesen und in seiner Meditation aus dem Blickwinkel der Straße und ihrer nicht immer nachvollziehbaren Hektik weder anzuecken noch angeeckt zu werden.
“Besteht denn die Chance, diesen Kerl, der ihnen einiges versprochen hatte, wieder loszuwerden?”, fragte Boris nach seiner ‘Rückkehr’ von der Straße die beiden, nachdem sie die Kuchengabeln auf die leeren Teller gelegt hatten. Claude wischte sich mit der Serviette über den Mund: “Das können wir nur hoffen, und wir hoffen es, denn ein Leben in ständiger Bedrohung ist fürchterlich. Nachts können wir nicht ruhig schlafen, weil wir befürchten, dass dieser Kerl mit einem Messer, einer Pistole oder sonst einem Mordinstrument vor uns steht. So liegen wir über Stunden schlaflos im Bett und erschrecken beim kleinsten Geräusch im Hause. Da Olga auch jetzt noch auf die Tischplatte blickte und schwieg, was für Boris bei aller Geduld und dem Höchstmaß an Verständnis nicht zu erklären und auch nicht mehr annehmbar war, weil ja Olga das Problem hatte beziehungsweise war, fragte er nun direkt, was sie, Olga, dazu zu sagen hätte. “Nichts anderes”, antwortete sie, nachdem eine Denkminute verstrichen war, “was Claude gesagt hatte.” Das passte nicht ins Denkmuster von Boris, der sich Sorgen um seinen begabten Schüler machte. Es waren Sorgen, die nicht er, sondern sie verursacht hatte. Boris schaute ihr auf die markante, etwas tiefe Stirn und betrachtete ihr rechtes Profil von schräg oben mit dem vollen dunklen Haar, unter dem sich das größer als normal ausgefallene Ohr versteckte, so dass das Abstehen der oberen Ohrmuschelpartie verdeckt blieb. Boris entging nicht die blau verfärbte rechte Wange als Folge der Ohrfeige von dem türkischen Dealer. Ihr Blick haftete auf der Tischplatte, fuhr die leer gegessenen Kuchenteller ab und schien sich an der Form der kurzen, dreizinkigen Kuchengabel auf ihrem Teller festgeguckt zu haben, an der die linke Gabelzinke an die Mittelzinke herangebogen war. Während Boris auf eine Antwort von ihr wartete, fragte er sich, ob Olga schüchtern, verstockt oder dickköpfig sei, denn zu lange brauchte sie mit der Reaktion, eine Antwort auf seine Frage zu geben. Claude zwinkerte verlegen von der andern Seite über den Tisch ins Gesicht von Boris. “Sag etwas, Olga, du weißt es doch am besten. Jetzt musst du reden!”, sagte Claude.
Olga hob ihr lädiertes Gesicht, schaute Boris kurz an, dann senkte sie das Gesicht und hielt sich mit dem Blick an der Tischplatte fest, von der die junge Serviererin die leeren Tassen und Teller taktvoll wegräumte, nachdem Boris ihre Frage nach weiterem Kuchen und Kaffee verneint hatte. “Ich denke schon”, begann Olga mit der erwarteten Erklärung im russischen Sprachakzent, “dass ich diesen Mann loswerde, wenn ich ihn bezahlt habe. Das Problem ist der andere Mann, der versprochen hat, mir die rückdatierte Aufenthaltsbescheinigung zu beschaffen. Es ist ein junger Bankangestellter, der den Stoff braucht. Wenn ich ihm den nicht weiter beschaffe, wird er sein Versprechen nicht einlösen.” Nun schwieg sie und brachte nach einer weiteren Schweigeminute, wobei sich ihr Blick an der Tischplatte wieder “festklemmte”, ihre Sorge zum Ausdruck, dass sie nicht wisse, wie sie sich verhalten solle. Claude zwinkerte besorgt seinem Lehrer zu, der ein ernstes Gesicht machte: “Wissen Sie, Olga, dass Sie in einer gefährlichen Gesellschaft sind? Zwei Männer, die alles andere als ehrbare Gestalten sind, haben Sie in die Zange genommen, der eine, der türkische Drogendealer von links und der junge Bankangestellte, der ihnen da was versprochen hat, was mit sauberen Mitteln nicht zu machen ist, von rechts. Da fällt mir im Augenblick nichts ein, wie Sie aus der gefährlichen und gemeinen Zange herauskommen können. Doch aus dieser Zange müssen Sie heraus, bevor Sie ganz vor die Hunde gehen, wenn ich das so formulieren darf.” Olga blieb mit dem Blick an der Tischplatte kleben, während Claude augenzwinkernd durch das Fenster auf die belebte Straße und von der Straße zurück auf den abgeräumten Tisch sah und dabei das Gesicht von Boris mit Unsicherheit und Hilflosigkeit streifte. “Ich verstehe ihr Problem”, fuhr Boris fort, “dass Sie in der Bundesrepublik bleiben wollen und dazu die entsprechenden Papiere brauchen. Aber so, wie Sie es begonnen haben, um an eine Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, haben Sie sich selbst den Weg versperrt. Denn glauben Sie doch nicht, dass das mit einem gefälschten Papier zu machen ist. Früher oder später, ich meine sehr bald, wird die Sache auffliegen und Sie werden wegen Drogenbesitz und Anstiftung zum Betrug eine dicke Strafe bekommen, die es verbietet, dass Sie in Deutschland bleiben können. Sie werden dorthin abgeschoben, woher Sie gekommen sind, nämlich nach Russland, wo ihnen dann eine noch härtere Strafe droht, die Sie mit einigen Jahren Gefängnis unter russischen Bedingungen absitzen werden. Bedenken Sie das bitte! Je eher wir Sie aus dieser gefährlichen Zwangslage, dieser gemeinen Zange der Erpressung von rechts und von links herausholen können, um so besser ist es für Sie.” Diese Worte waren stark, dass Olga den Blick von der Tischplatte löste und aus ihren dunklen Augen Boris ins Gesicht sah. Sie schaute ihm in die Augen, hielt dem Augenblick für einige Sekunden stand und sagte: “Herr Baródin, ich sehe das auch so, doch weiß ich nicht, wie ich aus dieser Zwangslage herauskomme.”
“Darüber müssen wir nachdenken, und das müssen wir gründlich tun, ehe alle Bemühungen zu spät sind”, erwiderte Boris. Er fuhr fort: “Wir müssen beide Männer bei Tage vors Gesicht bekommen, wir müssen mit ihnen reden, was ihre Bedingungen sind, damit die Sie aus ihren Erpresserklauen freigeben. Ich weiß nur nicht, wie wir das am besten anstellen. Doch um ein Treffen mit einer Gegenüberstellung und einem Gespräch kommen wir nicht herum. “Ich glaube nicht”, warf Olga ein, “dass der Türke wie auch der junge Bankangestellte dazu bereit sind. “Dann wird es schwierig. Darauf habe ich jetzt auch keine Antwort. Wissen sie denn, wie die beiden Männer heißen?”, fragte Boris. “Der Türke heißt angeblich Isman und der Bankanstellte Rudolf. Mehr weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, ob das die richtigen Namen sind”, so Olga. Boris: “Aber sie wissen, wo die beiden zu finden sind.” Olga: “Der Türke wohnt mit anderen Ausländern in einem verkommenen Mietshaus in Wedding. Rudolf, der Bankangestellte, den traf ich jedes Mal am Abend auf dem Reuter-Platz, wo ich ihm den Stoff übergab. Wo Rudolf wohnt, und wo er arbeitet, das weiß ich nicht.” Da unterbrach Claude: “Hast du nicht einmal gesagt, dass du ihn in der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank gesehen hast?” Olga: “Sicher war ich mir nicht, auch wenn der Typ am Schalter dem Rudolf verdammt ähnlich sah.” Nun funkte es bei Boris, der sein Konto bei derselben Filiale derselben Bank hatte. “Mir kommt die Idee”, sagte er, “dass ihr mich zu dieser Filiale begleitet, denn dort habe ich mein Konto. Ich werde nach einem Herrn Rudolf fragen, wenn ich meinen Scheck einlöse.” So brachte der Zufall des Zusammentreffens in der Bäckerei und Konditorei Pollack einen ersten Lichtblick, dem zu folgen war, um das Problem ‘Olga’ anzugehen. Boris: “Wir müssen uns hier schon überlegen, wie wir es am klügsten anstellen, damit Olga den Mann am Schalter als Rudolf identifizieren kann, ohne dass er Olga sieht. Von draußen ist es nicht, vom Eingang bei geöffneter Tür vielleicht möglich. Olga muss also die Bank betreten. Sie darf ihn nur kurz ins Visier nehmen, muss mit dem Rücken zum Schalter stehen oder sich an den Tisch mit den Bankformularen setzen und ein Formular ausfüllen.” Olga sah mit fragendem Blick Boris an. Claude zwinkerte mehr unentschlossen als tatendrängerisch über den Tisch, durch’s Fenster auf die Straße, wo nach der Mittagszeit der Passanten- und Autoverkehr zugenommen hatte, und von der Straße zurück auf den leeren Tisch. “Lasst uns das Glück probieren! Mehr, als es auf die Probe zu stellen, können wir jetzt auch nicht,” gab Boris das Fanal zum Aufbruch und mit erhobener Hand der jungen Serviererin mit der blütenweißen Schürze das Zeichen zum Bezahlen. Er steckte ihr aufgrund ihres charmanten Auftretens ein stattliches Trinkgeld zu, was sie als ein hübsches Mädchen mit einem breiten Lächelns und einem wohlklingenden Dankeschön entgegennahm. “Vielen Dank und bis zum nächsten Mal”, sagte sie und öffnete den Tischkunden die Tür. Beim “.bis zum nächsten Mal” kam Boris der Apotheker Brockmann mit der runterrutschenden Brille auf der nach links verbogenen Nase in den Sinn, der ihn beim Verlassen der Apotheke mit dem Namen verabschiedete und auch “bis zum nächsten Mal” sagte, dem er statt des “vielen Dank” eine gute Besserung voranschickte.
Claude und Olga begleiteten Boris zur Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank. Sie nahmen, da die Zeit vorbeigeeilt war, ein Taxi. Sie hatten nur wenige Meter zur Bank. Ein austretender Kunde hatte die Tür geöffnet und hielt sie denen offen, die im Begriff waren, einzutreten. Olga stand hinter Boris und sagte “am Schalter links”. Offenbar hatte sie den jungen Angestellten mit dem Namen “Rudolf” hinter diesem Schalter erkannt, der mit dem Geldzählen beschäftigt war, so dass er Olga am Eingang nicht sah, die sich hinter dem Rücken von Boris versteckt hielt. Boris ging auf den linken Schalter zu und stellte sich in die Reihe der Wartenden. “Rudolf” hinter dem Schalter machte einen sympathischen und hellen Eindruck. Er bediente die Kunden freundlich und schnell. Ihm ging die Arbeit mit dem Geld, den entgegengenommenen Schecks und den Formularen flott von der Hand. Boris konnte sich gar nicht vorstellen, dass dieser junge, gut gekleidete Mann mit dem olivgrünen Schlips (grün als Logofarbe dieser Bank), dem sympathisch-freundlichen Auftreten und der zügig-flotten Kundenbedienung zu jenen Entgleisten gehörte, die zur Droge griffen. Vor ihm stand eine junge Frau der Mittdreißiger, die diesem “Rudolf” schmeichelte, als sie ihm sagte, wie gut ihm der sandfarbene Anzug mit der olivgrünen Krawatte stünde. Sie erntete für das Anziehkompliment ein dürftiges “Danke, sehr freundlich”, während er die Geldnoten zählte und vor ihr hinblätterte, die Scheine mit den Wasserzeichen und den anderen Vorkehrungen je nach eingedruckter Zahl geordnet, die dreistelligen rechts und die zweistelligen links. Die Dame grüßte den Angestellten beim Verlassen des Schalters, nachdem sie die Geldscheine in ihre Handtasche gesteckt und die Verriegelung geschlossen hatte. “Rudolf” wünschte ihr einen schönen Tag.
Nun war Boris an der Reihe. Er gab sich von der höflichen Seite und hatte der schmeichelnden Frau mehr als nötig Platz gemacht, als sie den Schalter verließ, wobei er ihr kurz nachblickte, zum Ausgang sah, um sicher zu sein, dass Claude und Olga nicht zu sehen waren. Er hielt den ausgefüllten Scheck über zweitausend DM in der Hand, als er die Probe aufs Exempel startete: “Guten Tag! Haben sie einen schönen Namenstag gefeiert?” “Wie kommen sie darauf?” “Gestern war doch der Namenstag von Rudolf. Oder sind Sie vielleicht nicht katholisch?” “Katholisch bin ich schon, aber mein Name ist Eberhard.” “Dann entschuldigen Sie bitte, ich dachte, ihr Name sei Rudolf.” “Was kann ich für sie tun?” “Drei Dinge: erstens den Scheck einlösen; zweitens mir sagen, wieviel auf meinem Konto ist; drittens benötige ich ein kurzfristiges Darlehen, wobei ich mein Konto überziehen möchte.” “Fangen wir mit Punkt ‘zwei’ an”, schlug der Bankangestellte Eberhard, alias Rudolf, vor. “Das ist mir auch recht”, erwiderte Boris zufrieden, dass er in der Sache ‘Olga’ einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan hatte. Der Bankangestellte tippte die Kontonummer in den Computer: “Auf ihrem Konto sind fünftausendsiebenhundertsechsundreißig DM.” “Dann lösen Sie bitte erst einmal den Scheck ein.” Eberhard, der freundliche junge Mann schien keinen Verdacht geschöpft zu haben, als er die Summe in Hunderter Noten auf die Schalterplatte hinblätterte. “Wie hoch soll der Kredit sein?”, fragte er, als Boris die Scheine in die rechte Hosentasche schob. “Fünfunddreißigtausend soll er sein.” “Aber Sie können das Konto nur bis fünfundzwanzigtausend DM überziehen.” “Das hilft mir aber nicht.” “Dann müssen Sie bitte mit dem Filialleiter sprechen, denn der von ihnen gewünschte Betrag überschreitet meine Kompetenz.” “Da darf ich Sie bitten, mich bei ihrem Filialleiter anzumelden.” “Einen kleinen Augenblick, ich versuche Herrn Groß, unseren Filialleiter zu verständigen.” Der Bankangestellte verließ für Minuten den Schalter und ging in die hinteren Gefilde, wo sich die Schreibtische gegenüberstanden. Dann bog er links ab und war nicht mehr zu sehen. Er kam mit dem Filialleiter zum Schalter zurück, wo Herr Groß den Kunden Boris Baródin begrüßte und ihn zu einem vertraulichen Gespräch in sein Büro bat.
“Kommen Sie bitte da rechts entlang, Herr Baródin, ich komme ihnen entgegen”, sagte der Filialleiter. In dem schmalen Gang rechts neben dem Schalter öffnete Herr Groß elektronisch die Sicherheitsverriegelung und dann die Tür mit der dicken Mattglasfüllung. Er begrüßte den Kunden mit Handschlag und den Worten: “Es ist schön, dass wir uns persönlich kennenlernen”. “Ganz meinerseits”, erwiderte Boris, als sie auf dem Gang zum Büro des Filialleiters waren. Herr Groß gab dem Kunden den Vortritt in sein Büro, bot ihm den gepolsterten Stuhl vor dem Schreibtisch an, schloss die mit Mattglas gefüllte Tür und nahm seinen Platz auf der anderen Schreibtischseite im schwarzledernen, gepolsterten Schreibtischstuhl auf Rollen mit hoher Rücklehne und gepolsterten Armlehnen ein.
“Was kann ich für Sie tun?” Freundlich wie geschäftstüchtig kamen die Worte des zurückgelehnten Leiters der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank über die aufgeräumte und polierte Schreibtischplatte. “Wie mir Herr Kleinert sagte, suchen Sie nach einem kurzfristigen Kredit, den wir ihnen prinzipiell auch gerne einräumen. Da Sie ihr laufendes Konto damit belasten, wenn sie auch den Kredit nach kurzer Zeit zurückzahlen möchten, wird die Überziehungsgrenze dennoch überschritten. Das wiederum überschreitet die Kompetenz von Herrn Kleinert, der Sie deshalb an mich verwiesen hat.” “Das verstehe ich”, sagte Boris mit ernstem Gesicht, “aber mir geht es gar nicht um einen Kredit. Ich komme wegen einer ganz anderen Sache, die für Sie als Filialleiter wahrscheinlich viel schwieriger ist als mir aus dem Bauch der Bank einen Kredit zur Verfügung zu stellen.” “Ach so, dann kommen Sie wegen einer anderen Sache”, wiederholte Herr Groß, der nun aufrecht in seinem gepolsterten Ledersessel saß. “Ja, so ist es, und ich bitte Sie, das Gespräch als vertraulich zu betrachten”, fuhr Boris fort. “Aber das ist selbstverständlich”, sagte der Filialleiter.
Boris: “Die Sache ist folgende: Der junge Angestellte am Schalter, den Sie Herr Kleinert nennen, belästigt beziehungsweise erpresst eine junge Dame, die eine Bekannte von mir ist. Die junge Frau ist eine russische Emigrantin, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in der Bundesrepublik lebt. Herr Kleinert versprach ihr, diese Genehmigung zu beschaffen und sie rückwirkend auf den Tag ihrer Einreise zu datieren.” Filialleiter: “Das ist ja unglaublich. Sind Sie sicher, dass es sich hier um Herrn Kleinert handelt?” Boris: “Der Verdacht ist stark, die junge Frau hat ihn am Schalter wiedererkannt, der sich ihr gegenüber als “Rudolf” ausgibt.” Filialleiter: “Das will gar nicht in meinen Kopf, dass Herr Kleinert so etwas tut, der ein freundlicher und kompetenter Mann bei der Arbeit ist. Ich muss es sagen, dass Herr Kleinert einer meiner besten Mitarbeiter ist.” Boris: “Das möchte ihnen allzugern glauben, doch damit räumen Sie, Herr Groß, meinen Verdacht auf vorsätzlichen Betrug nicht aus. Hinzu kommt, dass dieser Herr “Rudolf” – der Filialleiter unterbrach kurz: “der Bankangestellte heißt Eberhard Kleinert” – als Gegenleistung der jungen Frau zur Auflage gemacht hat, ihn bis zur Fertigstellung der gefälschten Aufenthaltsgenehmigung mit Heroin zu versorgen, für das er nicht zu bezahlen hat.” Filialleiter: “Das schlägt ja dem Fass den Boden aus!” Boris: “Sie sagen es! Es ist ein Fass ohne Boden. Da liegen die Folgen der Erpressung mit dem Dilemma der Bezahlungen und des Überlebens auf der Hand. Die junge Frau, die begreiflicherweise ohne Arbeit, ich meine, ohne gesetzlich erlaubte Arbeit ist, pumpt sich das Geld zusammen, um für den “Rudolf” den Stoff zu beschaffen. Ein junger Mann, der ein Schüler von mir ist, hat ihr bislang das Geld gegeben, um sie aus der Misere zu retten. Für die letzten beiden Lieferungen hatte auch er kein Geld mehr. Weil die Zahlungen noch ausstehen, hat der Dealer, ein skrupelloser Türke in Wedding, die junge Frau gestern fürchterlich verprügelt, dass ich, als mir mein Schüler das berichtete, geraten habe, dass sie einen Arzt aufsuchen solle, der die Verletzungen attestiert und sie behandelt.” Filialleiter: “Das hört sich ja schlimm an. Ich kann es gar nicht glauben.”
Boris: “Die junge Frau hat aber Angst, weder eine Anzeige bei der Polizei zu machen, noch für das Attest und die Behandlung einen Arzt aufzusuchen, weil sie keine ordentlichen Papiere hat und daher befürchten muss, in das Land ihrer Herkunft abgeschoben zu werden.” Filialleiter: “Das kann ich verstehen. Aber nicht verstehen kann ich, dass es mein Mitarbeiter Eberhard Kleinert sein soll, der auf solch betrügerische Weise einen Menschen erpresst.” Boris: “Nun brauche ich ihre Hilfe, Herr Groß. Ich will der jungen Frau das Geld für die letzten Lieferungen geben, damit sie vor dem Türken ihres Lebens sicherer wird. Das reicht aber meines Erachtens nicht. Das Fass muss wieder einen Boden bekommen, wenn das Leben der jungen Frau nachhaltig gesichert werden soll. Denn ohne Boden lebt die Frau weiter in Angst. Ihr Leben ist in Gefahr, wie es die Erpresser mit ihr treiben. Wir, ich meine Sie und ich, müssen dem gefährlichen Treiben, das einer Versklavung und einem Menschenhandel gleichkommt, ein Ende setzen. Wir müssen dem Problem auf den Grund gehen, je eher, desto besser ist es für das gefährdete Leben der jungen Frau, die dem erpresserischen Treiben hilflos ausgesetzt ist.”
Filialleiter: “Was soll ich tun; was schlagen Sie vor, Herr Baródin?” Boris: “Mein Vorschlag ist, erstens, ein Gespräch mit Herr Kleinert zu führen; zweitens, ein paar Tage bis zu diesem Gespräch verstreichen lassen, damit er keinen Verdacht vorzeitig schöpft; drittens, eine Hausdurchsuchung zu veranlassen, wo Reste des Heroins, die gebrauchten Spritzen und Nadeln als Beweismaterial sichergestellt und forensisch untersucht werden; viertens, ein Bekenntnis, dass Herr Kleinert vorsätzlich, betrügerisch und erpresserisch an der jungen Frau gehandelt und ihr Leben dem unzumutbar hohen Risiko ausgesetzt hat; fünftens, eine eidesstattliche Versicherung, dass er ab sofort die wehrlose Frau in Ruhe lassen soll. Wenn wir das schaffen, dann bekommt das Fass einen Boden. Die Besorgung des Fassdeckels, das ist der skrupellose und brutale Türke, das wäre dann die zweite Prozedur.”
Filialleiter: “Ich denke, dass wir das Drogendezernat gleich einschalten sollten. Denn spätestens dann schöpft Herr Kleinert den Verdacht, wenn ich mit ihm über das ernste Problem spreche. Sofort danach räumt er die Wohnung auf, entfernt die Dinge, die als Beweismaterial dienen können.” Boris: “Da stimme ich ihnen zu. Die Chance, um an das Beweismaterial zu kommen, ist am größten, bevor er den ersten Verdacht schöpft.” Filialleiter: “Wenn Sie mich mit diesem Gespräch, bildlich gesprochen, auch aus dem Sessel geschmissen haben, so danke ich ihnen, Herr Baródin, für die Mitteilung, die eine für mich sehr schlechte ist und eine unmittelbare Prüfung verdient. Sollte ihr Verdacht zutreffen, dann wären die sofortige Entlassung aus der Dresdner Bank und die gerichtlichen Maßnahmen die Folgen.” Boris: “Es tut mir leid, dass ich Sie mit diesem Problem konfrontiere. Es ist aber zu schwerwiegend, als dass es verschwiegen werden kann. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. oder mit anderen Worten am Rande des Abgrunds.”
Filialleiter Groß machte ein ernstes Gesicht: “Da stimme ich ihnen zu. Mein Vorbehalt ist lediglich der, dass es sich noch um einen Verdacht, wenn auch um einen sehr schwerwiegenden handelt. Fangen wir mit der Hausdurchsuchung an, damit wir den Verdacht am wirkungsvollsten bestätigen oder entkräften können. Ich werde Sie über das Ergebnis auf dem laufenden halten. Ihre Telefonnummer finde ich sicherlich bei ihren Daten zur Personenangabe im Computer.” Boris: “Ich kann ihnen diese aber noch einmal geben. Sie ist die 3745883. Ich möchte Sie bitten, diese Nummer nicht ungeschützt auf ihrem Schreibtisch liegenzulassen, sondern, wie das ganze Gespräch, streng vertraulich zu behandeln.” Filialleiter: “Das ist selbstverständlich. Die vertrauliche Behandlung des Gespräches und ihrer Telefonnummer verspreche ich ihnen.”
Boris verabschiedete sich nach dem fast einstündigen Gespräch über Betrug, Erpressung und das Recht des Menschen auf ein geschütztes Leben vom Leiter der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank. Herr Groß begleitete den Kunden bis zur ersten Sicherheitstür mit der dicken, schusssicheren Mattglaseinfassung, die er elektronisch durch Drücken einer Zahl auf der Zahlentafel links an der Wand öffnete, als das grüne Birnchen aufleuchtete.
Beim Verlassen der Bankfiliale drehte Boris den Kopf nicht zum linken Schalter, um dem Blickfang des Angestellten Eberhard Kleinert, alias Rudolf, der sich seine Gedanken über den Inhalt des übermäßig langen Gespräches mit dem Filialleiter gemacht haben konnte, auszuweichen und mit dem Blick und dem gezielten Geradeausgehen zum Ausgang den Verdacht oder die Befürchtung zu zerstreuen, dass über Erpressung und die Heroinbeschaffung gesprochen wurde, aber nicht über das gewünschte Kurzdarlehen von fünfunddreißigtausend DM. Auch beim automatischen Türschließen am Ausgang drehte sich Boris nicht um, sondern behielt den Blick auf die Straße gerichtet. Er ging rechts ab, ohne zu wissen, wo sich Claude und Olga versteckt hielten, denn von ihnen war weit und breit nach beiden Seiten nichts zu sehen. An der nächsten Kreuzung drehte er sich kurz um und sah die beiden, von der anderen, der linken Seite kommen. Sie mussten ihn beim Verlassen der Bankfiliale gesehen haben und folgten ihm nun mit zügigen Schritten, ohne in der Menge der Passanten besonders aufzufallen. Boris wartete hinter der Ecke in der kreuzenden Straße auf sie, damit er von der Bank aus nicht mehr zu sehen war. “Na, das hat ja lange gedauert”, sagte Claude, während Olga sich in Schweigen hüllte. Boris, der sich auf der richtigen Fährte sah, dem Fass ohne Boden wieder den Boden dranzunageln, wollte auf offener Straße nichts zur Begegnung mit dem “Rudolf” und erst recht nichts zum Gespräch mit dem Filialleiter Groß sagen. “Kommt!, wir nehmen das nächste Taxi”, sagte Boris, “und hier wird kein Wort gesprochen!” Der nächste Taxistand lag nur wenige Meter vor ihnen. Sie stiegen ein, und Boris gab nicht seine Wohnung, sondern eine der nächsten Querstraßen zur Knesebeckstraße an. Während der Fahrt plauderten sie über das anstehende Konzert in Warschau, dann in Moskau. Boris sagte, dass er hoffe, bald wieder zu Kräften zu kommen, die jeder Pianist braucht, wenn er das zweite Klavierkonzert von Brahms vortragen will. Sie stiegen aus dem Taxi, und Boris bezahlte durch’s Fahrerfenster, wobei er auf das Wechselgeld verzichtete und es dem Fahrer als Trinkgeld dazugab. Gut gelaunt fuhr der Fahrer davon, und die drei machten sich auf den Weg zur Knesebeckstraße 17, der Wohnung von Boris im ersten Stock.
Sie gingen die Treppe hoch und sahen einen Briefumschlag im Türschlitz stecken. Boris schöpfte den richtigen Verdacht und hielt den Zeigefinger vor die Lippen, damit von beiden Begleitern kein Wort gesprochen wurde. Er nahm den Brief, schloss die Wohnungstür auf, die drei betraten die Wohnung, und Boris schloss leise die Tür. Im Flur besah er sich den zugeklebten Briefumschlag, auf dem als Absender das Polizeipräsidium Berlin angegeben war. Die drei standen noch im Flur, Boris hielt den Briefumschlag ungeöffnet in der Hand, als es an der Tür klingelte. Es war die Mieterin vom Erdgeschoss, die mitteilte, dass zwei Herren von der Polizei in Zivil nach ihm gefragt hätten. Da er außer Hauses war, hätten sie bei ihr geläutet und sich nach dem Herrn Baródin erkundigt. Schließlich hätten sie einen Brief in den Schlitz seiner Wohnungstür gesteckt. Boris bedankte sich bei der Mieterin für ihre Kooperation und sagte, ihr den verschlossenen Umschlag in der Hand zeigend, dass er den Brief in der Hand, aber noch nicht geöffnet habe. “Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.” Mit diesen Worten mietshäuslicher Anteilnahme verabschiedete sich Frau Herta Steinfeld und ging die Treppe herab.
Boris ging mit Claude und Olga ins Musikzimmer, das sein berufliches Arbeitszimmer war, und Olga und Claude setzten sich in die schmalen Sessel in der engen Klubecke. Boris öffnete im Stehen den Briefumschlag und holte einen handgeschriebenen Zettel heraus, auf dem ganz oben das Wort “Eilt!” zweimal unterstrichen stand. Darunter folgten das Datum des Tages und sein Name mit der Wohnanschrift. Darunter kam der Text, der aus zwei Sätzen bestand: “Bitte beim Drogendezernat melden: Telefon: 20147-3445. Eine Hausdurchsuchung bei Herrn E. Kleinert wegen des Verdachtes auf unerlaubten Drogenbesitz kann ohne vorherige Anzeige nicht erfolgen.” Unter der unleserlichen Unterschrift stand “Kriminalrat”. Boris informierte die beiden, die ihn beim Lesen des Schreibens aufmerksam beobachteten, über den Inhalt. “Ich muss dort sofort anrufen. Über das Treffen mit “Rudolf” am Schalter der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank und das Gespräch mit dem Filialleiter werde ich euch anschließend berichten.”
“Drogendezernat Wilhelm”, so meldete sich mit ruhiger Stimme Herr Wilhelm am anderen Ende der Leitung. “Hier spricht Boris Baródin von der Knesebeckstraße 17. Guten Tag! Ich halte ein Schreiben von ihnen in der Hand. Die Unterschrift kann ich allerdings nicht entziffern. Es ist ein Kriminalrat.” Herr Wilhelm unterbrach: “Kriminalrat Stumm muss es gewesen sein, der mit einem Kollegen in die Knesebeckstraße 17 gefahren war, um Sie zu sprechen. Ihre Anschrift hat er von der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank erhalten.” Boris: “Wahrscheinlich von Filialleiter Groß.” Herr Wilhelm: “Das kann ich nicht sagen; aber möglich ist es. Herr Baródin, ich darf Sie bitten, mich im Dezernat, Polizeipräsidium, fünfter Stock, Zimmer 517 aufzusuchen. Es geht um die Drogensache Kleinert. Aber ohne schriftliche Anzeige von ihnen können die weiteren Maßnahmen nicht unternommen werden.” Boris: “Ich verstehe.” Herr Wilhelm: “Sie müssen also zu mir kommen, damit ich eine Anzeige aufsetzen kann, die von ihnen zu unterschreiben ist.” Boris: “Wann soll ich kommen?” Herr Wilhelm: “Sie können gleich kommen.” Boris: “Im Augenblick habe ich Besuch, aber in einer Stunde wäre es möglich.” Herr Wilhelm: “Das ist in Ordnung. Wir sehen uns in einer Stunde.” Dann legte der Beamte den Hörer auf.
“Ihr seht, die Sache kommt ins Rollen”, sagte Boris zu Claude und Olga und legte den Hörer auf. “So, nun erst einmal zum Besuch in der Filiale Reuter-Platz. Der junge Mann am linken Schalter, den Olga beim Blick durch die offene Tür des Eingangs gleich als den Mann identifizierte, dem sie das Heroin verschafft, und der sich ihr als Rudolf ausgibt, heißt Eberhard Kleinert. Er selbst sagte mir am Schalter beim Einlösen meines Schecks, dass er nicht Rudolf, sondern Eberhard heiße. Mit dem Filialleiter hatte ich dann ein langes Gespräch, der dem Eberhard den Zunamen Kleinert gab. Ich schilderte ihm das Problem, das er so einfach nicht glauben wollte, weil er diesen Bankangestellten zu seinen besten Mitarbeitern zählt. Nachdem ich ihm die Gefahren und das hohe Risiko, mit denen Olga tagtäglich zu leben hat, aufgezeigt habe, hat er eingelenkt und einer Überprüfung der Situation, soweit sie diesen Bankangestellten betrifft, zugestimmt. Damit dieser Eberhard Kleinert, alias Rudolf, nicht erst den Verdacht schöpft, dass er ins Visier genommen wird und eilends zurückgelassenes Heroin, Spritzen, Nadeln. usw. wegräumt beziehungsweise verschwinden lässt, deren Auffinden den entscheidenden Beweis zu seiner Überführung liefert, sind Filialleiter Groß und ich übereingekommen, mit der Durchsuchung seiner Wohnung zu beginnen. Denn auch der Filialleiter, der fassungslos war und sagte: “das schlägt dem Fass den Boden aus!”, braucht diesen Beweis. Wenn der Beweis mit dem Stoff und seiner Verwendung nicht gebracht wird, dann kann nichts gegen diesen “Rudolf” unternommen werden. Ohne den Beweis fällt alles ins Wasser! Dann kann der “Rudolf” den Anzeiger wegen Verleumdung auf Regress verklagen.”
Olga sah auf den kleinen Klubtisch, auf dem geöffnete Partituren sich türmten. Ihr Blick ging wieder nach unten, so ähnlich, wie sie in der Bäckerei und Konditorei Pollack auf die kleine, quadratische Platte des Fenstertisches sah, wo sich ihr Blick an der Tischplatte “festgeklemmt” hatte und noch an ihr klebte, als Teller und Tassen von der jungen Serviererin mit der blütenweißen Schürze abgeräumt waren. Claude atmete schwer durch. “Hoffentlich geht das gut, ich meine, hoffentlich finden die Beamten vom Drogendezernat den Beweis”, sagte er. “Das hoffe ich auch, denn sonst stehen wir blöd da”, fügte Boris hinzu. Dann sagte er: “So lange die Ermittlungen laufen, müssen für Olga die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Sie darf nicht allein sein und sich nicht auf der Straße blicken lassen. Sie muss in deiner Wohnung den ganzen Tag bleiben. Das ist dein Beitrag Claude, den du zu bringen hast, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Du musst also einkaufen und das Waschen und Bügeln der Wäsche im Waschsalon besorgen. Auch sollten die Mieter über und unter euch von Olga’s Existenz nichts wissen. Sie darf aufs Klingeln an der Tür oder des Telefons nicht reagieren. Das Telefon ist lediglich dazu da, einen Notruf an die Polizei oder einen Freund zu tätigen, dem sie die Hilfeleistung wirklich zutraut.” Claude: “Ich stimme dir zu, dass erhöhte Sicherheitsmaßnahmen in der Zeit der Ermittlungen getroffen werden müssen.” Boris: “Hier ist das Geld, damit Olga die Schulden bei dem Türken los wird. Macht das noch heute Abend. Dabei sollst du Olga begleiten”, sagte Boris mit festem Blick zu Claude. “Jetzt müsst ihr gehen, denn ich muss mich auf den Weg zum Polizeipräsidium machen. Ihr wisst Bescheid. Ruft mich morgen gegen elf an, dann kann ich euch mehr berichten.”
Es war halb sechs, als Boris ein Taxi nahm und sich zum Polizeipräsidium fahren ließ. Die Fahrt nahm eine Viertelstunde in Anspruch. Er zahlte, stieg aus und betrat das Gebäude, das ein älteres Hochhaus war. Der Aufzug brachte ihn zum fünften Stock, und das Zimmer 517 fand Boris, nachdem er erst in die falsche Flurrichtung gegangen war, wo rechts und links die Zimmernummern von 501 bis 514 gingen. Die Tür war verkratzt und die Klinke abgegriffen, als Boris den Dienstraum 517 betrat. Der Beamte vom Dienst wusste den Namen und sagte: “Sie sind Herr Baródin.” “Ja, das bin ich, dann sind Sie Herr Wilhelm”, erwiderte Boris. Der Beamte: “Ganz recht. Nehmen Sie Platz. Sie wissen, um was es geht. Nur ohne Anzeige geht es eben nicht.” Boris: “Verstehe.” Der Beamte suchte nach dem Notizblock zwischen den anderen Papieren. Er fand ihn, blätterte einige zurückgeschlagene Seiten nach vorn und las auf der gesuchten Seite die Notizen: “Es handelt sich um einen gewissen Eberhard Kleinert, der als Bankangestellter bei der Dresdner Bank, Filiale Reuter-Platz, arbeitet. Wie Sie schon beim Telefongespräch vermuteten, haben wir ihren Namen und ihre Anschrift vom Filialleiter der Dresdner Bank erhalten. Er hat es deshalb getan, weil Sie ihm gegenüber in einem längeren Gespräch vorgetragen haben, dass bei dem Bankangestellten Kleinert der dringende Verdacht des vorsätzlichen Betruges, der Erpressung und des Besitzes und Missbrauchs von Heroin besteht. Er erpresse angeblich eine junge Dame, die ihn in Abständen, ob sie regelmäßig oder unregelmäßig sind, soll hier keine Rolle spielen, mit Heroin versorgt. Diese Dame ist eine Emigrantin ohne gültige deutsche Papiere, der Herr Kleinert das Versprechen gab, ihr die gültigen Papiere zu beschaffen unter der Bedingung, dass sie ihm die Droge nach Bedarf und kostenlos beschaffe. Stimmt das so?” Boris: “Das stimmt.” Der Beamte: “Wenn Sie sagen, dass das so stimmt, dann schreiben wir es so in die Anzeige.” Der Beamte zog ein Blatt in die Schreibmaschine und fing an, auf den Tasten zu hämmern. Er kannte die Tastatur auswendig, was die Schreibarbeit beschleunigte. “Was ist ihr Beruf?” “Konzert-Pianist”, gab Boris an und dachte an das zweite Klavierkonzert von Brahms, das er in etwas über einer Woche in Warschau und eine Woche später in Moskau zu spielen habe. Der Beamte ließ sich zu der Frage hinreißen, ob man mit diesem Beruf leben kann. Es war eine Frage, die den Rahmen der Anzeige überschritt.
Boris dachte, dass die Neugier den Beamten zu dieser Frage getrieben hat. Denn er war nicht der erste und würde nicht der letzte sein, der diese Frage, aus welchen Gründen auch immer, stellt. Boris: “Von der Musik her betrachtet gibt es kein volleres Leben, als es ein Musiker mit der Musik als Beruf lebt. Wenn der Musiker zur Begabung noch fleißig ist und täglich seine Übungen macht, dann wird er mit den Konzerten, die er in der Bundesrepublik oder sonstwo in der Welt gibt, auch finanziell über die Runden kommen.” Der Beamte: “Nehmen Sie mir die Frage nicht übel. Sie kommt nicht nur aus der Neugier, sondern auch aus der Sorge um meinen 18-jährigen Sohn, der Pianist werden möchte, also in ihre Richtung hin tendiert und mir mit seinem Wunsch, ein Pianist zu werden, seit über zwei Jahren in den Ohren liegt. Boris: “Hat er die Schule schon beendet?” Der Beamte: “Er macht sein Abitur im nächsten Jahr.” Boris: “Bis dahin kann sich noch vieles ändern, auch was die Berufswahl betrifft.” Der Beamte: “Das habe ich auch geglaubt. Aber mein Sohn hat mich da eines Besseren belehrt. Der ist von seiner Pianistenidee weder abgekommen noch abzubringen. Ich habe mir den Mund fuselig geredet. Der stellt seine Ohren auf Durchzug, sobald er feststellt, dass ich oder jemand anders ihn von dieser Idee abbringen will.” Boris: “Was spielt er denn augenblicklich?” Der Beamte: “Genau kann ich es nicht sagen, weil er für sein Alter schon ein beachtliches Repertoire hat. Er liebt Beethoven. Das weiß ich bestimmt.” Boris: “Schicken Sie ihn doch mal vorbei, damit ich ihn hören kann.” Der Beamte: “Wann?” Boris: “Ich melde mich, wenn ich von der Konzertreise zurück bin.”
Herr Wilhelm las die Anzeige auf Tippfehler durch, wobei er das eingelegte Blatt in der Schreibmaschine Zeile für Zeile nach oben drehte. Er fand keinen Fehler. So drehte er das Blatt aus der Maschine, las den Inhalt vor und fragte, ob das Geschriebene so recht ist und dem Tatbestand entspricht. Boris bejahte die Frage und sagte, dass die Anzeige dem Tatbestand entspreche. “Dann lesen Sie die Anzeige noch einmal durch und setzen ihre Unterschrift darunter”, sagte Herr Wilhelm im Amtston eines Kriminalbeamten. Boris kam dieser Aufforderung nach, las und unterschrieb die Anzeige. “So, das hätten wir”, meinte der Beamte Wilhelm und legte die geschriebene und unterschriebene Anzeige in die Aktenmappe zu dem Notizblatt, das er aus dem Notizblock gerissen hatte.
Ganz oben auf den vorderen Aktendeckel schrieb Herr Wilhelm mit dem roten Stift die Bearbeitungsnummer, die er mit schwarzem Stift auch in die Kladde der fortlaufenden Nummern übertrug. Wie auf dem vorderen Aktendeckel gab er der laufenden Nummer in der Nummernkladde den Namen ‘Eberhard Kleinert’. “Das wär’s für heute. Nun kann die Ermittlung ihren Lauf nehmen”, schloss der Kriminalbeamte die Sache mit der Erstattung der Anzeige ab und klappte die Akte mit den ersten beiden Papieren zu. Boris erhob sich und wünschte dem Beamten Wilhelm einen guten Abend. “Ich wünsche ihnen für ihre Konzert-Reise viel Erfolg”, sagte Herr Wilhelm, als Boris an der Tür mit der abgegriffenen Klinke in der Hand stand. “Ich melde mich, wenn ich von der Reise zurück bin”, bemerkte Boris mit einem Lächeln, während der Beamte Wilhelm die angelegte Akte auf die anderen legte und den Schreibtisch aufräumte. “Dann schick ich ihnen meinen Sohn Andreas zum Vorspielen, damit Sie sich ein Urteil über seine Fähigkeiten machen können”, sagte er. “Das ist in Ordnung!”, Boris verließ den Raum und schloss die Tür.
Er ließ sich mit dem Taxi zurück in die Wohnung fahren. Es war Abend. Boris hatte ein unwohles Gefühl. Es bedrückte ihn, dass er den Tag für seine Konzert-Vorbereitung verloren hatte. Er machte sich in der Küche den chinesischen Kräutertee und schluckte die Antibiotikakapsel gegen die eitrige Tonsillitis. Mit der Tasse setzte er sich in die schmale Klubecke und dachte über den Ablauf des “verlorenen” Tages nach. “Hoffentlich hat Olga dem Türken das Geld gegeben, dass dieser sie in Ruhe lässt. Hoffentlich werden die Kriminalbeamten bei der Wohnungsdurchsuchung fündig, dass dem Eberhard Kleinert, alias Rudolf, dem jungen Bankangestellten, den Filialleiter Groß zu seinen besten Mitarbeitern zählt, das betrügerische Handwerk gelegt wird.” Diese Gedanken gingen Boris durch den Kopf, den die Brutalität der Erpressung aufs Heftigste anwiderte. Er trank den Tee aus, stellte die Tasse auf den kleinen Klubtisch, überflog mit einem Blick die offene Solo-Partitur des Schumann-Klavierkonzertes, die über den ebenfalls offenen Partituren des Beethoven- und des Grieg-Konzertes lag.
Er ging an den Flügel und begann mit dem Schlusssatz aus dem zweiten Brahms-Konzert mit dem schnellen Schlussteil im ‘un poco più presto’. Dabei stellte er das Metronom auf 138 Viertelnotenschläge pro Minute, wie es Brahms in der Partitur angegeben hat. Über den Stakkati der arpeggierten Töne im Akkordvortrag mit den Dezimen in der linken Hand, rollten mit der rechten Hand die Oktavläufe in geschlossener, dann in unterbrochener Folge und auch im Stakkato der Hammerschlagtechnik präzis ab. Boris war zufrieden, weil Tempo und Genauigkeit stimmten. Er spielte den Schlussteil noch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal. “Wenn das andere auch so geht, dann braucht sich Brahms nicht im Grab herumzudrehen”, sprach er zu sich selbst, als er aufstand und die Tasse vom Klubtisch nahm, in die Küche ging, und eine zweite Tasse Tee eingoss.
Er stand in der Küche und war mit seinen Gedanken beim Konzertvortrag in Warschau und dann in Moskau, als das Telefon klingelte. “Es wird Mutter sein, die sich nach dem Befinden und dem Ausgang der Untersuchung erkundigen wird”, dachte er. Boris hatte ihren Anruf erwartet und sich gewundert, dass sie, es war neun Uhr abends, nicht angerufen hatte. Doch es war nicht die Mutter, sondern Margit Hoffmann, die hübsche Arzthelferin in der Praxis von Dr. Gaby Hofgärtner. “Störe ich Sie?”, begann sie etwas unbeholfen das Telefonat. Boris: “Nein, das tun Sie nicht.” “Entschuldigen Sie, dass ich so spät anrufe, aber ich habe mir Gedanken über ihren Zustand gemacht”, fuhr Margit Hoffmann fort, “weil Sie sagten, dass Sie am Konzert arbeiten, das Sie in Kürze vortragen werden. Wo Sie es spielen werden, das haben Sie nicht gesagt.” Boris: “Erst in Warschau und dann in Moskau.” Margit: “Ich wünschte, ich könnte Sie einmal im Spielen hören. Ich habe einige Kritiken über ihre Aufführungen in Berlin und Leipzig gelesen. Die waren voll des Lobes.” Boris: “Ich hoffe, dass ich diesmal gut in Warschau und Moskau ankomme. Wissen Sie, Fräulein Margit, wenn solche Kritiken vorausgehen, sind die Erwartungen hoch. Und die zu erfüllen, das ist nicht leicht.” Margit: “Fühlen Sie sich denn besser? Denn ein Konzert aufzuführen, braucht viel Kraft und Konzentration.” Boris: “Ich bin noch weit entfernt von einer guten Kondition. Ich habe die erste Penicillintablette geschluckt. Die zweite werde ich vor dem Schlafengehen nehmen. Ich hoffe, dass sich mein Zustand morgen gebessert hat, dass ich mich wieder auf die Musik konzentrieren kann.” Margit: “Ich wünsche ihnen dazu eine gute und rasche Besserung.” Boris: “Das ist sehr freundlich von ihnen. Ich darf ihnen sagen, dass mich bislang noch kein Arzt und keine Ärztin angerufen hat, um sich nach meinem Gesundheitszustand zu erkundigen. Sie sind die erste, die das tut.” Margit: “Ich bin nur eine Arzthelferin. Aber ich habe ihre Sorge gespürt, die sie unter dem Zeitdruck der bevorstehenden Konzertreise haben. Ich will Sie nicht länger aufhalten und wünsche ihnen eine gute Nacht.” Boris: “Vielen Dank, auch ich wünsche ihnen eine gute Nacht.”
Kaum war der Hörer aufgelegt, da klingelte das Telefon erneut. Nun war es die Mutter, Frau Anna Friederike Elbsteiner, geborene Dorfbrunner, aus Hamburg-Blankenese. “Mein Sohn, wie geht es Dir. Ich mache mir große Sorgen um deine Gesundheit. Warst Du beim Arzt, ich meine bei einem Spezialisten?” Boris: “Meine Ärztin hat mich auf den Kopf gestellt. Dabei hat sie gefunden, was ich gestern morgen vor dem Spiegel schon entdeckt hatte, dass die Mandeln entzündet und von grauweißen Stippchen durchsetzt waren. Das ist zum grippalen Infekt hinzugekommen. Sonst hat sie nichts weiter gefunden.” Mutter: “Das reicht doch! Mit so einer Tonsillitis ist nicht zu spaßen. Hast Du Beschwerden beim Schlucken? Wie ist deine Temperatur?” Boris: “Das Schlucken geht ohne größere Probleme; die Temperatur hält sich bei achtunddreißig und macht keine großen Sprünge wie die Tage zuvor. Dr. Hofgärtner hat mir Penicillin verschrieben. Die erste Tablette habe ich geschluckt. Ich glaube, eine erste Besserung zu spüren.” Mutter: “Mein lieber Sohn, so schnell geht das in der Biologie nicht. Da musst Du schon einige Tage das Penicillin einnehmen, ehe Du einen Fortschritt feststellen kannst. Reagierst Du nicht allergisch auf das Penicillin?” Boris: “Mutter, genau weiß ich es nicht. Dr. Hofgärtner hat mir ein synthetisches Penicillin verschrieben, bei dem das Risiko, eine Allergie zu bekommen, niedriger sei. So hat es die Ärztin jedenfalls gesagt.” Mutter: “Na, dann wollen wir hoffen, dass die Sache besser und nicht schlimmer wird.” Boris: “Das hoffe ich auch. Und wie geht es dir? Hast Du einen guten Tag gehabt?” Mutter: “Der Tag war ruhig. Gerald ist auf Geschäftsreise in Brüssel und dann in Paris.
Weißt Du, dass Dein Großvater heute Geburtstag hat? Er wäre heute sechsundachtzig geworden” Boris: “Das ist mir völlig durchgegangen, entschuldige bitte.” Mutter: “Ich vermisse ihn sehr. Er war ein guter Vater und ein tapferer und selbstloseer Mann. Er hat für die Familie und seine Gemeinden viel Gutes getan.” Boris: “Das sagst Du immer. Doch auch ich habe Großvater in guter Erinnerung. Er war immer sehr lieb zu mir.” Mutter: “Ja, das war Großvater. Er war freundlich und lieb zu den Menschen und hatte ein offenes Herz für die Armen und Obdachlosen, für die er sich stets mit Wort und Tat eingesetzt hat.” Boris: “Du hast mir oft von den Breslauer Ereignissen vor und während des Krieges erzählt. Da sind mir drei Geschichten unvergesslich: erstens, die Geschichte mit dem Konsistorialrat Braunfelder, der den Großvater nie hat ausreden lassen und bei seinen Monologen das Brustkreuz ständig mit seinen kurzen fleischigen Fingern befummelte; zweitens, die Geschichte mit dem Rundbrief des Bischofs an die schlesischen Pastöre, dem braunen Terror zu widerstehen und mutig die Botschaft Gottes an die Menschen zu predigen, den Großvater in Vertretung von Bischof Rothmann zu unterschreiben hatte, weil der Bischof vor seiner Pensionierung stand und in den Ruhestand ruhig landen wollte, ohne vorher von der Gestapo gestört zu werden; und drittens, Großvaters Verhör durch die Gestapo im Haus der SA und den Nachttreff mit dem Doppelagenten Rauschenbach.” Mutter: “Das mit dem kleinen, eitlen Konsistorialrat, das war noch in Burgstadt, der Kohlestadt mit den drei Fördertürmen. Eckhard Hieronymus Dorfbrunner litt an der Schwäche und Feigheit seiner Vorgesetzten. Im Gedenken an meinen Vater und sein tapferes Wirken habe ich meine Breslauer Tagebücher herausgeholt und lese sie noch einmal durch. Was hat sich da nicht alles ereignet! Seine Antrittspredigten in der Elisabethkirche in Burgstadt und dann als junger Superintendent in Breslau sind erschütternd und gehen ins Herz. Auch wenn ich nur Auszüge aus seinen Predigten notiert habe, sie zu lesen macht mich still.
Eckhard Hieronymus fand stets Worte der Erbauung, des Trostes und des Friedens. Er war ein begnadeter Prediger. Die Menschen strömten in die Kirche, wenn er den Gottesdienst hielt.” Boris: “Und dann war doch die Geschichte mit dem jüdischen Kinderarzt…” Mutter: “Du denkst an Dr. Weynbrand. Das war zur Zeit der fürchterlichen Judendeportationen. Auch Dr. Weynbrand traf das traurige Schicksal der Deportation ins Konzentrationslager und die Vergasung.” Boris: “Das kann man sich heute, ich denke an die junge Generation von nach dem Krieg, gar nicht vorstellen, dass so etwas geschah, und dass die Deutschen dazu fähig waren.” Mutter: “Es war schon damals, als es passierte, für uns unglaublich. Doch Du weißt, dass wir aus diesem Grunde meine Großmutter Elisabeth Hartmann, geborene Sara Elisa Kornblum, auf einem Bauernhof versteckt hielten.” Boris: “Wie hießen noch einmal die mutigen Bauersleute, die dabei ihr eigenes Leben riskierten?” Mutter: “Das waren Ludwig und Martha Lorch, die diese Menschlichkeit zeigten und das große Werk vollbrachten. Es macht mich noch immer traurig, dass wir meine Großmutter und diese tapferen Bauersleute nach dem Kriege nicht mehr trafen, die so viel Opferbereitschaft und Entsagung während des Terrorregimes auf sich genommen hatten. Sie waren mit dem Fluchtwagen auf dem Wege nach Halle, wo sie lebend nicht angekommen waren. Du weißt, dass dein Vater Ilja Igorowitsch, als er Stadtkommandant von Bautzen war, seinen Kollegen, den Stadtkommandanten von Halle, Generalmajor Perschinski, mit der Suche nach meiner Großmutter und den Bauersleuten Lorch beauftragt hatte.” Boris: “Ja, das hast Du erzählt. Doch die Suche verlief negativ.” Mutter: “Das ist es, und ich glaube fest, dass deine Großmutter, Luise Agnes Dorfbrunner, diesen Schock nie überwunden hat. Der Schock vom Verlust der Mutter nach den vielen Jahren des Verstecks vor den Nazis auf dem Bauernhof bei Lorchs und dann der Tod deines herzensguten Großvaters, das konnte sie in ihrem Leben nicht verkraften. Boris: “Mutter, ich spüre deinen Schmerz. Es ist nun an der Zeit, dass Du diesen Schmerz überwindest. Du hast es in deinem Leben schwer genug gehabt. Da sollst Du nun nicht noch länger leiden. Du sollst dich entspannen, denn auch Du hast Grund zur Dankbarkeit, dass Du die Schrecken des Krieges, der Flucht aus Breslau und der ersten Nachkriegstage in Bautzen überlebt hast. Jetzt mach Du einen Punkt und lass dich von den guten Dingen des Daseins erbauen. Du lebst jetzt wohlbehütet und geliebt in Blankenese mit dem freien Blick auf die Unterelbe. Das ist doch ein schönes Wohnen. Da sollst Du dich von diesem Ausblick und den guten Gefühlen der anderen Menschen tragen lassen.” Mutter: “Mein lieber Boris, so leicht und wendig wie früher bin ich heute nicht mehr. Doch lassen wir’s dabei bewenden. Was macht deine Musik? Kommst Du mit dem Brahms-Konzert gut voran?” Boris: “Das ist eine gute Frage. Ich komme voran, doch es könnte besser sein. Der Infekt und nun die Mandelentzündung haben mir doch zu schaffen gemacht.” Mutter: “Da können wir nur hoffen, dass sich dein Zustand mit dem Penicillin endlich bessert. Denn Du musst in guter Verfassung sein, wenn Du nach Warschau und dann nach Moskau fährst.” Boris: “Ja, da muss ich stark sein, denn die Erwartungen sind hoch, und der Brahms ist so einfach nicht zu spielen.” Mutter: “Machen wir Schluss für heute. Ich wünsche dir eine gute Nacht und eine gute Besserung.” Boris: “Danke, Mutter. Auch ich wünsche dir eine gute Nacht und alles Gute. Gute Nacht, Mutter.”
Boris legte den Hörer auf, trank den kalt gewordenen chinesischen Kräutertee, ging ins Badezimmer, stellte sich vor den Spiegel und betrachtete die vergrößerten Rachenmandeln im weit geöffneten Mund. Ihm schien, dass die Schwellung im Rückgang war und die grauweißen Stippchen weder zahlreicher noch größer geworden waren. Der Beginn einer Besserung nahm dem Sorgenberg die Kuppe. Er fühlte sich erleichtert, auch deshalb, weil er weniger schwitzte als in den vorangegangenen Tagen und Nächten. Boris setzte sich an den Flügel und begann das zweite Klavierkonzert von Brahms von vorn. Es perlte und lief wie am Schnürchen. Das erfüllte ihn mit Freude und Zufriedenheit. Er sah sich im Geiste von den philharmonischen Orchestern in Warschau und Moskau umringt am Konzertflügel sitzen. Da vergaß er die Begebenheiten des Tages und versenkte sich in die Tonwelt und ging bis zu den Zehenspitzen in ihr auf. Aus Gründen der Rücksicht auf die anderen Hausmieter hörte er nach zehn mit dem Klavierspiel auf und setzte sich mit der Partitur in die schmale Klubecke, um dort das Lesestudium fortzusetzen. Es war Mitternacht, als er die nächste Penicillin-Tablette in den Mund steckte, mit einem Glas Wasser runterspülte und zu Bett ging.
Es war Samstagmorgen. Der Wecker klingelte um acht auf einem Notenstapel von Bach’s ‘Wohltemperiertes Klavier’, Schumann’s ‘Kinderszenen’, Mendelssohn Bartholdys ‘Lieder ohne Worte’ und Schubert’s ‘Impromptus’. Boris hatte eine bessere Nacht hinter sich ohne die gefürchtete Schwitz- und Traumorgie, dass er als Pianist jämmerlich versagt habe. Er schlug die Quecksilbersäule im Thermometer nach unten und maß die Temperatur, die zu seiner großen Erleichterung unter achtunddreißig Grad Celsius war. Vor dem Spiegel im Bad registrierte er, dass die Rötung und Schwellung der Rachenmandeln zurückgegangen war. Er rasierte sich und lachte sich im Spiegel an, summte unter der Brause den Anfang des Konzerts, stieg aus der Schüssel und trocknete sich gut gelaunt ab, wobei er die Haut rot frottierte. Er zog sich den Bademantel an und machte sich das Frühstück in der Küche, das er in der schmalen Klubecke einnahm. Das Schlucken war weniger beschwerlich als die Tage zuvor. Das gab ihm den Auftrieb, den er zum Üben so dringend brauchte. Das Frühstücken ging in mehreren Partien vor sich, zwischen denen er am Flügel saß und am Konzert übte.
Es klingelte an der Tür. Da keiner vor ihr stand, drückte er den Öffner der Haustür. “Post!”, rief der Briefträger. Boris hörte das dumpfe Geräusch, wenn Briefe und Zeitungen durch den Schlitz in den Briefkasten geschoben werden. Er ging runter und holte die Sendung aus dem Kasten. Es waren Briefe, einer von seinem Agenten in Berlin und ein anderer, dem eine Reihe politisch symbolträchtiger Marken der UdSSR aufgeklebt waren, von seinem Vater Ilja Igorowitsch Tscherebilski. Ein dritter Brief hatte keinen Absender, der in Berlin abgestempelt war. Dazu gab es die ‘Berliner Morgenpost’, die Boris seit einem Jahr abonniert hatte. Beim Treppensteigen nahm er einen Blick auf die Titelseite der Zeitung, wo das unmenschliche Mauermonstrum abgebildet war, worunter die Frage stand: “Wie viele Menschen sollen dem Schießbefehl noch zum Opfer fallen?” Der Artikel befasste sich mit dem tödlichen Fluchtversuch eines achtundzwanzigjährigen DDR’lers, der auf der Mauer angeschossen wurde und auf der Westberliner Seite verblutete. Einer von vielen Fällen, bei dem die Flucht in den Westen mit dem Tod endete, weil der Schießbefehl auf Ostberliner Seite rigoros eingehalten wurde und jede Hilfe auf dem Boden der Freiheit zu spät kam. Boris war froh und dankbar, dass Mutter und er noch wenige Wochen vor Errichtung des unmenschlichen Betonmonsters die Abhörrepublik mit dem sozialistischen Volkskerker hinter sich gelassen haben. Für ihn war es unfassbar, dass Menschen wie Schwerverbrecher betrachtet, behandelt und erschossen wurden, weil sie es unter dem roten Terror der angeblichen Brüderlichkeit mit der Rund-um-die-Uhr-Bespitzelung, die bis in die Familien hineinreichte, den gefürchteten Verhören, den Schauprozessen mit den falschen Anschuldigungen und den lähmend hohen Zuchthausstrafen nicht mehr aushielten. Wie lange dieses Unrecht das Siebzehnmillionenvolk noch ertragen sollte, das stand allerdings in den Sternen, vor allem dem großen roten Sowjetstern. Boris schob die Wohnungstür leise und nachdenklich ins Schloss, ging zur Klubecke, legte die Zeitung auf die offenen, übereinanderliegenden Partituren und widmete sich den Briefen. Er öffnete sie mit dem Kugelschreiber und zog als erstes das Schreiben von seinem Agenten Berthold Graf heraus. Dieser teilte ihm mit, dass der Flug nach Warschau und dann nach Moskau für die Business-Klasse gebucht sei. Der Flug nach Warschau gehe mit Air France vom Flughafen Tempelhof ab. Den Flug von Warschau nach Moskau übernehme die sowjetische Fluggesellschaft Aeroflot. Die Flugkarten liegen zum Abholen in seinem Büro. Auch seien die Hotelreservierungen vorgenommen worden. “Alles laufe nach Plan. Mit freundlichen Grüßen B. Graf, Konzertagent.” Boris dachte sich seinen Teil und sagte zu sich, dass bei ihm nicht alles nach Plan laufe, weil der Infekt mit den lästigen Hustenanfällen und die eitrige Tonsillitis dazugekommen seien. “Wie kann ein Agent nur so etwas behaupten? Das kann er nur, weil er sich nicht informiert, sich nicht gründlich um den Pianisten kümmert, was in den Aufgabenbereich eines Konzertagenten gehört.” Er legte das Schreiben mit dem Gefühl der Missbilligung auf die aufgeschlagene Partitur der dritten Polonaise von Frédéric Chopin auf dem kleinen Klubtisch.
Nun wandte sich Boris dem Brief seines Vaters Ilja Igorowitsch, dem ehemaligen Stadtkommandanten von Bautzen, zu. Boris sah sich den Umschlag von vorn und hinten an, bewunderte die akkurate und ausdruckvolle Handschrift, die vorn mit lateinischen und auf der Rückseite mit kyrillischen Buchstaben gut zu lesen war. Beim Herausziehen des Blattes dankte der Sohn dem Vater für seine Liebe und Fürsorge, für das Gute, das er dem Sohn gegeben, zu seiner Bildung beigetragen und musikalisch geweckt hat. Wie der Umschlag, so der Brief, ausdrucksvoll stach die Handschrift im fehlerfreien Deutsch ins Auge:
Moskau, den 17. April 1974
Boris, mein lieber Sohn!
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie ich mich freue, Dich nach den Jahren Deines letzten Konzertes wiederzusehen und zu hören. Ich kann es nicht abwarten und zähle die Tage. Es ist ein schwer zu spielendes Konzert, das zweite Brahms-Konzert. Doch Du wirst es meistern bei Deiner großen Begabung in der Musikalität und virtuosen Fingerfertigkeit. Du wirst vom besten Orchester begleitet, das es derzeit in der UdSSR gibt, nämlich den Moskauer Philharmonikern, denen weltberühmte Dirigenten, wie Leonard Bernstein, Sir Georg Solti und manche andere vorgestanden haben. Diesmal ist es Igor Sergej Majakowski, ein noch junger, aber großartiger Dirigent. Er ist ein Nachfahre des berühmten russischen Dichters Wladimir Majakowski. Du erinnerst Dich sicher an seine wunderbaren Gedichte. Ich hatte Dir vor Jahren einen Band seiner Gedichte geschickt. Igor Sergej ist ein genialer Musiker, ein Tongestalter, wenn er vor den Philharmonikern steht. Er beherrscht die Partitur aus dem “ff”, was ihn dynamisch, höchst einfühlsam und stark macht, weil er beim Dirigieren nicht zu lesen braucht. Das Notengebäude hat Igor Sergej bis ins letzte Detail im Kopf. Du wirst von ihm und seiner nachschöpferischen Kraft begeistert sein. Von den Philharmonikern brauche ich Dir nicht erzählen,weil Du sie bereits besser kennst als ich. Du wirst mir zustimmen, dass sie großartige Musiker sind, wie sie anderswo ihresgleichen suchen lassen.
Wie geht es Anna Friederike? Oft denke ich an die Bautzener Zeit zurück, an die musikalischen “Ausflüge” auf dem herrlich klingenden Förster-Flügel. Die ersten Jahre nach dem Krieg waren schwer für die Menschen, doch haben sie große Dinge hervorgebracht, die für mich unvergesslich bleiben. Grüße bitte Deine Mutter herzlich von mir. Wie gesagt, ich freue mich riesig auf Dein Kommen.
In der Hoffnung, dass Du Dein Russisch nicht ganz vergessen hast, möchte ich den Brief mit zwei Strophen aus dem Gedicht “Augen” der Dichterin Marina Zwetajewa beenden, die mich beim Lesen jedesmal besonders ansprechen:
ГЛАЗА / AUGEN
Так знайте же, что реки - вспять, So begreift doch, was Ströme beweinen,
Что камни - помнят! Das kehrt zu Steinen verknittert zurück!
Что уж опять oни, опять Dass schon bereits sie, bereits sie sich
В лучах огромных Im gewaltigen Strahlenschein
Встают - два солнца, два жерла, Erheben - zwei Sonnen, zwei Schlünde,
- Нет, два алмаза! - - Nein, zwei Diamanten! -
Подэемной беэдны зеркала: Im Spiegel abgründiger Tiefen:
Два смертных глаза. Zweier sterbender Augen.
(geschrieben: 2. Juli 1921)
Ganz herzlich grüßt Dich, mein lieber Boris,
Dein Ilja Igorowitsch
Boris las den Brief zweimal, weil er auch das, was sich zwischen den Zeilen versteckte, “lesen” wollte. Was stand für ihn zwischen den Zeilen? Zunächst war es die tiefe, ungebrochene Freundschaft, die Ilja Igorowitsch mit seinem Sohn verband, und die eine Freundschaft war, die tief aus dem Herzen kam. Dann versteckte sich zwischen den Zeilen, dass sein Vater eine herzliche Empfindung zu Anna Friederike behalten hatte, die er doch geliebt hatte. Dass er, Boris, aus dieser großen Liebe heraus geboren wurde, die eine Liebe der gegenseitigen Zuneigung war, das hat sich als das große gemeinsame Glück herausgestellt. Er, Boris, als das Kind dieser Liebe, ist beiden Eltern ans Herz gewachsen, dass beide von großem Respekt und unzerbrochener Zuneigung voneinander denken und sprechen. Die große Musikalität, die Boris vom Vater bekommen hatte, stellt für Vater und Mutter ein unbeschreibliches Glück dar. Der Vater ist stolz auf die musische Begabung des Sohnes und seine pianistischen Leistungen, zu denen es Ilja Igorowitsch trotz großen Talents nicht gebracht hatte, auch wenn bei dieser Einschränkung der Militärberuf mit der Offizierslaufbahn zu berücksichtigen war, der für das Klavierspiel in den Jahren des zweiten Weltkrieges, der für ihn der große Vaterländische Krieg war, nur wenig Raum ließ. Für die Mutter Anna Friederike blieb es ein Wunder, dass sie so einen Sohn zur Welt gebracht hatte, der mittlerweile trotz seiner noch jungen Jahre zu den großen Pianisten zählt. Dieses Wunder der besonderen Mutterschaft ist das Fundament ihrer bleibenden Dankbarkeit an Ilja Igorowitsch, der es in seinem Bautzener Abschiedsbrief vorausgesagt hat, dass er, Boris, ein Pianist werden wird, der die Menschen erstaunen lässt. Auch kam Boris das Telefonat in Erinnerung, von dem ihm Anna Friederike oft erzählte. Es war das Telefonat, das sie in der Silvesternacht 69/70 aus London mit ihrem Vater Eckhard Hieronymus Dorfbrunner führte. Boris’ Großvater litt an der multiplen Sklerose und war an den Rollstuhl gefesselt. In diesem Telefonat sagte Eckhard Hieronymus, dass sein Stern, der dorfbrunnersche, die Leuchtkraft verloren habe, zumal sein einziger Sohn Paul Gerhard Dorfbrunner, der zwei Jahre jünger als seine Mutter Anna Friederike war, als spät Eingezogener an der Ostfront verschollen war, als eigentlich alles schon zu spät, der Kriegsausgang längst entschieden war, nun als Namensträger für die nächste Generation ausgefallen war.
Boris erinnerte sich an Großvaters Sätze mit dem Abend- und dem Morgenstern: “Der dorfbrunnersche Namensstern sei im Untergehen begriffen und wird als Abendstern in die Tiefen des Universums versinken. Dagegen wird der Wunderenkel wie ein heller Morgenstern aufgehen, wenn auch nicht als ein Dorfbrunner, sondern als Boris Baródin. Er wird am Himmel der Musik leuchten und noch viel Licht in die Menschheit strahlen.” Die Gedichtsstrophen stimmten schwermütig. Warum diese Schwermut mit dem Gleichnis der sterblichen Augen, wenn Ilja Igorowitsch von der großen Freude auf ein Wiedersehen schreibt? Ist er denn krank, dass er an den Tod, ans Sterben denkt? Boris konnte sich das Gedicht im Zusammenhang mit dem sonst positiven, lebensbejahenden Briefinhalt nicht erklären. Ist Vater denn unglücklich, dass er mit “was Ströme beweinen” den Tränenstrom meint, in dem sich die anfänglichen Gefühle für die junge Lettin, die er in Leningrad kennengelernt hat, mit der er zusammenlebt, verknittert und verhärtet zurückkehren? Was bedeutet die Erhebung der zwei Sonnen und zwei Schlünde im gewaltigen Strahlenschein anders, als dass sich dazwischen der Abgrund öffnet, der sich, wie es im Gedicht heißt, in den zwei sterblichen Augen so klar wie in Diamanten spiegelt. Sind Komplikationen nach der Notoperation aufgetreten, der sich Ilja Igorowitsch wegen des blutenden Magengeschwürs unterziehen musste? Warum schreibt Vater nicht, wie es ihm geht? Warum hüllt er sich in Schweigen, was seine Gegenwart, seine Gesundheit und seine unmittelbare Umgebung betrifft?
Für Boris hatte der Brief einen schwermütigen Abschluss, der ihm nicht nur zu denken gab, sondern ihm Sorgen machte, Sorgen um die Gesundheit des Ilja Igorowitsch und Sorgen um das Leben, das er lebt. Boris faltete mit all den geweckten Erinnerungen an Ilja Igorowitsch und Eckhard Hieronymus Dorfbrunner den Brief zusammen und schob ihn nachdenklich in den Umschlag und legte den Umschlag auf den Stapel der offen liegenden Partituren neben das Schreiben des Konzert-Agenten Berthold Graf und dem noch ungelesenen Brief eines unbekannten Absenders. Er ging in die Küche mit dem Gewicht des Briefes. Die Gedichtsstrophen der Marina Zwetajewa machten das Schwergewicht des Briefes aus. Er füllte den Wasserkessel, setzte ihn auf den Herd, stand vor dem Fenster mit dem “Blick nach Moskau”, nahm das Tanzen des Kesseldeckels nicht gleich wahr und goss das kochende Wasser in das Teesieb mit dem chinesischen Kräutertee. Er rührte den Teelöffel Zucker ein, ging zurück ins Arbeitszimmer, stellte die volle Teetasse auf den kleinen Klubtisch, setzte sich an den Flügel und spielte den ersten Sonatensatz aus Beethoven’s Pathétique. Zur Schwermut, die ihm der Brief des Ilja Igorowitsch vermittelt hatte, kam nun die beethovensche dazu, dass Boris nach den ersten Takten die Tränen vor den Augen standen, die er tropfen ließ, und den Satz mit Tränen zu Ende spielte. Er ging zur Klubecke, setzte sich in den schmalen Sessel, trank mit bedächtigen Schlucken den Tee, sah aus dem Fenster, war mit seinen Gedanken woanders, aber nicht in der Knesebeckstraße 17, dass er das Klingeln des Telefons nicht gleich wahrnahm. Bei welchem Klingelzeichen er den Hörer abgenommen hatte, wusste er nicht. Jedenfalls ertönte das Leerzeichen, als er die Hörmuschel ans Ohr drückte. Er ging an den Klubtisch zurück, trank vom Tee und nahm den Fensterblick “Richtung Moskau” wieder auf. Das Telefon klingelte wieder. Er nahm beim dritten oder vierten Klingelzeichen den Hörer ab und meldete sich mit “Hallo”. “Ach du bist’s, Claude. Ist es schon elf? O, es ist gleich zwölf. Ich war hier. Als ich den Hörer abgenommen habe, hat sich keiner gemeldet. Am besten ist es, wenn ihr um zwei zu mir kommt. Danke, mir geht es besser. Bis dann.” Boris legte den Hörer auf und fragte sich in der zurückkehrenden Nüchternheit des nachdenkenden Bewusstseins, ob es sinnvoll sei, weiter “nach Moskau” zu blicken. Der Verstand erklärte ihm, dass durch den verlängerten Ostblick, auch wenn er von tiefen Gefühlen begleitet wird, sich am Zustand von Ilja Igorowitsch nichts ändert. Zudem drängte die Zeit mit den bevorstehenden Konzerten, für die noch viel zu tun war.
Er setzte sich an den Flügel und spielte Brahms. Zunächst den zweiten Satz, dann den ersten, beide aus der Meditation heraus, was das Leben ist und was der Mensch, was mit Worten nicht zu sagen ist. Beim Eingangsmotiv des ersten Satzes mit den steigenden Viertelnoten B-C-D, der herabgleitenden Triole Es-D-C, dann dem D als Viertelnote und dem angebundenen Fermaten-F als Dreiviertelnote, das aus dem Orchester in den ersten beiden Takten erklingt, spürte Boris den Ruf des Vaters aus der Tiefe, sah ihn am Lauf der Wolga stehen, nachdenklich schweigend mit der Knittrigkeit der Gefühle und der Schwermütigkeit, die ihm das Leben auflud. Aus dieser Meditation heraus und aus dem Gespür, den stummen Schrei von Ilja Igorowitsch wahrzunehmen, setzte Boris den stakkierten Triolenlauf über den “Wolgaklang” des Orchesters, über das schwere, schweigende Wasser des breiten Stromes, der unter dem weiten Spiegelfächer der späten Nachmittagssonne das Gewesene der frohen Heiterkeit und die vergängliche (Sekunden-)Kürze des einst erfüllten Glücks beweint. Das Stakkato war so kristallklar und kräftig, als würfen Kinder kleine, runde Flachsteine über das Wasser, um das Schweigen des Stromes zu brechen, seinem dahinfließenden, nie anders gekannten Lauf der unergründlichen Schwermut die Clownsmütze aufzusetzen, ihm den abgründigen Tiefgang zu nehmen, Freude und Ansporn beim Anblick seines Fließens zu empfinden, indem die Steine weit über das stille Wasser sprangen. Es war der Wettstreit unter Kindern, deren Gesichter den springenden Steinen hinterherlachten und staunten, wenn sie weit genug gesprungen waren. Doch Kinder, die in den Dörfern geboren wurden und aufwuchsen, die zu beiden Seiten des Stromes lagen und jahraus-jahrein seinen Lauf mit der Ruhe der natürlichsten Ergebenheit begleiteten, wussten, dass sie und ihre kleinen, runden Flachsteine den majestätischen Strom nicht und niemals überspringen können. Die Wolga war ihre große unsterbliche Mutter im Denken und Fühlen und in so vielen Geschichten und Erzählungen.
Boris, dem die Erinnerungen der springenden Steine über das Wasser bei den Stakkato-Triolenläufen am Anfang des ersten Satzes im zweiten Klavierkonzert von Brahms mitspielten, hatte Freude am Spiel, Freude an den springenden Läufen, denn er wollte die Schwermut um Ilja Igorowitsch nicht noch schwerer werden lassen, sondern sie auf konzertantem Wege lockern, leichter machen, damit noch Platz zum Atmen und Raum zum Leben blieb. Doch setzte er der Schwermut nicht die Clownsmütze auf, auch wenn er sie oft vermisste. Stattdessen legte er dem schweren Wellengang die Dvořák’sche oder Bartók’sche Humoreske in Brahms’scher hanseatisch geordneter Weise auf. Hinzu kam der Genesungsprozess vom grippalen Infekt mit dem lästigen Husten und der eitrigen Tonsillitis nach Einnahme der Penicillintabletten und Hustentropfen, der Fortschritte machte. Das gab den Auftrieb, den er brauchte. Auch schwitzte er nicht mehr so stark.
So gewann Boris beim Spiel die virtuose Leichtigkeit und künstlerische Aussage zurück, die das Besondere, das persönlich Unverwechselbare im Vortrag des großartigen Werkes ausmacht. Das Spielen auf dem Flügel ging ihm von den Fingern, während er innerlich über den Menschen und sein Leben meditierte. Dabei kehrten Träume wieder, die zurück in die Kindheit bis in die Geburtsstadt Bautzen in der Oberlausitz reichten, wo er auf dem Schoße des Vaters vor dem Försterflügel saß und Ilja Igorowitsch ihm das Drücken der Tasten vorführte und die ersten kleinen Fingersätze für kleine Kinderhände in liebevollster Geduld mit ihm übte. Im Glück dieser Augenblicke und der kindlichen Neugier hatte er natürlich nicht begriffen, dass der Vater ein russischer General und der erste Stadtkommandant nach einem für die Deutschen verlorenen Weltkrieg war. Er liebte seinen Vater grenzenlos, konnte ihm auf dem Kopf rumtanzen und ihm die Finger verdrehen, ohne dass ein ernstes Wort gefallen oder ein Verbot ergangen wäre. Dass ein Kind mit einem Vater, der General und Kommandant der Stadt war, so etwas machen konnte, diese Großartigkeit kam ihm erst viel später in den Sinn.
Boris hatte sich beim Spielen in der Welt der Träume und Kindheitserinnerungen, der Wort- und Zeitlosigkeit innerhalb der Musik verloren, wobei er auch “diesseits” ein gutes Stück weitergekommen war, als es an der Tür klingelte. Er ließ es ein zweites und ein drittes Mal klingeln, ging in die Küche und sah auf die Uhr. Es war zwanzig nach zwei, und ans Essen hat er nicht gedacht. Er schluckte die zweite Penicillin-Tablette des Tages, trank ein halbes Glas abgekochtes Wasser, ging zur Tür, öffnete sie, vor der keiner stand, und drückte den Knopf für den Haustüröffner. Boris empfing Claude und Olga, die verdutzte Augen machten, ihn am Nachmittag im Bademantel anzutreffen. “Haben wir dich aus dem Schlaf geholt?”, fragte Claude. “Nein”, sagte Boris, “ich habe das Anziehen ganz vergessen.” “Typisch Künstler, da gelten andere Regeln”, fügte Claude hinzu. Boris: “Mag sein, dass es so ist, ich weiß es nicht. Ich habe zwei Briefe gelesen und am Brahmskonzert gearbeitet. Da ist mir die Zeit davongeflogen.” Claude: “Ich hoffe, dass wir dich nicht stören. Mir ist klar, dass in deinem Kopf außer den beiden anstehenden Konzerten kein Platz für andere Dinge ist.” Boris: “So ist es, und ich muss nacharbeiten, nachdem der Infekt durch Fieber und Schwitzen und dann noch die Tonsillitis mich von der systematischen Arbeit abgehalten haben. Aber kommt und setzt euch. Ich mache uns einen Tee.” Während Claude und Olga in der engen Klubecke gegenüber dem Flügel ihre Plätze nahmen, verschwand Boris in die Küche, um den Tee anzurichten. “Er ist wieder chinesisch, der hilft mir am besten. Ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid”, sagte er, als er die gefüllten Tassen aus der Küche holte und auf die schmalen, freien Stellen auf dem kleinen Klubtisch setzte, wobei die Untertassen zu einem guten Viertel über die Tischkante herausstanden. “Habt ihr das Geld dem Türken gegeben?”, fragte Boris die beiden und nahm einen Schluck vom heißen Tee aus der Tasse. Olga schaute auf ihre Tasse und nickte mit dem Kopf. Claude brachte ihr Kopfnicken in Worte: “Das Geld haben wir gestern am späten Abend dem Türkenkerl gegeben, nachdem wir fast eine Stunde an der verabredeten Stelle auf ihn gewartet haben. Er hat das Geld unter der Straßenlampe abgezählt und sein Okay für die nächste Lieferung gegeben. Er machte ein blödes Gesicht, als Olga ihm sagte, dass sie das Zeug nicht mehr brauche. Darauf schüttelte er den Kopf und zog ab. Er kam noch einmal zurück und bot den Stoff zum Sonderpreis an. Als ich ihm sagte, dass er das Zeug behalten soll, ist er endgültig gegangen.” Boris: “Dann wäre das mit dem Türken erledigt.” Claude: “Ja, soweit es die Bezahlung des ausstehenden Betrages betrifft.” Boris: “Dann wollen wir hoffen, dass dieser Kerl Olga nun in Ruhe lässt.” Claude: “Das hoffen wir auch.” Boris: “Damit wäre ein Problem gelöst, die eine Seite der Erpressung beseitigt. Jetzt muss mit der anderen Seite, mit dem “Rudolf”, dem Bankangestellten Kleinert aufgeräumt werden. Da hoffe ich, dass die Fahnder vom Drogendezernat bei der Wohnungsdurchsuchung fündig werden und den Stoff mit allem Zubehör als Beweismaterial sicherstellen.”
Obwohl Olga in die Drogenbeschaffung verwickelt war, schwieg sie und hielt ihren Blick gebannt auf den kleinen Tisch mit den übereinander gestapelten offenen Partituren. War es Scheu oder hatte sie noch etwas anderes, was sie verschwieg, dass sie weder Boris noch Claude ins Gesicht sah. Dieser Nachuntenblick war Boris schon in der Bäckerei und Konditorei Pollack aufgefallen, wo sich der Blick an der quadratischen Tischplatte des kleinen Fenstertisches festgeklemmt hatte und dann noch an der Tischplatte hängenblieb, als die Kaffeetassen und leergegessenen Kuchenteller abgeräumt waren. Weil sich Boris ihr Schweigen, das einem Verschweigen nahekam, und ihren gesenkten Dauerblick nicht erklären konnte, fragte er Olga, ob ihr noch etwas zu der für sie folgenreichen und gefährlichen Geschichte einfiele. Sie blickte weiter auf den vollgepackten Klubtisch und ihre Teetasse, drehte den Kopf hin und her und sagte leise, dass ihr nichts weiter einfalle. Das schwächte seinen Verdacht nicht ab, dass sie etwas verschwieg, was zur Lösung des Problems, was ihren unerlaubten Aufenthalt in der Bundesrepublik angeht, von Bedeutung sein könnte. “Die Zukunft wird es zeigen”, dachte Boris und trank seine Tasse aus. “Dann warten wir auf das Ergebnis der Drogenfahnder, ob sie bei dem “Rudolf” fündig geworden sind”, sagte er abschließend zu dem brisanten Vorgang und entschuldigte sich bei Claude, dass er nun am Brahms-Konzert arbeiten müsse, da ihm nicht mehr viel Zeit bis zu den Aufführungen in Warschau und Moskau bliebe.
Claude und Olga verabschiedeten sich, und Claude dankte Boris für die tatkräftige Unterstützung und seine Großzügigkeit mit dem Geld, das er gegeben hatte, damit Olga ihre Drogenschulden bei dem Türken bezahlen konnte. Boris: “Das ist selbstverständlich, dass ich da helfe.” Claude: “Vielen Dank!” Boris: “Nun, wo von Olga der Erpressungsdruck genommen ist, sollst du dich wieder auf das Klavier konzentrieren. Wenn ich aus Moskau zurückkomme, möchte ich einen vierhändigen Klavierabend mit meinen Schülern geben. Da stehen zur Auswahl: Mozart, das Andante mit fünf Variationen in G-Dur [Köchel Verzeichnis 501]; Schubert, die Fantasie Nummer 3 in c-Moll und die Große Sonate in B-Dur [Opus 30]; Beethoven, die Sonate in D-Dur [Opus 6]; Brahms, die Liebeslieder [Opus 52]; Mendelssohn Bartholdy, das Andante und Variationen [Opus 83a]; Reger, die Sechs Walzer [Opus 22] und Bizet, “Jeux d’Enfants” [Opus 22]. Was willst du vortragen? Ich möchte zwei Stücke mit dir spielen.” Claude überlegte einen Augenblick: “Ich möchte den Beethoven und den Mendelssohn mit dir spielen, wenn es dir recht ist.” Boris: “Na gut, mir soll’s recht sein. Dann knöpf dir diese beiden Stücke vor. Die Beethoven-Sonate hat zwei Sätze: das ‘Allegro molto’ und das ‘Rondo moderato’, sie ist technisch nicht so schwierig. Schwieriger sind das ‘Andante und die Variationen’ von Mendelssohn. Da musst du dich dahinterklemmen! Beim Beethoven übernimmst du die rechte Seite, und ich übernehme die rechte Seite beim Mendelssohn. Übe nun fleißig an den beiden Stücken, damit wir nicht zuviel Zeit verlieren, wenn ich aus Moskau zurück bin. Den musikalischen Verstand hast du. Nur üben musst du, und das mehrere Stunden am Tage, damit dein Klavierspiel den Standard erreicht, der für diesen Abend unerlässlich ist. Dein Vortrag muss das nötige Format bekommen, wenn wir uns nicht blamieren wollen. Also übe und das mit Fleiß!” Claude schaute Boris verschämt an: “Ich habe mir deine Worte zu Herzen genommen.”
Nachdem die beiden die Wohnung verlassen hatten, ging Boris ins Bad und betrachtete die Mandeln vor dem Spiegel. Der Heilungsprozess hatte Fortschritte gemacht, die grauweißen Stippchen waren kleiner und weniger geworden. Das gab ihm Auftrieb und Erleichterung, denn beim Spielen zu schwitzen und rumzuhusten, das konnte sich ein Pianist bei der Konzertaufführung nicht leisten. Er ging zum vollgepackten Klubtisch und nahm sich den dritten Brief vor, dessen Umschlag ohne Absender, dessen Marke in Berlin abgestempelt war. Boris entfaltete das Blatt, sah eine saubere Handschrift mit einigen Fehlern und begann zu lesen, das nicht ohne Unbehagen:
Sehr geehrter Herr Baródin!
Ich habe Sie in einigen Konzerten gehört, zuletzt in Hannover, wo Sie Tschaikowsky vorgetragen haben. Sie haben den Klavierpart des Konzerts großartig gespielt. Selten ist mir das Konzert so unter die Haut gegangen, wie bei Ihrem Spiel. Trotz Ihrer nicht zu leugnenden Jugend zählen Sie bereits zu den großen Pianisten der Welt. Ich bewundere Sie aufs Tiefste.
Darf ich Sie um einen Gefallen bitten. Ich habe einen Sohn, der ist zwanzig und möchte die Konzertlaufbahn einschlagen. Er ist ein begabter Junge und ein fleißiger Schüler, ist aber mit seinem Klavierlehrer nicht glücklich, der ihn über Monate mit Etüden hinhält, ohne dass da etwas Großes herauskommt.
Ich gehe davon aus, dass Ihre Zeit sehr knapp bemessen und die Liste derjenigen riesig, wenn nicht endlos ist, die von Ihnen unterrichtet werden wollen. Doch wäre ich Ihnen, sehr geehrter Herr Baródin, sehr dankbar, wenn Sie es möglich machen würden, meinem Sohn den Unterricht zu erteilen. Für ihn wäre es der große Lichtblick in seine Zukunft.
Über eine Nachricht von Ihnen würde ich mich sehr freuen.
Mit großer Bewunderung grüßt Sie
M. von Liebenau
P.s.: Anschrift: Mommsenstraße 3, Berlin-Charlottenburg
Telefon: 466 8753
“Sehr geehrte Frau Liebenau, Sie haben recht, die Liste der Anwärter, die von mir unterrichtet werden wollen, ist brechend voll bis endlos. Bitte haben Sie Verständnis, dass auch mein Tag nur vierundzwanzig Stunden hat, und ich noch etwas Zeit zum Essen und zum Schlafen brauche. Für Ihr Verständnis danke ich Ihnen.” Mit dieser Bemerkung faltete Boris den Brief zusammen, steckte ihn in den Umschlag und legte ihn auf den Briefturm von Bittschriften um einen Unterricht. Er setzte sich an den Flügel und begann seinen Part des zweiten Brahms-Konzerts, Opus 83. Das Spielen ging ihm gut von der Hand, und er fühlte eine erste Sicherheit im Vortrag, die er brauchte, denn die Erwartungen, die auf ihn in Warschau und in Moskau zielten, waren hoch. Da dachte er an Ilja Igorowitsch, der sich auf das Kommen des Sohnes so sehr freute und bei der ihm mitgegebenen Musikalität einer brillanten Konzertaufführung entgegensah. Boris spielte und übte, er übte und spielte. Die Stunden vergingen im Fluge, als am Nachmittag gegen vier das Telefon klingelte. Dieses Klingeln störte ihn sehr. Er wollte jetzt vom Telefonieren nichts wissen, wollte das Klingeln nicht hören. So überhörte er die nächsten Klingelzeichen und blieb beim Üben und Spielen von Brahms. Das Klingeln hörte auf und setzte nach kurzer Unterbrechung wieder ein. “Verdammt nochmal, ich muss üben”, brüllte Boris verärgert zum Fenster des Arbeitsraumes. Doch die Klingelzeichen nahmen darauf keine Rücksicht. Missmutig nahm er den Hörer ab: “Hallo?” Vom anderen Ende meldete sich Herr Groß von der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank: “Herr Baródin, guten Tag! Störe ich Sie?” Boris: “Eigentlich schon, denn ich habe zu üben. Mir stehen nur noch wenige Tage zur Verfügung. Aber wenn Sie schon dran sind…” Filialleiter: “Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Es ist in der Sache Kleinert. Da sind doch die Fahnder bei der Wohnungsdurchsuchung fündig geworden. Damit will ich sagen, dass sich ihr Verdacht bestätigt hat.” Boris: “Da bin ich erleichtert, und die junge Frau, die er als Rudolf mit falschen Versprechungen seit Wochen erpresste, wird nicht weniger erleichtert sein.” Filialleiter: “Die Fahnder haben Herrn Kleinert zum Polizeipräsidium mitgenommen, wo er weiter verhört wird. Für mich ist die Sache aufregend...”, Boris unterbrach: “Das glaube ich Ihnen sofort”, Filialleiter: “dass so ein Mann hier arbeitet, ohne schon früher entlarvt worden zu sein.” Boris: “Herr Groß, da will ich Sie trösten. So etwas kommt auch woanders vor. Wenn diese Larven früher gefasst würden, ich meine, bevor sie sich zu gut angezogenen Leuten entpuppen und sich geschickt tarnen, wie im Falle Kleinert der Erpresser sich im freundlichen Bankangestellten mit korrektem Anzug und passendem Schlips versteckt, dann sähe es auch in unserer Gesellschaft besser aus.” Filialleiter: “Da stimme ich ihnen hundertprozentig zu.” Boris: “Jedenfalls danke ich ihnen für diese Mitteilung, weil Sie mir dadurch einen Stein vom Herzen nehmen. Ich wäre ihnen dankbar, wenn Sie mich weiter auf dem Laufenden halten würden.” Filialleiter: “Wie ich schon sagte, wird Herr Kleinert im Augenblick im Drogendezernat vernommen. Die Beamten sagten mir zu, mich über den Stand der Dinge zu unterrichten. Ich habe der Bankdirektion bereits den peinlichen Vorfall gemeldet. Auf mich kommt nun die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens zu, das gründlich vorbereitet werden muss, damit eventuelle Regressansprüche, die aufgrund der fristlosen Entlassung zumindest im Raume stehen, abgewiesen werden können. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Bitte entschuldigen Sie die Störung, die ich verursacht habe. Aber ich hielt es für wichtig, Sie vom Ergebnis der Durchsuchung und über den gegenwärtigen Stand der Dinge zu unterrichten.” Boris: “Es war eine wichtige Mitteilung, und ich danke ihnen, Herr Groß.”
Boris legte den Hörer auf und ging in die Küche, um sich etwas zu essen zu machen. Viel Zeit durfte es nicht nehmen, weil er bis in den späten Abend am Konzert arbeiten wollte. So legte er zwei Eier in den kleinen Topf, der halbvoll mit Wasser gefüllt war, drehte den Knopf der Kochplatte auf die höchste Heizstufe, um das Wasser schnell zum Sieden zu bringen. Dann schnitt er sich zwei Scheiben vom Graubrot und bestrich sie dick mit Butter. Er hatte Hunger, denn bis auf ein paar Kekse, die er während des Übens in den Mund gesteckt hatte, hatte er seit dem Morgen nichts gegessen. Dass er am Abend noch im Bademantel war, das störte ihn nicht. In seinen Gedanken war er am zweiten Brahms-Konzert und nirgendwo anders.