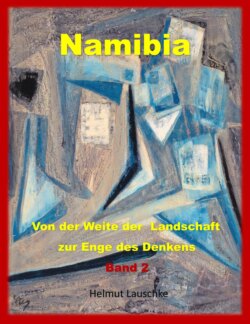Читать книгу Namibia - Von der Weite der Landschaft zur Enge des Denkens - Helmut Lauschke - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Helden, die Ratten und das sinkende Schiff
ОглавлениеDie Zeiten hatten sich verschlechtert, und die Front der Ablehnung zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Besatzungsmacht hatte sich weiter verhärtet. Jeden Tag gab es Tote und Verletzte, und ihre Zahl nahm zu. Die Koevoet hatte ihr Benehmen nicht geändert, sie walzte ganze Krale platt, wenn nur der Verdacht bestand, dass sich ein SWAPO-Kämpfer dort versteckt halten könnte. Der Bruder- und Schwesternmord war an der Tagesordnung, weil der, der es für Geld und gutes Essen tat, sich zum Morden verpflichtet fühlte, um nicht vom Geld und guten Essen abgeschnitten zu werden. Er tat es mit sattem Magen und wohlüberlegt, während der andere es mit hungrigem Magen und ohne Bezahlung tat, weil er an die Menschen dachte, denen die Befreiung aus der Knechtschaft seit Langem zustand. Der gut Genährte hörte nicht mehr auf die abgemagerten und besorgten Eltern, deren Kräfte verbraucht waren, die ihn vor dem Bruderund Schwesternmord warnten, während sie dem anderen Sohn und der anderen Tochter, die sich der Befreiung verschrieben, unter der Hand zusteckten, was sie an Nahrung und Bettdecken geben konnten und sie zu größter Vorsicht mahnten. Die Eltern verhielten sich still in ihrer Armut. Sie dachten viel und sprachen wenig über die Gefahren, die in der Fremde auf ihre Kinder lauerten. Sie zogen sich in die Hütten der Erbärmlichkeit zurück, zersorgten sich, wenn sie an Kain und Abel dachten, und beteten für ein baldiges Ende des fürchterlichen Krieges. Viele von ihnen wurden krank und starben nach kurzer Zeit, weil die Sorgen sie zerfraßen. Andere wurden aus ihren Hütten gezerrt, geknebelt und geschlagen, weil sie nichts auf ihre Söhne und Töchter kommen ließen, die ihnen die Freiheit zu Lebzeiten versprachen und sich dem Befreiungskampf angeschlossen hatten. Die Jugend konnte die Schändung der Väter und Mütter nicht länger ansehen, weil sie ihre Eltern waren. So verließen viele ihre Dörfer, einzeln und in Gruppen, versteckten sich hinter Büschen und in Höhlen vor den patrouillierenden „Casspirs“, gingen nachts die langen Wege bis zur Grenze, ließen sich von den Grenzbewohnern den Weg zwischen den ausgelegten Minen zeigen und überschritten die Grenze nach Angola mit der patriotischen Kraft, der selbst der knurrende Magen und die zerrissene Kleidung keinen Abbruch taten. Die Jugend machte es nicht mehr mit, das schwarz weniger wert sein sollte als weiß. Sie erhob sich und war begeistert, an der Befreiung der schwarzen Menschen aktiv teilzunehmen. Ganze Schulklassen verließen mit ihren Lehrern das verprellte Land der weißen Vorherrschaft. Oft wussten es nicht einmal die Eltern, wenn sie den Marsch über die Grenze machten und die Schicksalsgemeinschaft bauten, die enger und stärker war als in der Schule, weil nun die Unbedingtheit der persönlichen Disziplin und das gegenseitige Vertrauen zählte, wenn Decken, Brot und Wasser verteilt wurden, das Selbstverständnis der gegenseitigen Hilfe da sein musste, aus dem dann die Erkenntnis kam, dass nur aus einer solchen Gemeinschaft die unbezwingbare Kraft erwuchs, mit der das Ziel zu erreichen war. Die Koevoet machte weiter ihre nächtlichen Razzien im Hospital und nahm auf die Patienten keine Rücksicht. Es kam immer wieder vor, dass sie die Schlafenden auf dem Betonboden vor der Rezeption aus dem Schlaf scheuchte und Männer schlug und in die „Casspirs“ warf, die sich nicht ausweisen konnten. Der Superintendent mit der Knolle auf der Nase und den Schlaffalten im Gesicht, der hemdsärmelig von seinem großen Schreibtisch aus die Morgenbesprechungen führte und einmal mit kreideweißem Gesicht aus der Besprechung rannte, um sich auf der Toilette auszukotzen, weil er sich am Vortag beim Abendessen mit dem Kommandeur die Augen rot getrunken hatte, sich für den Rest der Besprechung auf der Toilette versteckt hielt und damit unangenehmen Fragen schlichtweg aus dem Weg lief, dieser Superintendent saß weiterhin hemdsärmelig hinter dem Schreibtisch, auch wenn seine Hemdsärmeligkeit nur eine Attrappe war, die nichts bewirkte. Er ging weiterhin heiklen Fragen aus dem Weg, indem er im entscheidenden Moment das Taschentuch aus der Hosentasche zerrte, es sich vors Gesicht hielt und kräftig und so lange hineinschnäuzte, bis sich das Momentum des Antwortgebens verzogen hatte, wobei er das rechte Brillenglas gleich mit zudeckte, wenn er die Brille nicht rechtzeitig abnahm, weil es zu eilig war. Da mutete ihm als Einäugigen aber auch keiner eine Antwort zu. Er war nicht dumm, und so zog er es vor, sein Clownsgesicht hinter dem Taschentuch zu verstecken, wenn es um ernste Dinge ging und eine Antwort wirklich erwartet werden musste. Der Toilettenlauf gegen die Zeit mit ihren Problemen blieb sein einsamer Höhepunkt. Die jungen Kollegen in Uniform, die ihre Dienstzeit abgeleistet hatten, wurden nicht mehr durch neue ersetzt. Das war ein deutliches Omen der zugespitzten Situation, wobei sich noch die Frage ergab, wann sich die letzte Spitze abgespitzt hatte oder noch vorher abbrach, was politisch und militärisch dem Ende gleichkommen musste. Es gab neue Gesichter im Besprechungsraum, Gesichter mit asiatischem Einschlag, wenn auch nicht so schlitzäugig wie ein japanisches, chinesisches oder mongolisches Gesicht. Es waren Filipinos, die aus Südafrika kamen und gleich ihre Frauen und Kinder mitbrachten. Zu erklären war das Kommen dieser kurz gewachsenen Bleichgesichter mit den kubischen Köpfen und sanften Gesichtszügen zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht, und noch weniger, dass sie gleich die Familien mitbrachten. War es ihnen in ihrer Heimat, oder als Emigranten in Südafrika so schlecht ergangen, dass sie hier das Paradies fanden oder zu finden glaubten, wo der Krieg erbarmungslos tobte, fragte sich Dr. Ferdinand. Er musste sich Zeit lassen, um eine plausible Antwort darauf zu finden. Ein asiatisches Gesicht gab ihm von jeher Rätsel auf, weil er es nicht lesen konnte und nie wusste, ob ein Lächeln wirklich ein Lächeln war, oder ob sich das Gegenteil dahinter verbarg. Er wusste nur so viel, dass das asiatische Gesicht asiatische Dimensionen des zweigesichtigen Januskopfes hatte, das mit Vorsicht gesehen werden musste. Zu diesem Gesicht passte der Würfelkopf, der von vorn und hinten und von den Seiten betrachtet werden konnte, ohne dass das Gesicht das asiatische Lächeln verlor. Es war schon etwas Unglaubliches, in solche Gesichter zu blicken, in die sich die Ereignisse unweit der angolanischen Grenze nicht einzudrücken schienen, wo doch die letzte Entscheidungsschlacht, bei der so viel auf dem Spiel stand, bereits in vollem Gange war. Das sagte jedenfalls der südafrikanische Brigadier, der vom Pulverfass sprach, auf dem die Weißen säßen, das jederzeit hochgehen konnte. Gehörten die Filipinos nicht auch auf dieses Fass, fragte sich Dr. Ferdinand, oder waren sie rassenmäßig von diesem Fasssitzen ausgeschlossen? Er wusste es nicht, erfuhr aber schon nach zwei Wochen, dass ihnen Häuser im Dorf, das durch das Warnschild „For Whites Only“ gekennzeichnet war, von der Administration zugewiesen wurden. Dr. Ferdinand kam beim Sehen und Denken nicht um den biogenetischen wie burisch politischen Januskopf herum. Die Filipinos waren schon im Alter, dass sie von Enkelkindern sprachen und pensionsberechtigt waren. Offensichtlich genügte das nicht, oder ihnen wurde das Recht des Alters nicht vergütet und ausgezahlt, weil das korrupte System im Heimatland ihnen das Pensionsgeld gekürzt oder weggefressen hatte. Es musste etwas mit dem Geld zu tun haben, warum nun diese asiatischen Gesichter mit der spanisch überstrichenen Tradition und dem katholischen Glauben hier auftauchten, davon war er überzeugt. Die Filipinos waren „Practitioners“, also keine Fachärzte, die an den ländlich abgelegenen Hospitälern der herabgesetzten Qualifikation für die Farbigen und Schwarzen vorwiegend in der Natalprovinz, im Osten Südafrikas, gearbeitet hatten, wo die Überfälle der Zulus auf die Weißen dramatisch zugenommen hatten, welche beraubt und getötet wurden, weil sich auch dort die Eingeborenen gegen die Weißen auflehnten und sich auf traditionelle Weise mit Stöcken und Spießen für die schwarze Armut und den weißen Reichtum rächten. Dr. Ferdinand traute den Filipinos, weil sie eben Asiaten waren, die sich über dreihundert Jahre die europäische Verformung mit dem besonderen Sinn fürs Geld draufsetzen ließen, den asiatischen Riecher für die Zukunft in mehr Sicherheit und den westlich verdrehten Verstand zur klaren Berechnung gleichermaßen zu, die sich in Noten und Münzen auch in der Fremdwährung auszahlen mussten. Er nahm deshalb diese lächelnden Janusgesichter, die das Schicksal vom indischen Ozean bis vor die angolanische Grenze gewürfelt hatte, als weiteres Omen für das nahende Ende. Die neuen Kollegen wurden der inneren Medizin mit den Tuberkulosesälen, der Kinderheilkunde und dem „Outpatient department“ zugewiesen, so dass es für die operativen Fächer keinen Ersatz für jene Kollegen in Uniform gab, die nach Dienstableistung nach Südafrika zurückgekehrt waren. Ein Gutes hatte es, dass nämlich unter denen, die das Hospital verlassen hatten, auch der „Leutnant des Teufels“ war, dem ärztlicher Teamgeist von Anfang an zuwider war, weil er die Zerstörung im Kopf hatte, an der er bis zum Schluss mehr interessiert war als an seinen Patienten, und die er hinterhältig und mit List betrieb. Für Dr. Ferdinand bedeutete es mehr Arbeit, weil die Kollegen in der Chirurgie noch unerfahren waren. Es bedeutete gleichzeitig mehr Seelenfrieden, weil ihm keiner mehr mit böser Absicht hinterherstieg. Er freute sich, dass er den jungen Kollegen in der Orthopädie hatte, der sich anstrengte, sich geschickt beim Assistieren und beim Durchführen kleinerer Operationen anstellte und bei den Patienten und Schwestern aufgrund seiner Freundlichkeit beliebt war. Auch hatte er es als Schriftsteller mit seinem Buch weitergebracht, worin er das Leben des jungen Ehepaars in dem kleinen Dorf an der Palliser Bucht nun doch nicht so schwer machte. Der junge Ehemann hatte bereits eine Arbeit als Mechaniker in einer Autowerkstatt in Wellington gefunden, und seine hübsche, junge Frau, die mittlerweile im vierten Monat schwanger war, wurde neugierig angeblickt, doch nun auch freundlich gegrüßt. Der junge Pastor hatte sich gegen die Gemeindemitglieder durchgesetzt und der schwarzen Ehefrau den Zugang zum sonntäglichen Gottesdienst erwirkt. So weit war doch ein Unterschied zum burisch verquerten anachronistischen System der Rassentrennung in Südafrika erkennbar.
Die Sonnenauf- und -untergänge waren so feurig wie eh und je, wenn auch die Sicherheitsmaßnahmen im Dorf sich verschärft hatten und es den Weißen unter Strafe gestellt war, die schwarze „Meme“ (Putz- und Bügelfrau) oder irgendeinen Schwarzen über Nacht im Hause schlafen zu lassen. Die Weißen machten sich Sorgen, was kommen würde, und die Angst hatte sich auf ihre Augen gelegt. Keiner traute der Zukunft noch so recht über den Weg, zu verfahren war die politische Kiste. So verwunderte es nicht, dass sich die Gesichtszüge in Richtung einer Selbstrettung nach dem Motto vergröberten: „Rette sich, wer kann!“ Es war Samstagnachmittag. Dr. Ferdinand setzte sich in den blauen Käfer und fuhr zum Postamt, um nach seiner Postbox 1416 zu sehen, die leer war. Er stieg wieder ein und setzte die Fahrt zum Dorfausgang bis zur Sperrschranke fort, wo sich die getarnte doppelte MG-Stellung auf dem Dach des wiederhergestellten Wasserturms befand. Dr. Ferdinand zeigte sein „Permit“ und konnte sitzen bleiben, als zwei Wachhabende in den Innenraum sahen, Motorhaube und Kofferraumdeckel hochhoben und wieder fallen ließen und die Schranke zur Weiterfahrt hochstellten. Der Versuch, die tiefen Schlaglöcher bis zur „T“-Kreuzung der Teerstraße zu umfahren, glückte nicht ganz, so dass die Räder einige Male kräftig hineinschlugen. Er hatte sich vorgenommen, die Fratres in der Missionsstation Okatana zu besuchen, und so bog er nach einem Kilometer von der Teerstraße nach rechts ab und fuhr an den armseligen Wellblechhütten von „Angola“ vorbei, wo die Armut und eine große Zahl angolanischer Flüchtlinge mit ihren kinderreichen Familien hausten. Schlanke Schweine mit faltig hängenden Bäuchen liefen neben mageren Ziegen, denen die Beckenknochen höckrig herausstanden, und rippig felldürren Hunden herum. Sie alle waren auf der Suche nach Ess- und Kaubarem. Unter den Hunden war eine ausgemagerte Hündin mit leeren, faltig hin und her schaukelnden Zitzen, aus denen drei junge Welpen den letzten Tropfen mit hungrigen Mäulern ausquetschten und ungehalten über die magere Ausbeute waren, indem sie in die Zitzen bissen, dass die Mutter vor Schmerzen aufschrie und trotzdem stehen blieb. Die Sandstraße mit den tief ausgefahrenen Reifenspuren der „Casspirs“ begann, und der Käfer schaukelte nach beiden Seiten. Dr. Ferdinand sah links den Wasserturm, von dem aus man ihm bei einer frühnächtlichen Rückfahrt von der Mission zunächst Leuchtkugeln in Blau, Rot und Gelb vor die Windschutzscheibe und schließlich scharf hinterher und nach seinem Leben geschossen hatte. Er bedankte sich noch einmal bei seinem Schutzengel, der ihn mit dem Käfer in eine riesige Sandwolke gesteckt hatte, dass den Augen hinter dem MG das Sehen verging. Die Spuren der „Casspirs“ waren tiefer und zahlreicher als bei seiner letzten Fahrt, was der letzten Entscheidungsschlacht durchaus entsprach, bei der so viel auf dem Spiel stand. Dass sie aber unmittelbar ans Missionsgelände heranführten und den Platz vor dem kleinen Missionshospital und der schlichten Kirche kreuz und quer aufgewühlt hatten, das war ein schlechtes Zeichen. Da musste erst kürzlich etwas passiert sein, denn sonst hätten die Menschen mit den Schwestern und Fratres den Sand schon wieder glatt geharkt, weil sie die Ordnung liebten und den Frieden für den Gottesdienst am morgigen Sonntag brauchten. Das Tor war verkettet. Dr. Ferdinand wartete, bis eine Schwester mit Küchenschürze und Schlüssel aufs Tor zukam, es öffnete und dann wieder verkettete und das Schloss einhängte, als er das Haus der Fratres erreichte und den Käfer in den Schatten einer üppigen Baumkrone abstellte. Die Tür zum langen Flur war nicht verschlossen, so dass er den Weg zum dritten Raum links nahm, in dem drei Fratres saßen, von denen einer bereits betagt war. „Ach, Herr Doktor, das ist ja schön, dass Sie wieder mal kommen, Sie waren lange nicht mehr hier.“ Einer legte den „Osservatore“, das offizielle Vatikanblatt in der deutschen Ausgabe, zusammen und auf den Tisch, der andere hielt die „Deutsche Zeitung“, eine Landeszeitung in deutscher Sprache, in der Hand, als sie einander begrüßten. Dr. Ferdinand setzte sich an den Tisch, auf dem noch einige Palmzweige vom vergangenen Palmsonntag lagen. Der andere Frater legte die Zeitung ebenfalls auf den Tisch zurück. „Wissen Sie“, begann der jüngere Frater, der so jung nicht mehr war, „gestern Abend bekamen wir Besuch von der Koevoet. Die durchsuchten die Mission und das Hospital. Die Koevoetleute sagten, dass sie nach Männern suchen, die vor einigen Tagen aus dem Polizeigewahrsam ausgebrochen waren und bewaffnete Männer der SWAPO seien. Wir konnten da nichts machen, weil sie uns nicht glaubten, dass auf dem Missionsgelände diese Männer nicht sind. Können Sie sich die Aufregung vorstellen, es war doch Karfreitag, und die Menschen bereiteten sich auf das Osterfest vor.“ Die anderen Fratres machten ein ernstes Gesicht, und Dr. Ferdinand konnte sich die Aufregung vorstellen. „Sie haben die ganze Mission durchsucht, sind in jedes Krankenzimmer gegangen, wie die Schwester sagte, dass sich die Patienten erschrocken haben. Sie haben die Räume der Schule und die Wohnstellen der Lehrer kontrolliert, waren in der Küche, wo die Schwester und das Personal noch mit dem Aufräumen und Spülen beschäftigt waren, durchsuchten mit hellen Lampen die Halle, wo die Autos stehen. Sie wollten sogar in die kleine Kapelle, wo die Schwestern ihre Nachtmesse hielten. Da bedurfte es des energischen Einschreitens von uns allen, sie von diesem Wahnsinn abzuhalten. Die Kirche haben sie, Gott sei Dank, verschont. Dann haben sie sich den Nachtwächter vorgenommen, den guten, alten Mann, der hier seit vielen Jahren seinen Dienst tut. Frater Huben sah es, wie sie ihn zwischennahmen. Er eilte ihm zu Hilfe. Der alte Mann konnte sich nicht ausweisen, und die Koevoet war schon dabei, ihn zu verladen, was Frater Huben dann noch mit guten Worten verhinderte. Sie hatten hier nichts gefunden, und das wollten sie nicht glauben. Mit den Autos kurvten sie um die Kirche und leuchteten die Gegend ab. Dann fuhren sie in die umliegenden Siedlungen, durchsuchten Kral für Kral und luden einige Männer auf, die sie mit nach Oshakati nahmen, weil sie keine Papiere hatten.“ Dr. Ferdinand dachte an die letzte Entscheidungsschlacht, die vor der Mission nicht Halt machte und nun bis vor die Tür der kleinen Kapelle heranreichte. Der Frater war erregt: „Und das wenige Stunden vor dem Auferstehungsfest des Herrn. Können Sie sich das vorstellen?“ Es war vorstellbar, denn am Oshakati Hospital ging es noch ganz anders zu, da wurden psychisch kranke Patientinnen mit dem Gewehrkolben geschlagen und Männer, die sich nicht ausweisen konnten, trotz ihrer Gebrechen verprügelt und in die Bäuche der „Casspirs“ geworfen. Dr. Ferdinand fühlte sich genötigt, dazu etwas zu sagen: „Es ist schon traurig, wie rücksichtslos die Koevoet mit den Menschen umgeht. Diesen Leuten ist die Achtung vor dem Menschen völlig abhanden gekommen. Die können nicht schreiben und nicht lesen, aber schlagen, das können sie.“ „Sagen Sie das nicht“, erwiderte der betagte Frater, „einige von denen waren hier in der Schule, und ich habe ihnen das Lesen und Schreiben und die Bibelkunde beigebracht. Und das ist es, was mich traurig macht, dass sie trotzdem den Respekt vor den Menschen verloren haben. Denn was hilft die ganze Schule mit der Bibelkunde, wenn sie später als Barbaren wiederkommen und die Mission auf den Kopf stellen, die sie ehren sollten.“ Dr. Ferdinand verstand die Trauer, dass der Unterricht es nicht geschafft hatte, aus den jungen Menschen durch etwas Bildung ältere Menschen zu machen, die Achtung vor dem Menschen hatten und den menschlichen Respekt höher ansetzten als Geld und gutes Essen. „Diese Menschen haben nichts gelernt“, fuhr der betagte Frater mit dem leicht nach vorn gekrümmten Rücken fort. „Sie sind trotz der Schule böse Menschen geworden, weil sie das Wort Gottes entweder nicht verstanden oder verworfen haben. Sie hätten nach seinem Wort fragen sollen. Sie taten es nicht und verluderten in ihrer geistigen Beengtheit mit der Folge, dass sie das fünfte und die anderen Gebote gedanken- und bedenkenlos übertreten. Das konnte ich damals ihren Kindergesichtern nicht ablesen, als sie vor mir auf der Schulbank saßen. Hätte ich es damals geahnt, ich hätte sie als unbelehrbar nach Hause geschickt, denn so viele Kinder warteten vergeblich auf einen Platz in der Schule, um im Lesen und Schreiben unterrichtet zu werden. Für alle reichten die Räumlichkeiten der Schule nicht, und ich war der einzige Lehrer.“ Das ging Dr. Ferdinand gründlich durch den Kopf, weil er sich fragte, ob ein Lehrer es erwarten durfte, dass alle Kinder gute Menschen werden, wenn sie Unterricht bekommen und noch gute Noten in der Schule schrieben. Die Welt müsste dann doch viel besser sein, wenn die Schule in der Lage wäre, gute Menschen heranzubilden. Doch der Teufel in der Welt ist kein Dummkopf, er führt seine Leute mit blendender Bildung, hoher Intelligenz und einer fertigen Sprache vor, in der hypnotische Kräfte sind, die die menschliche Vernunft ins Verderben schickt. Er fragte deshalb den Frater, ob er das nicht zu pessimistisch sehe. „Mag sein“, antwortete er, „aber glauben Sie mir, ich sage es aus meiner langjährigen Erfahrung, der Spalt zwischen Pessimismus und Optimismus ist ein sehr schmaler. Es bedarf nur eines kurzen Steges, den schmalen Spalt der Realität nach beiden Seiten hin zu überqueren, weil die Realität in einer tiefen Schlucht schlummert und nur wie die Spitze des Eisbergs hervortritt. Natürlich sieht die Eisbergspitze anders aus, je nachdem, wie sie von der Sonne beleuchtet wird, weil eine Seite im Licht und dafür die andere Seite im Schatten liegt, wobei aber der ganze Eisberg gar nicht erst ans Tageslicht kommt. Und da liegt das Problem. Ähnlich ist es mit dem Menschen, wenn er noch auf der Schulbank sitzt, sie sehen ihm in die Augen und glauben seinen Charakter zu erkennen und können es nicht begreifen, wenn er sich ganz anders entpuppt.“ Dr. Ferdinand stieg der Schluchtabbildung nach und fragte ihn, wie er sagen konnte, jene Kinder, die sich später nicht zum reifen Menschen entpuppt hatten, als unbelehrbar nach Hause zu schicken, wenn er es damals geahnt hätte. „Sehen Sie“, sagte der alte Frater, „das Leben ist kurz, und so gibt es nur wenige Chancen, ein Mensch zu werden, während für den Unmenschen die Chancen viel größer sind. Die Kinder mit den harmlosen Gesichtern, die den Keim zur Menschenverachtung bereits in sich trugen, verwehrten anderen Kindern mit denselben Gesichtern der Unerfahrenheit den Schulbesuch, weil es die Räumlichkeiten und ich als einziger Lehrer nicht schafften. Und da bin ich der Meinung, dass da im richtigen Augenblick die falsche Auslese getroffen wurde, weil unter diesen Kindern auch jene Kinder waren, die den Keim zur Menschlichkeit in sich hatten und bedauerlicherweise vom Bildungsprozess ausgeschlossen wurden, weil sie keinen Unterricht im Lesen und Schreiben und der Bibelkunde bekamen. Da mache ich mir den Vorwurf der falschen Auslese, den mir keiner nehmen kann. Oder glauben Sie, dass Sie es besser gekonnt hätten?“ Dr. Ferdinand schaute dem betagten Frater ins Gesicht, der sich die Brille putzte, und musste nach Worten suchen: „Nein, das mit der Auslese zur richtigen Zeit, das hätte ich mit Sicherheit nicht gekonnt, dafür verstehe ich zu wenig vom Menschen.“ „Sehen Sie, nun verstehen Sie mich besser, denn das war mein Problem, das ich nicht lösen konnte, und deshalb halte ich den Selbstvorwurf aufrecht“, sagte der Frater. „Gibt es denn Menschen, die das mit der richtigen Auslese zur richtigen Zeit können?“, fragte Dr. Ferdinand naiv. Der Frater: „Das weiß ich nicht, doch entbindet mich das ungelöste Problem nicht von der übernommenen Verantwortung als Lehrer, selbst wenn es unlösbar ist.“ Dr. Ferdinand erwähnte in diesem Zusammenhang, dass das Problem der menschlichen Geringschätzung auch bei Ärzten vorzufinden war, die aus egoistischen Motiven heraus an der Gemeinschaft wie Ratten nagten, die sich dem Teamgeist widersetzten, weil sie darin keinen Vorteil sahen, die ihn zerstörten, weil sie den Keim der Zerstörung in sich trugen und sich um die Nöte der Patienten nicht kümmerten, weil ihnen die Menschlichkeit fehlte, von der sie nur dann sprachen, wenn es sie selbst betraf.
Das verwunderte den Frater überhaupt nicht. Er nahm es mit dem kleinen Einmaleins auf, als er sagte, dass das nur eine logische Folge sei, wenn einer das Einmaleins nicht gelernt hatte und später die Eins nicht von der Zwei unterscheiden will, weil er die Zwei für unteilbar hält. Es kam einer Quadratur des Kreises gleich, und so ließen sie das Problem der Auslese bei der Eins bewenden. Die Fratres nahmen Dr. Ferdinand mit zum Abendessen, der Zeuge eines ergreifenden Gebetes wurde, das Frater Huben sprach: „Herr, sieh in unsere Herzen, die versandet sind, gib uns die Kraft, die heiligen Räume vom Sand zu befreien. Sag uns, wie wir’s machen sollen, denn wir sind zu schwach geworden, den Sand herauszuschaufeln, weil wir das Licht der Zuversicht verloren haben. Wir sitzen beengt und gedrückt und wissen nicht, wie wir uns noch helfen sollen, weil immer wieder die Sandlawinen von oben herabdonnern und uns mit Angst und Schrecken zuschütten. Wir zittern vor dir, weil wir dein Wort nicht befolgen und uns der Mut fehlt, dein Wort ernst zu nehmen und es ohne Wenn und Aber in die Tat umzusetzen. Gib uns die Kraft, dein Wort so aufzunehmen, wie du es willst und nicht, wie wir es wollen, weil wir da immer etwas weglassen, und da die Lüge beginnt. Dass du die Armen und Hungrigen, die Verstoßenen und Kranken nicht vergisst, das sprechen wir dir zu; wir sind uns aber nicht sicher, ob wir an diese Menschen genug denken und für sie genug tun, wenn wir vor dem vollen Teller sitzen und ihn leeren, denn im Teilen mit den Armen, da hapert es noch, weil wir zur Nächstenliebe uns selbst überwinden müssen. Herr, stelle die Weichen für den Frieden, denn wenn du in die Herzen siehst, dann findest du sie aufgewühlt wie den Platz vor deiner Kirche, wo die Reifen der Gewalt mit dem groben Profil tief das Kainsmal eingefahren haben. Morgen ist das Fest der Auferstehung, und die Menschen sind voller Erwartung. Nimm uns als deine Kinder an mit all unseren Fehlern und Sünden, die wir täglich begehen, weil wir schwach sind, und verstoße uns nicht. Gib uns das rechte Wort zum Beten und die Kraft des Glaubens, dass wir den Sand aus deinen Räumen herausschaufeln und sie sauber fegen, damit wir dein Wort besser hören und uns nicht länger hinter der Taubheit verstecken. Darum bitten wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen!“
Es gab eine leichte Kost mit saurem Hering, der herzhaft schmeckte, Salzkartoffeln und in Zitrone angemachten grünen Salat. Dazu wurde hausgemachter Zitronensaft getrunken, der gut gesüßt und durch Eiswürfel kalt gehalten war. Er löschte den Durst auf erfrischende Weise, wobei auch die Zunge auf ihre Kosten kam. Nach dem Essen erzählte Dr. Ferdinand noch einige Anekdoten aus dem Hospital, und die Fratres lachten auf, als er auf den Superintendenten zu sprechen kam, der jedes Mal das Taschentuch aus der Hosentasche zog und sich so lange vors Gesicht hielt und hineinschnäuzte, bis er meinte, dass sich eine Antwort auf Fragen bezüglich des rüden Verhaltens der Koevoet erübrigte. Die jüngeren Fratres lachten sich schief, als er ihnen die Flucht des Superintendenten aus dem Besprechungsraum schilderte, bei der er vor der Tür gefallen wäre, wenn er ihn nicht aufgefangen hätte, und auf die Toilette rannte, um sich vom restlichen Alkohol, den er am Abend zuvor mit dem Kommandeur bis zur Augenröte genossen hatte, zu befreien und auf diese Weise einer Stellungnahme zum Antrag zweier Kollegen aus dem Wege lief, dass er dem Kommandeur der Koevoet von dem rücksichtslosen Vorgehen seiner Leute den Patienten gegenüber Mitteilung geben sollte, damit das in Zukunft unterblieb. Der betagte Frater schmunzelte und machte eine fast philosophische Bemerkung, als er sagte, dass es in Zeiten wie dieser schwer sei, Verantwortung zu tragen, weil die Prinzipien von Recht und Ordnung ihre Gültigkeit verloren hätten. Dr. Ferdinand stimmte ihm zu und fügte an, dass das wahrscheinlich auch für den Superintendenten zutraf, weil der sich so lange auf der Toilette versteckt hielt und sich dort entleerte, bis die Anwesenden nach zehnminütigem Warten die Besprechung für beendet erklärten und den Raum verließen. Es gab ein lachendes „Auf Wiedersehen!“, als Dr. Ferdinand in den Käfer stieg und die Scheibe herunterdrehte, um den Fratres ein frohes Osterfest zu wünschen. Ein Frater sagte, ähnlich wie beim letzten Mal, dass es schön und interessant war und fügte diesmal hinzu: „Da haben wir ja richtig lachen können.“ Der andere Frater hatte das Tor schon aufgeschoben, als Dr. Ferdinand das Licht anstellte, wendete und an der Torausfahrt noch einmal anhielt, um auch diesem Frater frohe Ostern zu wünschen. Dann setzte er die Fahrt über den Platz fort, der von den breiten Reifenspuren der „Casspirs“ aufgewühlt war, und hörte bei der ersten Linkskurve noch, wie der Frater die schwere Kette ins Tor einhängte.
Dr. Ferdinand schaukelte sich langsam über die eingefahrenen Gräben, schob das Bodenblech kratzend über die aufgeworfenen Sandhügel auf der Straße und schlug mit den Rädern in tiefe Löcher, die nicht zu umfahren waren, als ihm eine Kolonne von „Casspirs“ mit aufgeblendetem Licht entgegenkam. Er brachte den Käfer am leichten Abhang des Straßenrandes zum Stehen, ließ den Motor laufen und überließ der Kolonne die freie Fahrt, die mit Getöse und fünf Fahrzeugen an ihm vorüberraste und ihn in eine dicke Sandwolke hüllte, so dass er für einige Minuten von der Straße nichts mehr sah. Er setzte die Fahrt fort, als die Straße wieder zum Vorschein kam, und sah einen Esel mit allen vier Beinen nach oben am Straßenrand liegen, der offenbar von einem „Casspir“ mitgerissen und in den Tod geschleudert wurde. Ein zweiter Esel beschnupperte ihn, um sich Gewissheit zu verschaffen. Er stand begriffsstutzig und störrisch daneben und hielt dazu das rechte Hinterbein hoch und angewinkelt. Dr. Ferdinand sah das Licht auf dem abgelegenen Wasserturm und wollte es diesmal nicht auf Leben und Tod ankommen lassen. So nahm er noch vor der lang ausgezogenen Rechtskurve den schmalen Weg zum Turm, setzte den Gang zurück, um sich mit mehr Kraft durch die hohen Sandbänke zu schieben und erreichte mit Mühe den Außenposten der Kontrolle. Soldaten mit entsicherten Gewehren nahmen die Kontrolle vor, denen er das „Permit“ zeigte. Sie unterzogen den Käfer der militärischen Inspektion mit dem erwarteten Misstrauen, leuchteten den Innenraum aus, verschoben die Sitze nach hinten und vorn, fuhren mit den Händen unter den Sitzen entlang, hoben das Ersatzrad im Kofferraum hoch, besahen sich den luftgekühlten Motor und gingen einige Male um das Fahrzeug herum. Sie gaben ihm das „Permit“ zurück und fragten nach dem Grund seiner Reise durch die Dunkelheit. Er sagte ihnen, dass er die Fratres in der Missionsstation besucht hatte, die ihn noch zum Abendessen eingeladen hätten, was ihnen schließlich reichte, um ihn weiterfahren zu lassen. Dr. Ferdinand fand den Wasserturm mit der aufgesetzten MG-Stellung zur Festung ausgebaut, um die herum zwei „Casspirs“ standen, auf denen über der Luke des Fahrerhauses Männer MGs nach links und rechts drehten, als hätten sie etwas im Visier. Er setzte die Fahrt auf dem ausgefahrenen Weg fort, wobei er stecken blieb, bevor er die Straße mit der lang gezogenen Rechtskurve erreichte. Er setzte zurück, zog den Käfer aus dem Sand, wechselte von der rechten auf die linke Spur und drückte den Fuß aufs Gaspedal, woraufhin der Käfer sich durch die Sandbank bis zur Straße hochschob. Es war dunkel über „Angola“, wo sich die Menschen in die Hütten verpfercht hatten. Einige abgemagerte Hunde streunten ziellos auf der Straße herum, weil sie nicht fanden, was sie suchten, und liefen, mitunter auf drei Beinen und alle mit eingezogenen Schwänzen, dem Käfer im letzten Augenblick aus dem Weg. Auf der Straße waren keine Menschen, als Dr. Ferdinand auf der geteerten Straße nach links abbog und das Leben den Geist aufgegeben hatte, bis er nach einem Kilometer nach rechts abbog, noch einmal kräftig die Räder schlagen ließ und vor der Sperrschranke anhielt, wo auf dem zurückgesetzten Wasserturm gleich zwei MGs in Stellung waren. Sechs Wachhabende versahen hier den Dienst. Er zeigte sein „Permit“ vor und hatte mehr Geduld als Verständnis, als zwei Wachhabende das Auto auf den Kopf zu stellen versuchten und trotzdem nichts fanden, weder im Innen- noch im Kofferraum. Bodenblech und Kotflügel gaben ebenfalls nichts her. Er war nun im Dorf, in dem kleine Mannschaftswagen Patrouille fuhren, auf denen junge Soldaten auf längs gestellten Bänken saßen und die Gewehre zwischen den Beinen hielten. Dr. Ferdinand zog den Zündschlüssel heraus, als der Käfer unter dem Dach des Abstellplatzes stand, setzte sich auf die Stufe zur Veranda und zündete sich eine Zigarette an. Ostern stand vor der Tür. Es war kein Ostern, wie er es sich wünschte, und so dachte er, was anders sein sollte, um das große Fest mit dem Frieden zu verbinden. Für ihn bestand kein Zweifel, dass das System abgewirtschaftet war, aber eben noch nicht ganz, und er rechnete mit Dingen von noch größerer Verdorbenheit bei Menschen, die hier auftauchen und wie Ratten umherhuschen und nach Beute jagen würden. Es waren die Typen, die aus dem letzten Durcheinander ihren Vorteil zogen, rücksichtslos vorgingen und den instinktsicheren Riecher hatten, rechtzeitig vom sinkenden Schiff abzuspringen, um zu den Ersten zu gehören, die in der Schlange standen, wenn es um die Verteilung der Posten und Pöstchen im neuen System ging. Die Beute hatten sie dann längst eingefahren, verscharrt und verscherbelt, so dass sie wieder das harmlose Gesicht aufsetzten, das kein Wässerchen trüben konnte, wobei diese Schweinehunde immer wieder Erfolg hatten, weil sie bis auf die Knochen verdorben, bis auf die Zähne skrupellos und bis unters Dach korrupt und gerissen waren. Der alte Frater hatte Recht, als er sagte, dass es in Zeiten, in denen die Prinzipien von Recht und Ordnung ihre Gültigkeit verloren haben, schwer ist, Verantwortung zu tragen, oder, das hängte Dr. Ferdinand dem Satz noch an, es leicht ist, unverantwortlich zu sein. Er schaute in den Sternenhimmel und hörte Schüsse in der Ferne, dann MGs, wahrscheinlich von den Wassertürmen, die ganze Ketten verschossen. Das Militär sparte nicht mit Munition, wenn es um den Verdacht ging, es könnte ein SWAPO-Kämpfer sein, und schoss meist harmlose Zivilisten nieder, die ein weggelaufenes Rind oder ein paar Ziegen einfingen, weil sie auf ihr Fleisch angewiesen waren, woraufhin der Verdacht wie eine Seifenblase in der Luft zerplatzte. Der Krieg, der mit Anstand nichts zu tun hatte, war auf ein Niveau gesunken, das weit unter dem Animalischen lag, wenn die Männer der Koevoet versuchten, in die kleine Kapelle einzudringen, wo die Schwestern ihre nächtlichen Exerzitien und Gebete hielten. Diese grobe Respektlosigkeit muss ein schwerer Schock für die Fratres und Nonnen gewesen sein, die mit einer solchen Verrohung nicht gerechnet hatten. Doch das konnte das Ende noch nicht sein, auch wenn die Stiefel der Gewalt schon an der Türschwelle zur Gebetskammer waren. Dr. Ferdinand, der aufgrund seiner persönlichen Geschichte auch schwarz malen konnte, machte es nicht, weil er nicht gleich den ganzen Teufel an die Wand malen wollte. Ein Ostern im Krieg war wie ein Ei über dem Feuer, dessen Schale zersprang, den Inhalt vergoss und in der Flamme verrußte. Das Osterereignis und seine Bedeutung ließen sich so recht nicht finden, weil das Leben seit Langem aus den Fugen geraten, die Tür zur Zivilisation aus den Angeln gerissen und zerhackt war und der menschlichen Vernunft durch das legalisierte Unrechtssystem der Boden unter den Füßen entzogen und durch Minen und Granaten verwüstet wurde. Der weiße Blick in die Zukunft hatte keine Vision, er war kurzsichtig, weil er aus Angst und nach dem Motto „Rette sich, wer kann!“ zusammengesetzt war. Wie es weitergehen soll? Keiner wusste es, und böse Ahnungen gingen dem Nichtwissen voraus, weil jeder irgendwelchen rassistischen Dreck am Stecken hatte, wenn nicht noch korrupte Machenschaften mit der Selbstbereicherung vor den traurigen Augen der Armen hinzukamen. Jeder stellte seine Vermutungen an, hatte das Bild mit dem sinkenden Schiff bereits im vordersten Denkstübchen über dem Augenfenster aufgehängt und betrachtete es mit Sorge, ohne deswegen an die Schwarzen zu denken, denen es seit Generationen viel schlechter ging, gab sich selbst eine Prognose des „Überlebens“, wobei das Würfeln und Auslegen von Karten im Frage-und-Antwort-Spiel an Bedeutung gewann. Die sonntäglichen Gottesdienste waren gut besucht. Es wurde streng gepredigt und gebetet, und das noch immer in weiß. Die Tauben vor dem kleinen Glockenstuhl nahmen es gelassen hin und kackten den Kirchgängern weiterhin auf die Köpfe, wenn sie sich vor dem Eingang verredeten und nicht ins Innere eilten. Der Hellsichtige, vielleicht der Phantasiebegabte noch, konnte diese grauweißen Kackflecken in den Haaren oder auf den sonntäglich verschönten Schultern als prophetische Zeichen der unausweichlichen Umwälzung deuten. Manche dachten wahrscheinlich schon früher über die Sinnhaftigkeit der Kopfbekackung und der wirksamen Fallgesetze nach, wenn sie zum Glockenstuhl nach oben schauten und den Tauben beim Fallenlassen ihrer Botschaft das rechte oder linke Auge zudrückten. Doch von Hellsichtigkeit und Phantasiebegabung war bei den stiernackigen Querschädeln nicht viel zu merken. So verliefen sich die vorausgedachten Gänge ohne Weitsicht, sie kreuzten und wanden sich in erstaunlicher Kurzperspektive, sie waren verbogen und mussten zum Entgleisen führen. Das Bild der in- und durcheinander gehenden Gleise eines Güterbahnhofs war das Abbild des Durcheinanderdenkens mit all seinen Verwirrungen. Die Weißen wurden geizig bezüglich des Vertrauens; sie trauten eigentlich keinem mehr richtig über den Weg. Sie behielten die Sachen des Vorgedachten für sich und nahmen sich dabei noch der anderen Wertgegenstände an, deren Besitzer sie nicht waren. Mit all den eigenen und fremden Dingen dachten sie verpackungsweise den kommenden Dingen voraus und genierten sich wenig für die schwarz aufgedruckten Nummern an Stühlen, Tischen, Waschmaschinen und Eisschränken, oder die unübersehbaren „SWAA“-Stempel (Southwest Africa Administration), die den Bettbezügen, Decken und Handtüchern heißwaschfest aufgedruckt und an den Unterseiten der Tassen, Untertassen und Teller sogar eingebrannt waren. Es wurde an alles gedacht und über das zulässige Maß probeverpackt, alles sollte verfrachtet werden, was nicht niet- und nagelfest war, um so für den Ernst- und Notfall gerüstet zu sein. Die Verantwortung war eben untragbar in einer Zeit, in der die Prinzipien von Recht und Ordnung ihre Gültigkeit verloren hatten, wie sich der alte Frater jedenfalls ausdrückte. Da war dann die Gedankenverkehrung auch nicht mehr fern, dass in einer solchen Zeit das Tragen von Verantwortung nicht nur unerträglich, sondern mit dem Leben, sprich Überleben, nicht mehr vereinbar und das Festhalten an ihr nicht mehr zu verantworten war. Die Zahl der Weißen, die der Administration noch etwas zutrauten, schwand drastisch, weil sich diese der Verantwortung seit Langem entledigt hatte und die Korruption in hanebüchenem Ausmaß betrieb. Jeder wusste es, weil zu viele daran beteiligt waren. So gab es „gute“ Gründe, diese Sachen nicht noch kurz vor Toresschluss an die große Glocke zu hängen. In dieser Zeit des Durcheinanders ging der Respekt vor dem Fremdbesitz verloren, und das Stehlen des Fremdeigentums, das dem Volk gehörte, war unverkennbar. Das Volk sah es und konnte nichts dagegen machen, weil den Menschen die Rechte der Zivilisation genommen waren. Die Weißen sahen die Schwarzen nicht als ebenbürtige Menschen. Dr. Ferdinand hatte das Bild der kreisenden Geier vor sich, die sich über die vorzerlegte und angekaute Beute hermachten und sie bis auf die Knochen entfleischten. Das konnte nicht gut gehen, wenn es überhaupt keine Moral mehr gab. Was nutzten da die strengen Predigten und Gebete in der weißen Kirche und die gurrenden und kackenden Tauben, fragte er sich mit einem Anflug der Depression. Er verstand den Brigadier besser und glaubte ihm, was er in einer Morgenbesprechung angekündigt hatte, dass er wie die anderen Weißen auf einem Pulverfass saß, das jederzeit hochgehen konnte. Wer sich so benahm, hatte es anders nicht verdient; einen Höhenflug, wie ihn Graf Münchhausen seinerzeit machte, würde es mit Sicherheit nicht geben, damit war Dr. Ferdinand auch einverstanden. Er schloss seine vorösterliche Betrachtung ab, knipste das Licht im Wohnzimmer an und machte sich einen Kaffee, las in den „Großen Philosophen“ und nickte im Sessel ein. Später im Bett zog er sich die Decke bis unters Kinn.
Es war Ostersonntag, so ließ er die Hähne krähen und freute sich über die frohe Botschaft, die sie verbreiteten. Matthäus sprach von einem großen Erdbeben, vom Engel des Herrn, der vom Himmel herabkam, der den Grabstein wegwälzte und sich daraufsetzte. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Kleid war weiß wie Schnee, und die Grabhüter erschraken vor Furcht. Markus berichtet von Spezereien, die Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jakobs, und Salome nach Ablauf des Sabbats kauften, um den Herrn zu salben. Sie fanden das Grab offen und leer und konnten es nicht erklären. Sie gingen ins Grab und entsetzten sich, als sie einen Jüngling im langen, weißen Kleid drinnen sitzen sahen. Lukas berichtet auch von den Spezereien, von dem Stein, der vom Grab abgewälzt war und von zwei Männern mit glänzenden Kleidern, die die Erschrockenen fragten, was die Lebendigen bei den Toten suchten. Johannes spricht von Maria Magdalena, die zum Grab kam, als es noch finster war, und den Stein vom Grabe weggenommen fand. Maria weinte und schaute ins Grab. Sie sah dort zwei Engel sitzen und fragte sie nach dem Leichnam Jesu, der schon hinter ihr stand, und sie erkannte ihn erst an seiner Sprache. Dr. Ferdinand ging gedanklich den Stationen des Kreuzweges nach und sah vor sich die Männer und Frauen in den zerlumpten, blauweiß gestreiften Jacken und Hosen mit den geschorenen Köpfen, die abgemagert und apathisch durch den Schnee schlurften, um wenig später den Tod durch Genickschuss zu empfangen. „Was haben die Menschen vom Kreuz gelernt?“, fragte er sich und konnte sich keine Antwort geben. Das Töten war zum Gewerbe geworden, das professionell betrieben wurde, weil es auch noch einträglich war. In den Türmen der Ministerien und Verwaltungen mit dem pyramidalen Organogramm saßen die Tötungsspezialisten in der zweithöchsten Etage, wenn nicht ganz oben. Mit dem guten Fensterblick übersahen und hantierten sie durch Befehle und Erlasse die riesige Tötungsmaschine mit der großen Walze, bei der es an Sprit und Wartung nicht fehlte, und maßen die Effizienz an der Anhäufung von Reichtum und Macht. Den Begriff der Auferstehung wollten sie sich nicht machen, das begriffen sie nicht, weil sie das nicht interessierte. Der Kreuzestod sollte der Menschheit dienen, und die nahm es nicht zur Kenntnis, bediente sich stattdessen der Pyramiden der Menschenverachtung und immer mehr ihrer Fensterblicke, je höher und professioneller ihr unmenschliches Gewerbe wurde. Wieder verkündeten die Hähne die frohe Botschaft des Tages. Sie krähten sie kräftig hinaus. Dr. Ferdinand nahm das Krähen zum Anlass, über das „neue Leben“ im Römerbrief zu lesen und was Paulus da zu sagen hatte: „Wir sind durch die Taufe mit ihm begraben in den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Denn wenn wir durch die Taufe in ihn eingepflanzt sind, den gleichen Tod zu sterben, dann werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.“ Was für ein glaubensstarker Mensch Paulus war, dass er so etwas sagen konnte. Verdient hatte es die Menschheit nicht, weil sie am Bösen verdiente. Das wusste der kämpferische Paulus auch, trotzdem machte er den Menschen Mut, besonders denen, die unter Gewalt und Rechtlosigkeit litten und keinen Ausweg mehr sahen. Dr. Ferdinand hatte sich die Zeilen eingeprägt und stieg unter die Brause, als das Glöckchen die Burengemeinde zum Ostergottesdienst zusammenbimmelte. Er dachte sich beim Haarewaschen, dass der Schritt zum Guten nur über den Neuanfang getan, das neue Leben nur im neuen Menschen begonnen werden konnte. Der Mensch musste stark genug werden, um das Alte und Verdorbene abzustreifen, sich charakterlich zu häuten und den faulen Kern aus sich herauszuschneiden. Wenn er es nur machen würde! Dabei schlug er sich kräftig gegen die eigene Brust. Er legte die Pappe unter ein Blatt Papier und schrieb ein Ostergedicht an einen Menschen, dessen Namen und Adresse er nicht kannte:
Ostern an der Grenze, weil es an der Grenze ist, wo ich sitze und schreibe. Bist du durchs Kreuz gegangen, das da in der Nacht im Süden stand und hast die Grenze überschritten, die durch Minenfelder gesichert ist? Es ist am Ende der Welt, wo ich sitze und überlege am Ende jener Welt, wo die Grenze das Kleine versiebt, aus dem dann die Wüste wächst, Knochen und Steine verstößt, die nicht durchs Siebloch passen. Wenn es noch den Geist an der Grenze gibt, dann soll er das Gute vom Bösen trennen, bevor sich beides in Lagen verschichtet, damit es Ausgrabungen leichter haben. Wenn ich’s genauer besehe, was in der Nacht passierte und grenznah unbegreiflich ist, weil dort geschossen und getötet wurde, dann verschlägt es hart die Sprache, denn auf beiden Seiten stehn und liegen sie, die Menschen, als ob sie noch was sagen wollten. Was an die Grenze kommt, in Worte ist es nicht zu fassen, dann stehst du hinter mir und sagst, ich solle mich nicht fürchten, weil es anders kommen wird, als ich es denk und schreibe.
Wenn es so ist, dass das Gute kommt, dann muss doch das andere erst gehn. Was sonst soll es mit der Grenze, wo sie auf beiden Seiten standen im guten Glauben und der wenig Habe und sich körnig dann versanden, wo sie in Lagen sich verschichten, in die die Zeit sie dann vergräbt mitsamt dem Schmerz und der Geschichte, die gefüllt von Hoffnung und Versuchen ist bis zu den tiefsten Schichten, es besser zu machen und besser leben zu wollen, was sie nicht schafften, weil ihnen der Atem vorher verwehte. Verstumpft sind die guten Ansätze, die letzten Stümpfe noch zu sehn, der Wind wird auch sie verdecken noch bevor der zweite Tag beginnt.
Das ist Ostern an der Grenze, wo es kein Wiedersehen gibt und der Abschied lautlos endet. Mach du den Anfang neu, und lass ihn nicht stehn und dann versanden, solange der Mensch sich noch bemüht. Füll ihm neues Leben ein, füll ihm Freude ins Gefäß des Schmerzes, in den er bis zum Hals versank. Mach aus dem Kreuz das neue Leben, stell es wie die Rose hoch ins Fenster, dass der Wind das neue Leben nicht verknickt und die Wüste das Leben nicht verschichtet und verschluckt.
Der Kugelschreiber wollte es nicht fertig schreiben, so nahm er für die letzten drei Zeilen den Bleistift. Dr. Ferdinand hatte sich vorgenommen, den Gottesdienst zum Osterfest in einer schwarzen Gemeinde zu erleben. Er wollte wissen, wie sie, die lutherisch-evangelisch waren, dieses hohe Fest feierten. Er hatte sich ein weißes Hemd mit langen Ärmeln und eine dunkle Hose angezogen, setzte sich ins Auto und passierte die Schranke am Dorfausgang nach der üblichen Kontrolle. Er fuhr geradeaus bis zur Teerstraße und ließ das eingezäunte Gelände des Hospitals links liegen. Auf der Teerstraße drehte er nach rechts, überquerte das nur wenig Wasser führende Flussbett des Cuvelai auf der wieder aufgebauten Brücke, die vor über einem Jahr in die Luft gesprengt und nun von einem Soldaten mit geschultertem Gewehr bewacht wurde, bog nach zwei Kilometern links ab und erreichte einen kurvenreichen, schmalen Sandweg. Der Weg führte an großen alten Bäumen und gemauerten, kleinen Häusern vorbei, die einst von den finnischen Missionaren bewohnt wurden, von deren Wänden der Putz fiel, weil seit ewigen Zeiten an ihnen nichts mehr getan wurde. Er erreichte die fast einhundert Jahre alte finnische Holzkirche mit dem kurzen, verbalkten Glockenstuhl über dem Eingang, die von großen, alten Bäumen umgeben war. Vor dem Eingang hatten sich die Menschen mit ihren Kindern eingefunden und sprachen miteinander. Sie waren festlich und bunt gekleidet und hielten die Kinder an einer und das Gesangbuch in der anderen Hand. Frieden lag auf den von Sorgen gefalteten Gesichtern, und sie grüßten freundlich das weiße Gesicht, das wiederum einige der schwarzen Gesichter erkannte, die zuvor im Untersuchungsraum 4 vor ihm gesessen hatten. Sie sprachen miteinander in der ihnen vertrauten Sprache, wobei das Afrikaans der Buren nur dann zu hören war, wenn einige Männer und Frauen es gebrauchten, um Dr. Ferdinand ein gesegnetes Ostern zu wünschen. Ihre Augen waren offen, wenn sie ihm ins Gesicht sahen, weil sie wussten, dass er ein Deutscher aus Deutschland war, der mit dem Rassenzirkus nichts zu tun hatte. Er dankte für die freundliche Begrüßung und trat dann wieder zurück, um die Menschen, die viel zu denken und sich viel zu sagen hatten, in ihren Gesprächen nicht zu stören. Die kleine Glocke über dem Eingang läutete und lud die Gemeinde zum Gottesdienst ein, und ihre sanften Schläge verfingen sich in den Baumkronen. Die Menschen betraten den Kirchenraum gefasst und erwartungsvoll, die Jüngeren ließen den Älteren den Vortritt, welche die vorderen Bänke einnahmen. Der nicht mehr junge Pastor im schwarzen Talar mit der weißen Halskrause stand vor dem matt lackierten, braunen Holzkreuz und begrüßte die eintretende Gemeinde durch freundliches Zunicken in die ihm vertrauten Gesichter. Dr. Ferdinand kannte er nicht, dennoch schenkte er ihm einen lächelnden Willkommensgruß, weil es die Botschaft so wollte. Er setzte sich auf die letzte Bank zwischen die jüngeren Männer und Frauen mit ihren Kindern, während der Pastor sich links vom Kreuz und hinter das Pult zurücksetzte, um den Menschen die Zeit zur Besinnung und den Blick aufs ganze Kreuz zu geben, auf das sich das Christentum zentrierte. Die Menschen sahen aufs Erhöhte, aus dessen unerhörter Schlichtheit sie das Wort der Güte und Gnade bereits zu hören glaubten. Sie sahen auf ihre Knie und fügten dem Hoch- und Ausgestreckten das gliedmäßig Gekrümmte hinzu, das im Leben dazukam. Im Sitzen nannte der Pastor das erste Lied, und sie sangen es aus dem Herzen, ohne den Text im Gesangbuch lesen zu müssen. Im Singen waren sie sich einig, und sie liebten es und sangen das Lied durch alle Strophen, wobei sich Dr. Ferdinand an Melodie und deutschen Text der ersten Strophe erinnerte. Er spürte, dass sich da in den Herzen viel bewegte, und bekam ein Gefühl der Geborgenheit. Es wurde in Oshivambo gebetet, was die Länge nahm, während der Sprachunkundige die Tiefe empfand, dem beim Amen ein Prickeln über die Haut lief. Das zweite Lied folgte mit nicht weniger vielen Strophen. Die Gemeinde war ihm ebenso gewachsen und sang es mit der Wärme der Herzen, ohne den Text im Buch zu lesen. Der Pastor hatte sich von seinem Stuhl erhoben und machte seine ersten Ankündigungen, und er machte es kurz. Dr. Ferdinand verstand es nicht und musste sich sein Eigenes vorstellen. Ihm ging es auch nicht um das Verstehen der Worte, ihm ging es um das Aufnehmen der Atmosphäre, um das, was sich in den Herzen bewegte an diesem Ostersonntag, und das konnte er spüren. Die Gemeinde war ein Körper, dessen Glieder zusammengehörten, und er verfolgte von der letzten Bank das Heben und Senken der Köpfe der vor ihm Sitzenden, in die die Andacht gefahren war. Der Pastor stellte sich hinters Pult und verlas den Text zur Predigt. Weil er dabei den Namen Lukas erwähnte, dachte Dr. Ferdinand an seine Erzählung von der Auferstehung und an das Wort „Märchen“, das er den Aposteln in den Mund legte, weil sie diese Geschichte märchenhaft fanden, als ihnen Maria Magdalena und die anderen Frauen vom großen Ereignis berichteten. Der Pastor hob bei seiner Predigt einige Male die Hände und wies unter das Holzdach der alten Missionskirche, womit er den Himmel meinte, wohin der Sohn, dem die Menschen die Dornenkrone eingedrückt und ihn mit einem spärlichen Lendentuch schamlos ans Kreuz genagelt hatten, sich wendete, um den Vater zu rufen, weil er es nicht mehr ertragen konnte und seinen Geist aufgab, den der Vater in seine Hände nehmen sollte und ihn darauf sterben und wieder auferstehen ließ. Der Gottessohn in Menschengestalt, der geliebt war und durch die Liebe des Vaters unsterblich wurde, es war die große Geschichte, die bis heute mit dem Verstand nicht zu verstehen ist. Was die Menschheit aus dieser Geschichte machte, das war etwas anderes. Es blieb kümmerlich, weil ihr der Glaube zur Größe fehlte, und sie sich andere Dinge menschlich eingebildet hatte. Der Mensch hatte sich vertan, wenn er glaubte, die Dinge des Lebens im Griff zu haben. Er hatte sich in seinem Gedankennetz verfangen, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Deshalb spricht er bis heute vom Schicksal, weil er vom Glauben nicht sprechen will. Dr. Ferdinand bekam es atmosphärisch mit und begab sich gedanklich in die Köpfe der vor ihm sitzenden Männer und Frauen, um der Frage nachzugehen, ob sie nicht den Vater im Himmel darum bitteten, seine unbegreiflich starke Liebe auch jenen zukommen zu lassen, die den Tod durch Gewalt und Minen fanden. Bei manchen hatte er den Eindruck, dass sie es taten, das waren meist die jüngeren Frauen mit den kleinen Kindern, die den Mann und Vater vermissten, weil sie dabei auch ans Brot dachten. Die Älteren bangten und beteten um ihre Söhne und Töchter, von denen das Lebenszeichen seit Langem fehlte oder die der Wind bereits zugedeckt und die Wüste verschichtet und verschluckt hatte, wie es Dr. Ferdinand in seinem Grenzgedicht zu Ostern nannte. Das Vaterunser wurde gebetet, und die Menschen standen und waren versunken. Sie gaben dem Herzen das Wort, weil sie dem Verstand wenig trauten. Sie sprachen aus der Tiefe des Gemüts, um aus der Geschichte und dem gepredigten Wort die Auferstehung zu erleben, die ihnen die Kraft und Hoffnung gab, die sie zum Leben brauchten. Das Schlusslied war „Eine feste Burg ist unser Gott“, das Verteidigungslied des Reformators, weil er fest daran glaubte, dass Menschen in böser Absicht diese Burg nicht stürmen konnten, was da auch kommen mochte, und die Gemeinde stimmte dem Reformator mit kräftiger Stimme zu, der vom pretorianischen Apartheidsystem nichts wusste und wahrscheinlich einen Schwarzen auch nie gesehen hatte. Der Pastor sprach das Schlussgebet und fügte der Muttersprache einige Sätze in Afrikaans ein, was er offensichtlich für den Fremden mit dem weißen Gesicht tat, um ihm auch im Wort verständlich zu machen, dass Ostern das Fest der Auferstehung war, an die sich die Menschen im Glauben besonders in einer Zeit klammerten, in der der Krieg so viele Männer, Frauen und Kinder in den Tod zog, die schuldlos am Unrecht und wehrlos in der Verteidigung waren. „God die Vader, hou jou hande op ons mense, dat ons nie sal sterf nie onder daardie vreeslike omstandighede wat die oorlog elke dag vir ons skep; beskerm ons weerlose manne, vroue en kinders en ge vir ons die vrede; amen.“ (Gottvater, halte deine Hände über uns Menschen, dass wir nicht sterben unter den fürchterlichen Bedingungen, die uns der Krieg jeden Tag beschert, beschirme unsere wehrlosen Männer, Frauen und Kinder, und gib uns den Frieden. Amen.) Der Gottesdienst, der fast drei Stunden dauerte, nahm mit einem Danklied sein Ende. Die Menschen traten heraus und stellten sich in Grüppchen zusammen, um miteinander noch die Dinge des Lebens zu besprechen. Dr. Ferdinand stellte sich abseits in den Schatten eines Baumes und betrachtete die Menschen aus einem Abstand, der so groß nicht war, und er sah, dass sie Hoffnung geschöpft hatten, denn nun konnten sie auch wieder ein Lächeln aufs Gesicht setzen. Der Pastor trat mit schwarzem Talar und weißer Halskrause als Letzter vor die Tür und wurde von jenen ins Gespräch einbezogen, die der Kirchentür am nächsten standen. Sie führten ausgiebige Gespräche, wobei die jüngeren mehr sprachen als die alten Menschen, und die Frauen mehr als die Männer. Diese Gespräche nach dem Gottesdienst, bei denen mit der Zeit nicht gegeizt wurde, mussten eine besondere Bedeutung haben. Das fiel Dr. Ferdinand auf, der es als eine soziale Einrichtung erkannte, die dem Zusammenhalt durch gegenseitige Verkettung diente, die für diese Menschen in der schweren Zeit notwendiger denn je war. Er ging zum Auto, öffnete die Tür, stieg ein und steckte den Zündschlüssel ins Schloss, als er sah, dass der Pastor auf ihn zukam. Er zog den Zündschlüssel wieder heraus, verließ das Auto und man begrüßte sich durch Handschlag und stellte sich vor. „Ag, u is die duitse dokter in die hospitaal“, sagte der Pastor und freute sich, ihn persönlich kennen zu lernen. Er fragte, ob der Gottesdienst denn für ihn etwas gebracht hatte, weil er richtig annahm, dass der Deutsche die Sprache der Menschen hier noch nicht sprechen konnte. Dr. Ferdinand erklärte, dass es ihm an diesem Feiertag darum ging, die Atmosphäre des Gottesdienstes in der alten finnischen Missionskirche zu erleben, die er auch in beeindruckender Weise gespürt habe. Der Pastor lächelte und sprach über den engen Zusammenhalt in der Gemeinde, für die der Gottesdienst eine innere Stärkung in einer Zeit der äußeren Unsicherheit sei, in der fast jede Familie einen Angehörigen durch den Krieg verloren hatte. Es waren meist Männer, die eine Familie hatten, wo nun die Frauen und Mütter vor dem Problem standen, sich und ihre Kinder zu ernähren, weil alle arm waren und das bisschen Land um ihre Krale mit den zwei oder drei Ziegen sie nicht ernähren konnte. Dr. Ferdinand ging es zu Herzen, als eine alte Frau auf ihn zukam, die von der Tochter geführt wurde. Die alte Frau gab ihm die Hand, knickte dabei leicht mit den Knien ein und bedankte sich in ihrer Sprache für die gute Arbeit an ihrem rechten Handgelenk, das sie seiner Betrachtung freigab, wobei er sich die leichte Verformung des Gelenks vorhalten musste. Der Pastor strahlte über diese Art der Kommunikation und meinte, dass er auch von anderen Menschen viele gute Worte über seine Arbeit gehört habe. Dr. Ferdinand dankte der alten Frau für die freundliche Geste und wünschte ihr und der Tochter ein gesegnetes Osterfest. Der Pastor verabschiedete sich ebenfalls, weil er noch einige Besuche zu tätigen hatte. So stieg Dr. Ferdinand in seinen Käfer, grüßte die vorbeigehenden Menschen und schwamm mit dem Auto zwischen den Sandbänken und eingefahrenen Spuren zurück. Er fuhr an den großen alten Bäumen und den heruntergekommenen Häusern vorbei und staunte über beides, das die finnischen Missionare vor fast hundert Jahren gebaut und gepflanzt hatten.
Auf der Teerstraße bog er nun rechts ein und nahm den Weg zu seinem Dorf zurück. Er erinnerte sich beim Überfahren der wieder aufgebauten Brücke über das Flussrevier des Cuvelai an die Patienten, die durch die Explosion verletzt wurden, und besonders an den vierzehnjährigen Jungen mit der schweren Schädel-Hirn-Verletzung, bei dem verspätet und stümperhaft eine Kraniotomie durchgeführt wurde, die sein Leben nicht mehr rettete, weil der „Leutnant des Teufels“ sich beim Teetrinken im Teeraum nicht stören ließ, obwohl er durch das Glas der Trennwand den bewusstlosen Jungen die ganze Zeit vor sich liegen sah. An der Sperrschranke wies er sich aus und verfolgte die übliche Kontrolle am Auto, gegen die er nichts machen konnte. Er passierte die Schranke, fuhr zur Wohnstelle und stellte das Auto ab. Ein Zettel steckte an der Gittertür zur Veranda, auf dem Herr C. „’n geseende Paasfees“ (ein gesegnetes Osterfest) wünschte und als Absender summarisch sich, seine Frau und seine Kinder nannte. Dr. Ferdinand wusch sich die Hände, steckte die getragene Wäsche von der Woche in die Waschmaschine und stellte sie an, aß einen Apfel und trank ein Glas Mineralwasser nach, legte die dunkle Hose und das weiße Hemd mit den langen Ärmeln über die Rückenlehne eines Sessels, legte sich ins Bett und zog sich die Decke übers Gesicht, weil da zwei Mücken herumschwirrten, die er nicht in die Hand bekam. Es klopfte an der Tür, und Dr. Ferdinand hörte es die ersten Male nicht. Er zog sich die Hose über, ließ den Oberkörper frei und öffnete die Tür. Es war Dr. Witthuhn, der ihm frohe Ostern wünschte und gleich eine Sechserlage „Guinness“-Dumpies mitbrachte. Dr. Ferdinand öffnete die ersten zwei Flaschen, und sie prosteten sich zu. Dr. Witthuhn war in gedrückter Stimmung, etwas stimmte nicht mit ihm, dessen Gemüt so schnell nicht zu drücken war. „Drückt dir der Schuh?“, fragte ihn Dr. Ferdinand. „Nein, nicht mehr als sonst, ich habe gestern etwas zu viel getrunken“, antwortete er. „Das Leben allein, und dann noch hier, das ist beschissen.“ Da musste ihm Dr. Ferdinand Recht geben, denn das Alleinsein bedrückte ihn auch. Er hatte zwar einige Bücher mitgebracht und sich vorgenommen, etwas zu schreiben, aber die Eintönigkeit des Tages ging ihm schon auf den Wecker. „Mein Lieber, das ist unser Los, damit müssen wir fertig werden.“ Dr. Witthuhn meinte darauf: „Wir können doch nicht nur arbeiten, was ist das für ein Leben! Ich komme mir wie ein Esel vor, der arbeitet und zwischen der Arbeit das Essen in den Magen schlägt und schläft.“ „Vergiss die Biere nicht“, ergänzte Dr. Ferdinand. Dr. Witthuhn lachte, leerte seine Flasche und sagte: „Das ist meine Medizin.“ Er erzählte von seinen Kindern, von denen der älteste den Wehrdienst beendet hatte und der zweite Sohn, der seinen Namen trug, demnächst seinen Wehrdienst hier im Norden ableisten musste, was ihm gar nicht gefiel. Länger sprach er von seiner Tochter, von der er sagte, dass sie ein hübsches Mädchen war, das aus der Schule gute Noten brachte. „Was für eine Zukunft werden die Kinder haben?“ Er wurde nachdenklich und drückte die Hoffnung aus, dass das verrückte System bald zugrunde geht. „Wenn ich das Geld hätte, ich würde sie nach Deutschland schicken, damit sie dort ihre Ausbildung machen können. Doch ich habe es nicht.“ Dr. Ferdinand wollte es nicht so schwarz sehen, als er sagte, dass sich dieses System abgewirtschaftet habe und am Ende sei. „Sieh nur unser vergammeltes Hospital, dann weißt du, dass wir am Ende sind.“ Dr. Witthuhn wehrte ab: „Sprich nicht vom Hospital, davon haben wir, wenn wir im Dienst sind und von Montag bis Freitag genug, das reicht für den Rest der Woche.“ Dr. Ferdinand öffnete ihm die nächste Flasche und begann von seinem Ausflug zur finnischen Holzkirche zu erzählen, als jemand die Verandatür öffnete und wieder ins Schloss legte und an die Wohnzimmertür klopfte. Es war ein Mann, den beide nicht kannten, den Dr. Ferdinand zwischen dreißig und vierzig schätzte und der in einem holprigen Afrikaans fragte, ob sie Interesse an Diamanten hätten, die von hoher Qualität und besonders preiswert seien. Das Gesicht dieses Mannes sah verschlagen aus, als ob er zum Fußvolk der Diamantenmafia gehörte, die sich noch rechtzeitig die Kohlen einsacken wollte. Dr. Ferdinand ging auf so ein Geschäft von vornherein nicht ein, da ihm das nicht koscher war, er von Diamanten nichts verstand und vom schnellen Geldmachen auch nichts hielt. Dr. Witthuhn fragte den Mann mit dem verschlagenen Blick, woher die Diamanten kämen und wollte es glauben, als dieser Angola nannte, das reich an Diamanten war. Der Hehler machte sein Spiel und ging mit dem Preis noch herunter, weil er vom Reiz der Diamanten wusste und an das Geschäft mit dem ungeschliffenen Glitzerzeug glaubte. Es bedurfte einiger energischer Sätze, um den Mann vor die Tür zu bringen, was er sich nicht so leicht gefallen ließ. Es mochte ihm dann doch zu dumm vorgekommen sein, mit den Diamanten auf den Knien zu rutschen, so dass er mit einem Gesicht der Enttäuschung die Wohnstelle verließ, weil es ihm nicht einleuchten wollte, dass es Menschen gab, die mit Diamanten nichts zu tun haben wollten, selbst wenn die Preise einmalig günstig waren, wie er sagte. Dr. Witthuhn lachte und meinte, dass die Wühlmäuse bereits aktiv seien, und die Ratten die Grenze trotz der Minenfelder unterliefen und den Grenzverkehr für Diamanten vorzeitig in Gang setzten. „Das sind doch Zeichen vom bevorstehenden Ende, meinst du nicht auch?“, sagte Dr. Ferdinand. Dr. Witthuhn sah das von einer anderen Seite: „Das sind doch Diamanten, die Jonas Savimbi seinen Freunden und Helfern in die Tasche gesteckt hat, und andere haben sich diese Glitzersteine beim Schulterschluss im Kampf um die ,totale Freiheit’ gleich mit einsacken lassen, die nun hier verscherbelt werden, um sich mit dem Diamantengeld ein gutes Leben zu machen, wenn sie nach Südafrika zurückkehren. Hier machen sie das Geschäft ohne Risiko, was sie da unten nicht so leicht können, weil sie da erwischt werden.“ Dr. Ferdinand staunte über seinen Scharfsinn und räumte ihm die gute Kenntnis der Burenmentalität ein. Weil ihm das ohne Weiteres einleuchtete, befiel ihn die böse Ahnung, dass der Mann mit dem verschlagenen Gesicht auch ein Fallensteller gewesen sein konnte, woran Dr. Ferdinand gar nicht gedacht hatte, der mit den Diamanten zu Niedrigpreisen bestimmte Personen dingfest machte, wobei dann die Abwehrmänner der militärischen Führung, denen die Zivilärzte ohnehin nicht in den Kram passten, es leicht hatten, diese Leute gleich mit einzusacken und vors Gericht zu bringen, wo ihnen die verquerten Burenrichter, die nicht unbestechlich waren, weil sie dem System des Unrechts auch noch das Recht sprachen, mit Haft- und Geldstrafen kommen konnten. „Das ist eine verfluchte Sauerei, wie die hier mit den Menschen umgehen“, stellte Dr. Ferdinand erschrocken fest, dem klar wurde, dass er einer Gefahr entronnen war, und an den „Leutnant des Teufels“ dachte, der sich nachträglich noch die Hände vor Schadenfreude gerieben hätte. „Warte nur, jetzt war es erst eine Ratte“, sagte Dr. Witthuhn, „aber wie du weißt, wenn eine Ratte da ist, dann lassen die anderen Ratten nicht lange auf sich warten. Da mache ich mir nichts vor, dass die kommen werden.“ Dr. Ferdinand öffnete die letzten Dumpies, und sie prosteten sich auf eine bessere Zukunft zu. Er hatte ihn aus dem üblichen Denken gerissen, der Mann mit den verfluchten Diamanten und der unglaublichen Verschlagenheit, die das System für jeden noch bereithielt. „Angola ist reich an Öl um Luanda und in der Kabinda-Provinz und an Diamanten im Osten entlang der Grenze zu Zaire. Damit bezahlen die Gegner das Kriegsgerät, mit Öl Dos Santos’ MPLA und mit Diamanten Savimbis UNITA. Die Südafrikaner machen da ein gutes Geschäft, den Savimbi zahlt reichlich mit seinen Diamanten, die dann billig an De Beers gelangen, der sie anhäuft und im günstigen Moment auf den Weltmarkt schmeißt und riesige Profite macht.“ Das wusste Dr. Ferdinand bis dahin nicht, dass der Stellvertreterkrieg, wo sich das kapitalistisch-imperialistische und das marxistische Weltsystem auf afrikanischem Boden gegenüberstanden, ein so einträgliches Geschäft für Südafrika war. „Wenn die in Pretoria nicht dem Rassenwahnsinn verfallen wären, dann wäre Südafrika eine der führenden Industrienationen der Welt. Das hat jedoch die weiße Querschädeligkeit durch das anachronistische Sackgassendenken in der Rassenpolitik und die historisch verankerte Wagenburgmentalität verhindert. Die Geschichte hat sie da stehen lassen, wo sie vor hundert Jahren auch schon standen, weil die burische Orthodoxie den Lauf der Welt nicht verstand.“ So weit kannte sich Dr. Witthuhn in den burischen Hirnwindungen mit den Gedankenknoten aus, dass er eine pretorianische Psychoanalyse für zwecklos hielt. Dr. Ferdinand fragte ihn, wie er die nächsten Monate hier vor der angolanischen Grenze sehe. „Das weiß ich nicht, doch wie gesagt, die Wühlmäuse sind bereits aktiv, und die Ratten untergraben die Grenze mit Kanälen, die selbst vor den Minen sicher sind, denn sie haben den Riecher für beides, das Geschäft und das Risiko. Diese Nager werden sich rasch vermehren und zur Plage werden, die die Moral bis auf den letzten Splint zernagen. Sie werden von den Decken und aus den Toiletten kommen, die Teppiche unterlaufen, sich in den Polstern der Sessel verstecken und dir in den Hintern beißen, wenn du draufsitzt, und alles auf den Kopf stellen, was bis dahin noch einigermaßen an seinem Platz war. Sie werden es russisch oder chinesisch machen, dass man sich ihrer nicht erwehren kann. Erst, wenn nichts mehr zu holen ist, dann werden sie die Ersten sein, die das sinkende Schiff verlassen, weil sie mit den dicken Bäuchen den Boden, mag er noch so beschissen sein, lieber unter den Füßen haben als das Wasser am Hals.“ Es hatte etwas Infernalisches an sich, was Dr. Witthuhn da von sich gab, doch traute ihm Dr. Ferdinand die bessere Kenntnis zu. Der Burenkenner erhob sich schwerfällig aus dem Sessel und wünschte dem Erstaunten noch einen guten Abend, der ihn zum BMW begleitete, welcher für eine Wäsche überfällig war. „Es ist alles nicht so schlimm.“ Mit dieser typischen Bemerkung, die keinen Grund hatte, verabschiedete sich Dr. Witthuhn und fuhr mit dem bläkenden Geräusch eines Lochs im durchgebrannten Auspufftopf davon.
Dr. Ferdinand machte sich eine Tasse Kaffee und rauchte eine Zigarette dazu. Es fiel ihm schwer, den Nachmittag mit dem Morgen zu verbinden und beides als den Ostersonntag in der Fremde zu begreifen. Er machte sich Notizen über das Fremdartige, als das Telefon klingelte, und Herr C. fragte, ob er seine Botschaft erhalten habe, worauf er die Osterwünsche an ihn und seine Familie erwiderte. Herr C. sprach noch stellvertretend für den Dominee, als er den Glauben erwähnte, den jetzt jeder haben müsse, um die schwere Zeit, deren Zukunft keiner absehen könne, durchzustehen. Dr. Ferdinand bejahte den Glauben als eine gute Einrichtung, die allerdings unglaubhaft würde, wenn Menschen nach der Hautfarbe getrennt werden, wo das Hautpigment über die Qualität des Lebens entscheidet. Das wollte Herr C. anlässlich seines Osteranrufs eigentlich nicht hören, und so wurde das Telefonat mit einer Wiederholung der guten Wünsche abgekürzt und beendet. Dr. Ferdinand setzte sich an seinen Gartentisch zurück und versuchte sich zu sammeln, wobei ihm das Atmosphärische des Gottesdienstes am Morgen durch das Gespräch mit Dr. Witthuhn am Nachmittag und den Diamantenzwischenfall aus den Fingern zu gleiten schien. Er stellte die Frage auf dem Papier: „Wenn Ostern für alle Menschen ist, warum dann nicht auch das Leben?“ Mehr konnte er in diesem Moment nicht schreiben, nahm das Lineal und unterstrich diesen Fragesatz, indem er nachdenklich und millimeterweise mit Hilfe des Lineals Buchstabe für Buchstabe las, um einer Klärung näher zu kommen, was ihm nicht gelingen wollte, weil er für solche Gegensätze keine Lösungsgleichung fand. Der erste Satzteil vor dem Komma hatte keine Brücke zum zweiten Satzteil hinter dem Komma, wo das „Ist“-Zeichen hingehören sollte, weil da noch nie eine Brücke war. Das unterschied den Bruch der Kommunikation von der Brücke über den Cuvelai, die da war, als sie weggesprengt wurde, und weil sie da und notwendig war, nach der Sprengung wieder aufgebaut wurde. Er zündete sich eine Zigarette an und dachte noch eine Weile nach. Er erinnerte sich an den schwarzen Pastor, der ihm vor dem Auto vom guten Zusammenhalt seiner Gemeinde berichtete und es mit der schweren Zeit begründete, in der das Leben so ungewiss geworden war, wo der Krieg viele Familienmitglieder aus dem Leben gerissen hatte. Dann platzte der Mann mit dem verschlagenen Gesicht ins Wohnzimmer, der Diamanten verscherbeln wollte, wobei ihm erst hinterher durch Dr. Witthuhn klar wurde, dass dieser Mann als Fallensteller agieren konnte. Schließlich kam der Anruf des Herrn C., der vom Glauben sprach, den man brauche, um die schwere Zeit durchzustehen. Für Dr. Ferdinand waren es drei Dinge an einem Tag, die er nicht zu einem Paket zusammenschnüren konnte und deshalb als drei getrennte Päckchen aufbewahrte. Es war ein Ostersonntag, den er so einsam noch nicht erlebt hatte, wo es vom Nachmittag an an Geist und Liebe fehlte, um das Auferstehungsfest mit dem Prinzip der Hoffnung zu verbinden. Er fühlte sich verlassen und verloren, ihn plagte das Gefühl der Nutzlosigkeit. Dabei erinnerte er sich an die Worte von Augustinus, als er am Schluss seines Werkes „De trinitate“ von sich sagte, dass er versucht habe, mit der Vernunft zu schauen, was er glaubte, und dass er dazu nicht viele, aber die notwendigen Worte brauchte, weil er nicht in seinen Gedanken, wohl aber mit seinem Munde schwieg. Er klagte die Gedanken der Menschen der Eitelkeit an, wie es andere christliche Denker auch taten. Dr. Ferdinand zog sich die Sandalen an und machte einen Spaziergang, der, wie das letzte Mal, an den Militärcamps entlangführte. Eine Kolonne von fünf „Elands“ mit den langen Rohren verließ das erste Camp, um ihre abendliche Patrouille irgendwohin zu fahren. Er ging weiter bis ans Ende des Dorfes, wo der Stacheldrahtzaun den Weg abschnitt und ein aufgestelltes Schild vor Minen warnte. Diesmal traf er keine Menschen dort, die sich die Beine vertraten, weil sie Ostern mit ihren Familien und Freunden verlebten, wobei würzige Rauchwolken vom Braten der Steaks und der „Boerewors“ aus zahlreichen Vorgärten aufstiegen und eine rege Geselligkeit zu hören war, in der das große Ereignis mit Bier und Wein begossen wurde. Diese Art der Geselligkeit konnte er sich bei den Menschen, die aus dem Herzen in der Missionskirche sangen und die Predigt mit Andacht verfolgten, nicht vorstellen. Dort mochte es auch ein Festessen geben, das sich aber gegen die zu verzehrenden Fleischmengen der Buren sicherlich kümmerlich ausnahm. Aber an Alkohol wollte Dr. Ferdinand bei diesen Menschen nicht denken, dafür war den schwarzen Menschen der Tag zu heilig, als dass sie ihn auf weiße Art betränken, wofür ihnen das Wasser gut war, das sie von weither holten. Die Vögel zwitscherten ihm aus den Bäumen zu, und dafür war er ihnen dankbar. So blieb er einige Male stehen, um sie länger singen zu hören, was ihm das Orgelkonzert zu Ostern in der Heimat ersetzte. Die Vielstimmigkeit erinnerte ihn an die Polyphonie, die ihm hier auf die natürlichste und bestimmteste Weise zugezwitschert wurde, was musikalisch stimmte und motivisch so reizvoll war, dass Claude Debussy daraus ein quicklebendiges Zwitscherstück für Klavier gemacht hätte. Die heiteren österlichen Stimmen verstummten, als er sich dem zweiten Camp mit den gegenüberliegenden Villen des Brigadiers und des weißen Sekretärs der Bantu-Administration näherte, weil es aus deren Gärten noch stärker und fleischiger herausqualmte und die Geselligkeit der Lautstärke nach schon fortgeschritten war. Aus diesem durch einen hohen, lang gezogenen Sandhügel verdeckten Camp machte sich eine Dreierkolonne dreiachsiger „Ratels“ auf den Weg dorfauswärts, um den weißen Sicherungsauftrag zu erfüllen und die lustigen Gesellschaften beim Verzehr des frisch gebratenen Fleisches mit salatigem Zubehör und dem zunehmenden Alkoholgenuss vor unerwünschten Überraschungen zu verschonen. So nahm der Sonntagabend seinen Lauf, und die Sterne leuchteten am Himmel auf, als Dr. Ferdinand seine Wohnstelle erreichte, einen Blick auf seinen Käfer warf, das Licht im Wohnzimmer anknipste, zur Küche ging, drei Scheiben vom geschmacklosen Brot schnitt, sie mit Margarine bestrich und mit einer Wurstscheibe belegte, den Teebeutel in der Kaffeetasse mit heißem Wasser übergoss und die Sachen auf den niedrigen Tisch im Wohnraum stellte. Mit dem Abendbrot wollte Dr. Ferdinand den Ostersonntag beenden und danach zu Bett gehen, um für den nächsten Tag ausgeschlafen zu sein, an dem er für den Dienst im Hospital eingeteilt war, der außer den chirurgischen und orthopädischen auch jene Notfälle aus der Gynäkologie und Geburtshilfe, im Wesentlichen Kaiserschnitte, erfasste, da diese Abteilung ärztlich total unterbesetzt war. Nach dem Essen schrieb er noch die zweite Zeile: „Das Leben wird friedlicher, wenn alle etwas zu essen haben. Der Frieden liegt im Teilen.“ Als Dr. Ferdinand diese Zeile schrieb und wie die erste mit dem Lineal unterstrich, hörte er im Geiste noch die Vögel zwitschern, die ihm das Osterständchen beim Abendspaziergang brachten. Er hatte ein Lächeln auf den Lippen, als er das Licht ausknipste, sich ins Bett legte und die Bettdecke bis unters Kinn zog. Er war müde und schlief sofort ein.
Die Hähne ließ Dr. Ferdinand an diesem Morgen öfter krähen, weil es ein Ostermontag war, so dass er sich im Bett die Lorentz-Transformationen für die Zeit und die Raumkoordinaten für die Übergänge von einem Inertialsystem zum anderen durch den Kopf gehen ließ, die für das Verständnis von Einsteins spezieller Relativitätstheorie bedeutsam sind, weil sie die physikalische Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme (in Ruhe) aufzeigt. Die Inertialräume mit den zugehörigen Zeiten haben hypothetisch vierdimensionale Koordinaten, die durch die Lorentz-Transformation miteinander verbunden sind. Im Raum der allgemeinen Relativität kommen dann unterschiedliche Bezugssysteme zur Wirkung, wo die Konstanz des Weltalls die Eigenschaften von Masse, magnetischen Spannungsfeldern und Licht unter ständiger Veränderung ihrer Wirkungsbezüge einschließt, wo die Zeit sich gegen die Zeitlosigkeit streckt, die rasante Expansion des Universums die Raumgrenze nicht erreicht, wo enorme Evolutionen und Involutionen makro- und mikrokosmisch stattfinden und dabei das Äquilibrium der kosmischen Waage einhalten. Es war gegen acht Uhr, als er sich auf den Weg zum Hospital machte. Die Wachhabenden an der Schranke des Dorfausgangs waren so gut gelaunt, dass sie das „Permit“ an diesem Morgen gar nicht sehen wollten, weil sie sich untereinander viel zu sagen hatten und dabei noch spaßten. Sie fragten Dr. Ferdinand im Vorbeigehen nur, ob er seine „Paaseiers“ (Ostereier) auch verzehrt hätte, worauf er etwas nachdenklich wurde, an das Ostereiersuchen seiner Kinder dachte, und sagte, dass das Ostern diesmal ohne Eier war. Am Einfahrtstor begrüßte er den Pförtner, der auf dem Stuhl saß und dabei war, ein gekochtes Ei aus der Schale zu pulen, wobei er die Schalenstücke auf den Boden warf und mit dem Schuh in den Sand rieb. Er ging über den Vorplatz, auf dem die Menschen sich in einer kürzeren Schlange vor der Rezeption aufgestellt hatten. Einige wenige lagen noch in Decken eingehüllt und hatten ihre Kinder dabei. An den Uringeruch des Vorplatzes hatte er sich gewöhnt, als er den Eingang zur „Intensiv“-Station betrat, wo ihm eine Schwester fast in die Arme fiel, die ihn mit dem Pförtner reden sah und ihm entgegeneilte, weil da ein Patient war, der nicht mehr atmen wollte. Sie eilten in den ersten Raum. Dr. Ferdinand setzte das Stethoskop auf die Brust, doch das Herz schlug nicht mehr, und es wollte auch nicht wieder schlagen, als sie sich mit den Maßnahmen zur Wiederbelebung abmühten. Die Pupillen blieben weit, die rechte weiter als die linke, so dass nur noch der Tod festzustellen war, dessen Zeitpunkt auf das Ende der erfolglosen Wiederbelebungsversuche festgelegt wurde. Der Patient trug einen Kopfverband, unter dem eine genähte Hautwunde war, die vom Hinterkopf zur linken Schläfe reichte. Die Aufzeichnung im Krankenblatt wies auf ein Schädel-Hirn-Trauma hin, das der junge Patient in einer Schlägerei erlitt, welcher bei der Aufnahme jedoch noch so klar bei Bewusstsein war, dass er nur über starke Kopfschmerzen klagte. Das Röntgenbild des Schädels war von schlechter Qualität, es zeigte eine Fraktur über dem linken Schläfenbein.
Die Schwester der Frühschicht konnte auf Befragen nicht sicher angeben, seit wann sich der Zustand verschlechtert hatte, weil die Station über Nacht voll belegt und mit zwei Schwestern unterbesetzt war, weil die dritte Schwester aus Krankheitsgründen nicht zum Dienst erschien. Dr. Ferdinand sah den Engpass ein, meinte aber, dass einer der fünf Räume dem neuen Kollegen aus Südafrika vorbehalten war, in dem seine Privatpatienten lagen, die einer intensiven Überwachung nicht bedurften. Die Schwestern sahen es ein, ohne deshalb nach Worten zu suchen, die den Verlauf des verstorbenen Patienten erhellten. Seit dem Erscheinen des weißen Kollegen, der bei seiner ersten Vorstellung von der Augenheilkunde sprach, die er hier betreiben wollte, hatte sich in dieser Station einiges verändert. So führte er im letzten Raum, der schon zu einem Entbindungsraum mit der Möglichkeit zur kleinen Wundversorgung hergerichtet war, Geburten bei weißen Frauen durch, die er sich privat bezahlen ließ. Nach dem Prinzip der gesonderten Zahlung unternahm er auch Wundversorgungen und Fraktureinrichtungen mit Gipsen an schwarzen Patienten, die vom „Workman’s Compensation Act, 1941", der berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung vergleichbar, gut und zuverlässig vergütet wurden. Da wagte sich dieser „Ophthalmologe“ schon an die Sehnennaht der Hand heran. Eingriffe der besonderen Häufigkeit waren bei ihm Warzenentfernungen und Hautausschneidungen von Bezirken, die dieser Doktor fast stets für tumorverdächtig erklärte. Mit dieser Erklärung, die eine psychologische Tiefenwirkung erzielte, verdiente er sich an der einfachsten Chirurgie dumm und dämlich. Sein Patientenkreis erweiterte sich beträchtlich. Diese Art der Hautbehandlung ließ er ausschließlich seinen Privatpatienten zukommen, die es ihm „cash“ bezahlten, um unnötigen Steuerbelastungen von vornherein aus dem Wege zu gehen, was wiederum allgemeine Praxis war. Er sammelte die gut betuchten Patienten bei der permanenten Sprechstunde im kleinen Raum der ersten Untersuchung ein, der dem Seiteneingang zur „Intensiv“- und nun auch Privatstation direkt in fünf Meter Entfernung gegenüberlag. Diesen strategisch günstigen Raum hatte der Kollege mit den abstehenden Ohren gleich für sich und seine Aktivitäten voll in Beschlag genommen, wobei er sich vom Krankenhausablauf mit seinen vielen mittellosen Patienten nicht stören ließ. Seine Vorstellung vom Geldmachen ging auf, und keiner störte ihn dabei, denn es gab außer Dr. Witthuhn, der das Nebenbei nur im kleinen Maßstab in seinem Wohnhaus nach Dienstschluss betrieb und sich dabei auf die innere Medizin beschränkte, keine Konkurrenz, die er hätte fürchten müssen, da den anderen Doktoren die Behandlung von Privatpatienten vom ärztlichen Direktor und dem Superintendenten untersagt war. Dieser weiße Kollege mit dem blassen Gesicht, der stets eine weiße, dünne Leinenjacke mit gefüllten Taschen trug, wie sie Friseure mit weniger gefüllten Taschen tragen, hatte seine Pfründe rasch gefunden, und er baute sie mit klarem Ziel vor Augen zum Monopol aus. Am Nacht- und Wochenenddienst für die allgemeinen Patienten, die das Geld nicht hatten, beteiligte er sich von vornherein nicht. Das lag nicht in seinem Sinn. Die Arbeit ohne zusätzlichen Verdienst überließ der lächelnde Schlawiner von seinem ersten Tage an den anderen Kollegen, denen er es neidlos zumutete, für die Patienten mit den leeren Händen zu jeder Tages- und Nachtzeit herausgerufen zu werden, während er sich und seiner Frau, um ein Kind brauchten sie sich nicht zu sorgen, einen gemütlichen Abend und ein geruhsames Wochenende gönnte. Zu zweit bewohnten sie eine unverhältnismäßig große Villa gegenüber vom Hospital mit einem großen Garten und einigen Bäumen, in den er einen großen Swimmingpool setzen ließ, um die Freizeit bei der großen Hitze in angenehmer Weise zu nutzen. Der üppige Verdienst brachte bald ein neues Auto, einen Honda „Ballade“, denn was sonst sollte er hier bei freiem Wohnen, dem freien Strom- und Wasserverbrauch mit all dem Geld unweit der angolanischen Grenze machen, wobei er zusätzlich und regelmäßig das monatliche Gehalt eines „Senior medical officers“ bezog. Andererseits war Dr. Johan (mit einem „n“) immer freundlich, und das um so mehr, wenn er Dr. Ferdinand um einen chirurgischen Rat fragte oder ihn um eine chirurgische Gefälligkeit bat, die dieser ihm kostenlos gab und machte, weil ein Kollege dem anderen eine solche Bitte nicht ausschlägt, auch wenn dem Bittenden das Geld im Nacken saß. Dr. Ferdinand hatte es bald erkannt, dass dieser Kollege gewitzt war, die Augenheilkunde wie eine Tarnkappe vorschob, um die dringende Notwendigkeit seiner Tätigkeit zu begründen und dafür den Lohnstreifen für alle Fälle zu bekommen. Es offenbarte sich bald, dass es diesem Schlawiner um mehr als die Augenheilkunde ging, er wollte hier im Durcheinander des Krieges noch schnell sein gutes Geld machen, da die Zeichen der totalen Umwälzung am Horizont immer deutlicher abzulesen waren. Hier gab es keine Steuerprobleme und keine Steuerfahnder, hier war das Bruttoeinkommen auch das Netto, weil der Steuerabzug nur auf den Gehaltsstreifen zur Wirkung kam. Da keiner wusste, wie lange ein solches Steuerparadies noch dauern würde, man aber annehmen musste, dass es so lange nicht mehr dauern konnte, war dieser Kollege mit dem besonderen Sinn für Münzen und Noten vom Bienenfleiß befallen, für den es sich immer mehr lohnte, je fleißiger er wurde und die wiederkehrenden Warzen ausbrannte, läppische Hautflecken ausschnitt und die gesetzten Wunden kostspielig vernähte. Er war ein geriebener Psychologe, wenn er seinen zur „Cash“-Zahlung stets bereiten Patienten den Verdacht der Bösartigkeit vorhielt und sie dadurch in permanente Angst versetzte. Er verstand es ohne Weiteres, die erforderlichen Tiefen zu erreichen und dort ein bisschen Feuer zu machen, weil er wusste, dass es ihm auf die einfachste Weise gutes Geld brachte. Er war clever und hatte die Rechnung von Anfang an mit dem weißen Wirt gemacht. Deshalb ging seine Rechnung später voll und ganz auf, die die Privatpatienten prompt bezahlten. Es war ein gutes Geschäft, bei dem keiner mit der Wimper zuckte. Dr. Ferdinand sah mit den beiden Schwestern nach den anderen Problempatienten, die an diesem Ostermontag keine Besonderheiten aufwiesen. Er machte seine Eintragungen und wünschte den Schwestern einen ruhigen Tag. Dann ging er durch die anderen Säle, richtete im orthopädischen Männer- und Frauensaal einige Extensionen, wechselte Verbände und entfernte bei dem einen und anderen Patienten einige Hautnähte. Er fragte die Schwestern nach der nächtlichen Ruhestörung durch die Koevoet, die es gelassen nahmen und meinten, dass sich auch die Patienten daran gewöhnt hätten, die es mit Verachtung hinnahmen und kein gutes Wort an ihnen ließen. Einige sprachen es schon jetzt aus, dass diese rücksichtslosen Burschen in ihren Familien nichts mehr zu suchen hätten, wenn das System erst einmal den Bach runtergegangen sei. Einige Eltern konnten es nicht begreifen, dass aus ihren Söhnen derartig rüde Burschen geworden waren, die keinen Respekt mehr vor den Menschen hatten. Dr. Ferdinand ging zum Kindersaal, in dem es laut zuging, die Kinder herumrannten, wenn sie nicht ans Bett gefesselt waren, und einige kleine Häufchen im Korridor herumlagen, die später von einer Schwester beseitigt wurden, da an diesem Tag die Putzfrau nicht erschien. Die Kinder waren an sein Gesicht und seine Hände längst gewöhnt, bei ihm fürchteten sie sich nicht vor der weißen Haut. So kamen sie auf ihn zugelaufen, die größeren Kinder fassten seine Hand, die kleineren klopften ihm gegen die Hose und liefen ihm nach. Sie riefen ihn „Tate“ (Vater) oder „Dokter“ und machten sich einen Spaß daraus. Er genoss die ausgelassene Freude der Kinder, die für ihn von jeher die liebsten Patienten waren. Der Kindersaal war eine Welt für sich, weil das Leiden des Kindes so viel mächtiger war als beim Erwachsenen. Es gab für Dr. Ferdinand nichts Ergreifenderes, als ein Kind leiden zu sehen, nichts Erschütternderes, als ein Kind sterben zu sehen, und nichts Schöneres, als ein Kind gesund werden zu sehen. Die unbescholtene Natürlichkeit und herzliche Dankbarkeit eines Kindes waren immer wieder unvergleichliche Erlebnisse. Er verließ den Kindersaal in Richtung Teeküche, um eine Tasse Tee zu trinken und vielleicht doch noch ein Osterei zu bekommen, und wenn es nur ein gewöhnliches, hart gekochtes Ei war. Der stets freundliche Mann am Eingang der Teeküche, der zur Feier des zweiten Ostertages im fast blütenweißen Küchendress vor ihm stand, wenn man einmal von den geflickten Ärmeln über den Ellenbogen und dem über dem Knie überflickten rechten Hosenbein absah, begrüßte Dr. Ferdinand mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Sie gaben sich die Hand und wechselten einige Worte in drei Sprachen, wobei das Afrikaans in der Mitte stand. Diese Geste der Selbstverständlichkeit hatte ihre Wirkung darin, dass der Küchenmann, der den Doktor als „goeie duitse man“ titulierte, ihm nun zwei hart gekochte Eier auf den Teller legte, und dazu zwei Weißbrotscheiben und einen Löffel voll Margarine. Er stellte ihm eine volle Teekanne auf den Tisch, brachte die Kaffeetasse mit Teelöffel und eine zweite Kaffeetasse, die er mit Zucker gefüllt hatte und sang den Choral, der aus dem kleinen Radio in der Teeküche kam, in der Sprache seiner Menschen mit. Dr. Ferdinand pellte in Ostererinnerungen an seine Kinder die Schale vom ersten Ei, als Dr. Nestor die Kantine betrat und sich mit an den Tisch setzte, um eine Tasse Tee zu trinken. „Der Krieg hat die Menschen so sehr in Angst und Schrecken versetzt, dass sie jetzt mit Bluthochdruck und Kopfschmerzen kommen, die sie ohne Medikamente nicht mehr hantieren können. Es sind magere Menschen, die vorher einen Blutdruck hatten, der sich an der unteren Grenze bewegte.“ Dr. Ferdinand dachte an die übersättigten Patienten mit dem Übergewicht in Deutschland, die einen hohen Blutdruck hatten, weil Fettsucht und Stress sich nicht vertrugen. „Was machen Sie da?“, fragte er. „Ich versuche es mit Beta-Blockern, mit Propranolol und Flumethiaziden, doch einige vertragen die Medikamente nicht, klagen über Schwindelgefühl, Brechreiz, Atembeschwerden und Muskelkrämpfe. Dazu kommt, dass die Apotheke nicht genügend Medikamente hat.“ Der Krieg beeinflusste nicht nur die Chirurgie, sondern griff tief in die nervösen Zentren der Menschen ein, die es am Herzen spürten, weil sie sich der Schrecken nicht mehr erwehren konnten. Ein anderer Punkt, den Dr. Nestor erwähnte, war die erschreckende Zunahme der Tuberkulose, der die Menschen aufgrund der schlechten Ernährung und des geschwächten Immunsystems wie Fliegen erlagen. „Das haben unsere Menschen nicht verdient.“ Auch wenn es eine stehende Redewendung des schwarzen Kollegen war, so stimmte ihr Dr. Ferdinand voll zu. Da beide im selben Boot saßen, konnten beide an der Situation nichts ändern. „Wir können nur unseren kleinen Teil beitragen, um die Not zu lindern, soweit es in unseren Kräften steht. Im Übrigen hoffen wir auf das Ende dieses Unrechtssystems, und diese Hoffnung geben wir nicht auf, wobei wir uns in Geduld üben müssen, weil uns nichts anderes übrig bleibt.“ Sie waren noch im Gespräch, als gleich zwei Schwestern in die Kantine stürzten, die eine vom Kreißsaal, weil bei einer Gebärenden der fötale Arm vorgefallen war und nun in der Scheide steckte, was eine normale Entbindung unmöglich machte, und die zweite Schwester aus dem „Outpatient department“, wohin eine junge Frau aus Südangola gebracht wurde, der vor drei Tagen ein Rind das Horn in den Bauch gestoßen hatte. Dr. Ferdinand bat seinen Kollegen, die Narkose zum Kaiserschnitt zu geben und wies die Schwester vom Kreißsaal an, den OP-Raum in Kenntnis zu setzen und die Patientin unverzüglich dorthin zu bringen. Dann ging er mit der anderen Schwester zum „Outpatient department“, um die junge Frau zu untersuchen. Sie lag auf der Trage. Er hob das Tuch ab, das über den Bauch gelegt war. Das Rind hatte mit dem Horn ein großes Loch in die Bauchdecke gestoßen, aus dem zwei Dünndarmschlingen und ein Teil des großen Netzes herausgetreten waren, auf denen der angolanische Sand noch lag, der vom Fettgewebe des großen Netzes nicht abzuwischen war. Ein Wunder, dass es diese Frau bis hierher lebend schaffte, dachte Dr. Ferdinand, als er sich die dreitägige Reise auf der Eselskarre, die von der Grenze über das östliche Kaokoland führte, von der Schwester, die der portugiesischen Sprache teilweise mächtig war, übersetzen ließ. Da die Patientin erheblich an Blut verloren hatte, wurde eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutfarbstoffs, der Elektrolyte und zur Kreuztestung für die erforderlichen Konserven ins Labor geschickt. Eine Laparotomie war dringend angezeigt, so dass Dr. Ferdinand die Schwestern beauftragte, die Vorbereitungen zur Operation unmittelbar zu treffen und die Patientin zum OP-Raum zu bringen, während er sich schon auf den Weg dorthin machte, um den Notfall-Kaiserschnitt durchzuführen. Die verhinderte Mutter lag bereits auf dem OP-Tisch, und die Schwester hatte die braune Desinfektionslösung auf der Bauchdecke verrieben, als Dr. Ferdinand in den OP-Raum trat, um mit seiner Anwesenheit dem Kollegen zu signalisieren, mit der Narkose zu beginnen. Die Schwester hatte die Patientin mit sterilen Tüchern abgedeckt und reichte dem Operateur das Skalpell. Er machte den quer verlaufenden Hautund Faszienschnitt, auch Pfannenstielschnitt genannt, oberhalb der Schambeinfuge, spreizte in der Mitte und längs die Bauchmuskeln, eröffnete das äußere Bauchfellblatt, löste die Harnblase vom Gebärmutterhals und schnitt ihn in Querrichtung ein. Der fötale Kopf saß tief im kleinen Becken und drückte auf den vorgefallenen Arm. Der Kopf wurde nicht ohne Mühe gelöst und vorgezogen, mit ihm der Arm, so dass die gereifte Frucht durch die mütterliche Wunde entwickelt und von der Nabelschnur, die sich um den Hals gewickelt hatte, abgetrennt wurde. Die leichte Blaufärbung des an den Fußgelenken gepackten und mit dem Kopf nach unten hängenden Föten wich dem Rosa nach zwei sanften Schlägen auf den Rücken, so dass aus ihm ein gesundes Baby wurde, und ein Osterjunge dazu, dem der Vorfall den Arm nicht gebrochen hatte. Alle freuten sich über den Erfolg der Rettungsmaßnahmen und den gesunden Neuankömmling gleichermaßen, dem sie eine bessere Zukunft wünschten. Die Plazenta wurde durch Zug an der Nabelschnur herausgeholt und auf ihre Vollständigkeit geprüft, die Wundfläche der Uterushöhle mit einer großen Kompresse gesäubert. Nachdem die Wunde am Gebärmutterhals vernäht, die Harnblase über die Nahtreihe gelegt und mit drei Nähten am Uterus gehalten wurde, informierte Dr. Ferdinand das Team, während er die Bauchdecke verschloss, von der jungen Frau aus Angola, die als Nächste operiert werden musste. Die Nachricht wurde gelassen aufgenommen, weil ein Teamgeist der Hilfe herrschte, dem der Ostermontag keinen Abbruch tat. Die Mutter schlief nach der schweren, chirurgisch unterstützten Geburt die Narkose aus und wurde in den Aufwachraum gefahren. Eine andere Schwester brachte die steril verpackten Instrumentensiebe für die Laparotomie zum „theatre 3“. Die beiden Doktoren setzten sich zu einer kleinen Pause in den Teeraum und tranken eine Tasse Tee. Dabei erklärte Dr. Nestor den weiten Weg von der angolanischen Grenze durchs Kaokoland bis nach Oshakati, auf dem zahlreiche Straßensperren zu umfahren waren, was den Weg noch weiter machte. Beide drückten ihre Hochachtung vor dem starken Lebenswillen dieser Menschen aus, sich einer solchen mehrtägigen Reisestrapaze zu unterziehen und staunten insbesondere über die Courage des Vaters, der die Tochter auf der Eselskarre aus einer Entfernung brachte, die Dr. Nestor auf zweihundertfünfzig bis dreihundert Kilometer schätzte. Zwei Schwestern fuhren die Trage mit der Patientin in den OP-Raum, so dass die beiden die Tassen auf dem Tisch stehen ließen, den Schwestern folgten und gemeinsam die Patientin auf den OP-Tisch herüberhoben. Dr. Nestor schob den Atemtubus in die Luftröhre ein und schloss das Narkosegerät an, als Dr. Ferdinand mit OP-Kittel und übergestreiften Handschuhen an den Tisch trat und mit einer sterile Kompresse die ausgestülpten Darmschlingen und das Netz umfasste, damit die OP-Schwester die Bauchdecke mit der braunen Lösung überstreichen konnte. Dann wurden von beiden Seiten große Kompressen dem vorgelagerten Eingeweide unterlegt, um den Sandbelag mit kochsalzgetränkten Kompressen zu entfernen, was aufgrund der Dauer des Vorfalls nur teilweise gelang. Über einen mittleren Längsschnitt wurde die Bauchhöhle eröffnet und revidiert. Da fanden sich noch einige Blutergüsse am Gekröse, weitere Darmverletzungen lagen nicht vor. Erstaunlich war, dass die seit drei Tagen ausgestülpten, bläulich verfärbten Darmschlingen beim Beklopfen mit dem Finger flachwellig peristaltisch reagierten, also noch lebten, weil das Rind mit dem Horn das Loch in der Bauchdecke groß genug gemacht hatte, dass die arterielle Blutzufuhr nicht und der venöse Rückfluss nur leicht gedrosselt wurde. Auch nahmen die Darmschlingen nach Eröffnung der Bauchhöhle eine hellere Farbe an, weil nun die venöse Drosselung beseitigt war. Damit erübrigte sich die Frage einer Darmresektion, und Dr. Ferdinand bemühte sich erneut, mit feuchten Kompressen den Sand von den Schlingen und dem Netz zu bekommen, was bei den Schlingen schließlich weitgehend gelang, am Netz dagegen nicht mehr möglich war. Bei der dritten Inspektion, die keine neuen Erkenntnisse brachte, wurde die Bauchhöhle mit Kochsalzlösung gespült, die Flüssigkeit nach mehrmaligem Hin- und Herschieben des gesamten Dünndarms abgesaugt und der Bauchraum mit einer Kompresse getrocknet. Beim Bauchdeckenverschluss stellte das vom Horn eingetriebene Loch ein örtliches Problem dar, das flachbogig ausgeschnitten wurde, so dass die drei Schichten aus äußerem Bauchfellblatt, innerem und äußerem Muskelblatt und Haut durch eine spezielle Nahttechnik sicher verschlossen wurden. Beim Aufkleben des Wundverbandes dankte Dr. Ferdinand allen für die gute Zusammenarbeit, was die Schwestern und Dr. Nestor freundlich erwiderten. Es herrschte eben ein guter Geist im OP-Raum, bei allem Ungeist draußen außerhalb des Hospitals. Das stimmte Dr. Ferdinand zufrieden, er empfand Dankbarkeit für die menschliche Atmosphäre, in der hier gearbeitet worden war, die allen zugute kam und den Patienten am besten half. Er hatte sich umgezogen und wartete im Teeraum auf Dr. Nestor, der durchgeschwitzt, aber nicht weniger zufrieden war und beim Umkleiden gute Worte für die Art der Zusammenarbeit fand, die er leider als eine Ausnahme bezeichnete, weil die jungen Kollegen in Uniform es zu oft am nötigen Respekt vor den Menschen der schwarzen Hautfarbe fehlen ließen. Die Schwestern hätten oft über deren Arroganz und Unhöflichkeit bei ihm geklagt. Sie waren sich darin einig, dass der Weggang des Dr. Hutman eine atmosphärische Verbesserung brachte, weil der sich durch sein ungezogenes Benehmen bei allen Schwestern unbeliebt gemacht hatte. „Der Arzt in Uniform, das geht eben nicht zusammen, weil es Misstrauen bei den Menschen schürt“, meinte Dr. Nestor. Das verstand Dr. Ferdinand nur zu gut, weil er bei solchen „Ärzten“ an Dr. Mengele und Konsorten in ihren geschniegelten SS-Uniformen dachte, die den Teufel an tausenden hilfloser Männer und Frauen, Greisen und Kindern ausließen.
Im „theatre“, wo die beiden Doktoren die Gedanken zur Zeit offen austauschten und das Wort „Faschismus“ von Dr. Ferdinand in das Ostermontagsgespräch mit der ergänzenden Bemerkung eingebracht wurde, dass er so ein aufgesetztes, rücksichtsloses und menschenverachtendes System das zweite Mal, nun in burischer Version erlebe, waren sich beide darin einig, dass sich in der Geschichte der Menschen ein Unrechtssystem noch nie auf Dauer hatte halten können, weil es im Kern verrotte und die schmarotzende Frucht von innen heraus verfaule. Ein Zeitplan, wann die Fäule total war und so ein Gewächs im eigenen Moder erstickt, ließ sich nur schätzen, denn immer neue Ableger der parasitären Absicht überzogen den verwüsteten Boden, wenn auch mit schwindender Kraft, weil es zum Ranken immer weniger reichte, aber noch zum Kriechen. Sie wünschten sich einen ruhigen Tag, und Dr. Ferdinand trug dem Kollegen Grüße an seine Familie auf. Er ging noch einmal zum Entbindungssaal, um sicher zu gehen, dass die jungen Frauen auf natürlichem Wege waren, ihre Kinder zur Welt zu bringen. Dann machte er seine Runde zum „Outpatient department“, das aufgeräumt war und wo zur Zeit keine Patienten saßen, denen eine Wunde vernäht oder ein gebrochener Knochen gerichtet und eingegipst werden musste. Es war Mittagszeit, und Dr. Ferdinand ließ sich in der Kantine vom freundlichen Wärter im fast blütenweißen Küchendress das Essen an der Durchreiche auf den Teller schaufeln. Es gab einen gar gekochten Hühnerschenkel mit Reis, der mit einer scharfen Chilisauce überzogen war und die obligaten, grünschaligen Pumpkinhälften mit dem löffelweich gekochten, gelben Fruchtfleisch. Er saß allein im Speiseraum und hatte sich daran gewöhnt, dass die meisten Kollegen an Sonn- und Feiertagen das Mittagessen mit ihren Frauen in den privaten Quartieren einnahmen, wo es gemeinsam auch besser schmeckte. Der Küchenmann brachte noch eine volle Kanne frisch gebrühten Tee, aus dem acht Teebeutelfäden mit kleinen Kärtchen am Ende heraushingen, auf denen die Teemarke „rooibos“ (Rotbusch) zu lesen war, ein Tee aus Borboniablättern, der in Südafrika hergestellt und wegen seines herben Buschgeschmacks auch von den Menschen hier gern getrunken wurde. Als der freundliche Herr in der Teeküche die Töpfe, Schüsseln und Teller in den Küchenwagen zurückstellte und dabei mit den großen Schöpflöffeln und den kleineren Essbestecken mehr als gewöhnlich klapperte, um das Ende der Mittagszeit hörbar zu machen, verließ Dr. Ferdinand mit einem Gruß die Kantine und machte sich auf den Rückweg, den er durch das „Outpatient department“ nahm, um sich zu vergewissern, dass sich dort in der Zwischenzeit keine Patienten eingefunden hatten, die einer chirurgischen Versorgung bedurften. So war es auch, es saßen lediglich zwei Mütter dort, die ihre Kinder mit Fieber und Husten auf den Schößen hielten, um vom diensthabenden Kollegen der Kinderheilkunde gesehen zu werden, der die eine Mutter bereits eine Stunde und die andere zehn Minuten weniger warten ließ. Die lange Wartezeit verwunderte Dr. Ferdinand, weil er wusste, dass der schwarze Kollege den Dienst am Kinde hatte, der ein fertiger Kinderarzt nach der Spezialausbildung in Südafrika war. Es war ein Spaziergang, den er sich für den Rückweg vorgenommen hatte, ohne deshalb einen Umweg zu machen, weil er mit einem Anruf aus dem Hospital rechnen musste. So ging Dr. Ferdinand gemütlich den kürzeren Weg zwischen Stacheldraht und Lattenzaun an den hochgestelzten Blockhäusern der Kollegen in Uniform entlang, wo aus den Türritzen des vierten Blockhauses, das einst Dr. Hutman für sich allein in Beschlag genommen hatte, der würzige Duft eines leckeren Bratens bis auf den Weg drang und Dr. Ferdinand sich in die Physiologie des bedingten Reflexes (nach dem Petersburger Physiologen Iwan Petrowitsch Pawlow) vertiefte, bei dem selbst ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Die Wachhabenden an der Sperre zum Dorfeingang nahmen das vorgehaltene „Permit“ gelassen zur Kenntnis, als ständen sie mit offenen Augen bereits im Mittagsschlaf. Er setzte den Weg in Gedanken versunken fort und trat dabei einige Male so ungeschickt in tiefe Schlaglöcher, dass er sich einmal den rechten und zweimal den linken Fuß verknickte. Die Sandalen streifte er wie üblich in der Veranda ab, setzte sich in den ausgesessenen Sessel und legte die Beine auf den niedrigen Tisch, auf dem noch die nicht ausgetrunkene Tasse mit dem kalten Kaffee und die Untertasse mit den zwei ausgedrückten Zigaretten standen. Er war noch in Gedanken, wenn er auch nicht wusste, wo er mit ihnen richtig war. Er ließ sie gewähren, zündete sich eine Zigarette an und betrachtete die hochgelegten Füße, fuhr mit beiden Händen über die Innen- und Außenknöchel beider Fußgelenke, die ihm nach dem Verknicken der Füße schmerzten. Er drückte auf diese Knöchel und schloss klinisch eine Fraktur aus und eine Kapselzerrung ein, so dass er sich über eine Blauverfärbung und Schwellung über den oberen Sprunggelenken nicht wundern sollte. Er hielt es sich
vor, dass so etwas passiert, wenn man nicht alle Gedanken beisammen hat, und warf sich vor, dass das ja nicht das erste Mal war. Als würde sich im Computer twas verknoten, was trotz der hoch entwickelten Halbleitertechnik mit den zusammengesetzten Denkchips nicht zu lösen war, weil es an der rechten elektronischen Steuerung fehlte, um den Denkprozess in die richtige Richtung zu bringen und mit den Denksteinen das Gebäude am richtigen Platz zu errichten. Er legte sich der Füße wegen ins Bett, weil ihm die Fußgelenke schmerzten und er eine leichte Schwellung über dem linken Fußgelenk mit einer beginnenden Verfärbung der Haut über dem Außenknöchel zu sehen glaubte. Da er sich vor den Mücken nicht sicher fühlte, zog er die Decke bis unters Kinn, auch wenn in diesem Augenblick keine vor seiner Nase tanzte oder hörbar im Raum herumschwirrte. Dr. Ferdinand war eingeschlafen, als gegen fünf das Telefon läutete, er aus dem Bett sprang und beim Abnehmen des Hörers zunächst an einen Kaiserschnitt, dann an irgendetwas Chirurgisches, aber nicht an Dr. Lizette dachte, die ihn zum Abendessen in ihr Haus einlud. Ihre Stimme war weich, doch nicht ohne Bestimmtheit, und beides gefiel ihm an ihr. Er sagte ihr zu, mit der Bemerkung, dass er auf Dienst sei, worauf sie den Optimismus herauskehrte und sagte, dass es im Hospital schon ruhig bleiben werde, und sie sich einen schönen Abend versprach, weil auch ihr Mann sich freute und ihn kennen lernen wollte. Er bedankte sich für die Einladung, ließ sich Straße und Haus beschreiben und legte gedanklich geordnet den Hörer zurück. Das war ein freundlicher Anstoß aus einer persönlichen Richtung, und Dr. Ferdinand freute sich darüber, weil es ihn aus dem ewigen Alleinsein riss, das ihm kräftig auf die Nerven ging. Er stieg unter die Brause und fühlte sich beim Abtrocknen so frisch und motiviert, dass er sich für ein kleines Gedicht stark genug fühlte, in dem er sagen wollte, dass es sich lohnte zu leben, weil es im Leben auch schöne Dinge gab, die einen Menschen überraschten, der an vieles dachte, aber nicht an alles, der viel gewohnt war, was aber längst noch nicht alles war. Er hatte sich das Blatt auf der Pappe schon zurechtgelegt und wollte in diesem Sinne ein paar Zeilen schreiben, als das Telefon klingelte und die Schwester von einer siebzehnjährigen Kreißenden sprach, die ihr erstes Kind nicht auf natürlichem Wege zur Welt bringen konnte, weil sich der Föt nicht aus der Querlage in die gewünschte Kopflage drehen ließ. Mit der Einladung von Dr. Lizette im Hinterkopf, wobei ihr herausgekehrter Optimismus gleich ein Trugschluss war, wies er die Schwester an, Dr. Nestor, der die Narkose machen musste und die Schwestern im „theatre“ vom Notfall in Kenntnis zu setzen und die Patientin unverzüglich zum OP-Raum zu bringen, da er sich bereits auf den Weg zum Hospital machte. Er hatte das weiße Hemd mit den langen Ärmeln und die dunkle Hose, seine Sonntagskleidung also, angezogen, als er sich in den Käfer setzte und den Weg in drei Minuten zurücklegte, da die Wachhabenden an der Sperrschranke des Dorfausgangs ihn kannten und diesmal der offiziellen Anweisung zum Trotz von einer Autokontrolle absahen. Er stellte das Auto mit Beginn der Dämmerung vor den beiden Fenstern an der Schmalseite der „Intensiv“-Station ab, eilte schnurstracks zum OP-Haus, hängte die Sonntagskleidung an den Haken im Umkleideraum und stand grün gekleidet im Korridor, als die Patientin aus dem Entbindungssaal gebracht wurde, die vor Schmerzen stöhnte. Dr. Ferdinand half beim Umlegen der Patientin auf die „theatre“-Trage und dann im „theatre 1“ beim Umlegen von der Trage auf den OP-Tisch. Die Narkoseschwester traf die Vorbereitungen auf dem Narkosetisch, während die OP-Schwester sich noch die Hände wusch und sich dann in den grünen Kittel helfen ließ. Dr. Nestor eilte in den OP-Raum und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß vom Gesicht, bevor die Operation begann. Dr. Ferdinand streifte die Handschuhe über, als er mit grünem Kittel den OP-Raum betrat, und die OP-Schwester noch mit dem Verreiben der braunen Desinfektionslösung über dem stark vorgetriebenen Bauch zugange war. Er half beim Abdecken und Anklemmen der sterilen Tücher. Dr. Nestor hatte den Tubus eingeschoben und schloss ihn an das Narkosegerät an, als die Schwester Dr. Ferdinand das Skalpell in die Hand gab, der unverzüglich mit dem Querschnitt oberhalb der Schambeinfuge begann. Es dauerte etwa acht Minuten, bis ein kräftiger Junge aus der eingeschnittenen Gebärmutter entwickelt und von der Nabelschnur abgetrennt wurde. Dieser „Kerl“ fing gleich mächtig an zu schreien, so dass ihm die erweckenden Rückenschläge bei herunterhängendem Kopf erspart blieben. Die Schwester nahm den kräftigen Burschen in einem aufgehaltenen, sterilen Tuch in ihre Hände, wickelte ihn ein und legte ihn auf einen Tisch, um ihm mit einem dünnen Plastikschlauch das Fruchtwasser aus Mund und Nase zu saugen, was der Neuankömmling mit einem nasalen Schreien quittierte. Sie legte ihn auf die Waage, wo es der Bursche ohne jegliche Anstrengung bereits auf dreieinhalb Kilogramm brachte. Dann ließ er sich die Haut trocken reiben und in ein frisches Tuch wickeln, ohne dagegen etwas sagen zu wollen, weil er sich nach der langen Reise erst einmal ausschlafen musste. Dr. Ferdinand hatte die Wunde am Gebärmutterhals vernäht, die Harnblase darübergelegt und mit einigen Haltenähten fixiert. Während er die Bauchdecke verschloss, meinte die OP-Schwester, weil sie sich über die Häufigkeit von Kaiserschnitten an Wochenenden und Feiertagen unterhielten, dass dieser Ostermontag auffallend ruhig verlaufen war, was nicht heißen sollte, dass die Nacht nicht noch weitere Kaiserschnitte bringen könnte. Der Verband war aufgelegt und die Narkoseschwester hatte die Trage schon neben den OP-Tisch gefahren, als Dr. Nestor den Tubus aus der Luftröhre zog und der Patientin den Sauerstoff über die Gesichtsmaske durch mehrmaliges Zusammendrücken des Atembeutels in die Lungen blies, was sie mit einer guten Spontanatmung quittierte. Alle fassten zu, um die junge Mutter auf die Trage zurückzulegen, auf der man sie in den Aufwachraum fuhr, wo ihr noch einige Male der Blutdruck gemessen und der Puls am Handgelenk gezählt wurde. Ein neuer Erdenbürger war geboren, der noch nicht wissen konnte, wie es in dieser Welt aussah, in die er gekommen war, um sein weiteres Leben dort zu verbringen. Dr. Ferdinand, der dem Team für die gute Zusammenarbeit dankte, fragte sich im durchgeschwitzten grünen Hemd, ob dieser neue Erdenbürger nicht lieber im Mutterleib verblieben wäre, wenn er geahnt hätte, was sich hier auf dem afrikanischen Kontinent unweit der angolanischen Grenze abspielte.