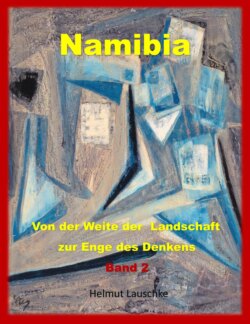Читать книгу Namibia - Von der Weite der Landschaft zur Enge des Denkens - Helmut Lauschke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Militärpsychologe
ОглавлениеEr warf die verschwitzte OP-Kleidung in den Wäschesack, erfrischte sich das Gesicht mit dem lauwarmen Wasser, das aus dem Kaltwasserhahn über dem Waschbecken im Umkleideraum kam, trocknete es mit einem frischen grünen Hemd, zog sich das sonntägliche Zivil über und ließ sich über die Telefonzentrale mit Dr. Lizette verbinden, um ihr zu sagen, dass er sich mit Verspätung auf den Weg zu ihr machte. Er ging durch das „Outpatient department“, um sich zu vergewissern, dass keine Patienten auf ihn warteten und um die Schwestern der Nachtschicht davon in Kenntnis zu setzen, dass er die nächsten Stunden bei Dr. Lizette zu finden sei. Er durchschritt den Ausgang neben der Rezeption und blickte nach links, wo die Menschen unter Decken auf dem Betonboden lagen, um die Nacht hier zu verbringen, weil es die Polizeistunde mit Eintritt der Dämmerung nicht anders wollte. Er fuhr mit dem Auto durch das Ausfahrtstor mit den geknickten Rohrpfosten und wünschte dem Nachtpförtner durch das offene Fenster eine ruhige Nacht. Die Kontrolle an der Sperrschranke des Dorfeingangs war mild, auch wenn zwei Wachhabende das Innere des Käfers nicht ohne Neugier betrachteten. Dr. Ferdinand hielt ihnen das „Permit“ so lange entgegen, bis sie sich am Käfer ausgeguckt hatten und das Papier auch nicht mehr sehen wollten, was irgendein Liebesbrief hätte sein können, weil sie sich um das Handgeschriebene mit der Unterschrift des Kommandeurs nicht scherten. Dr. Lizette hatte den Namen der Straße genannt und sie als Zufahrt zum Militärcamp bezeichnet. Da es drei große Camps im Dorf gab, die zusammen eine Brigade fassten, und nicht alle Straßen ausgeschildert waren, zumindest die Straßenschilder in der fortgeschrittenen Dämmerung nicht gleich zu finden waren, versuchte sich Dr. Ferdinand der Beschreibung entsprechend zu orientieren, indem er einige Dorfstraßen zweimal und langsam durchfuhr und schließlich an einem Haus mit Doppelgarage landete, das Dr. Lizette mit einem weißen Außenanstrich beschrieben hatte, was nur für den Tag gelten konnte, weil nachts nicht nur alle Katzen, sondern auch alle Häuser grau waren. Es war das richtige Haus, und Dr. Lizette freute sich über sein Kommen und stellte ihn ihrem Ehemann, dem Psychologen, vor. Das Auto wurde aus Sicherheitsgründen in die Einfahrt gestellt, um dem Risiko aus dem Wege zu gehen, dass es durch die breiten Militärfahrzeuge gerammt wird. Dr. Ferdinand entschuldigte sich für die Verspätung und schränkte damit den von Dr. Lizette zuvor geäußerten Optimismus ein, dass es am Nachmittag im Hospital ruhig sein werde, die es, weil sie ein gutes Gedächtnis hatte, mit einem verständnisvollen Lächeln quittierte. Beide boten ihm einen neuen und bequemen Sessel zum Platznehmen an, als der Psychologe ihm einen Cooldrink in Form eines eisgekühlten Whiskys mit Sodawasser reichte und Dr. Lizette die entsprechenden Gläser in dreifacher Ausfertigung auf den runden Klubtisch stellte. Das Ehepaar hatte die anderen bequemen Sessel eingenommen. Der Ehemann füllte die Gläser im Sitzen und mit dem Wort „gesondheid!“ tranken sie auf einen guten Abend. „Sie kommen also aus Deutschland. Was hat Sie denn hierher geführt?“, war die Eröffnungsfrage des Psychologen, der es von Anfang an wissen wollte und seine Neugier dabei verriet, die so typisch für die Menschen war, die sich mit der Seele und ihren Zuständen beschäftigen und es professionell hinter einem großen Schreibtisch in den verkürzten Dimensionen des Hör- und Sprechraumes tun, sich auf einem Blatt Papier Notizen machen, diese unterschiedlich dick unterstreichen, durch balkenförmige Quer- oder Senkrechtstriche das eine Wort vom anderen trennen, so dass dem gesprochenen Satz die ursprüngliche Aussage abgeschnitten wird, der Satzgegenstand in der Luft hängt und an irgendeine andere Satzaussage angekoppelt wird, womit schließlich auf dem Papier etwas entsteht, was der Person um so weniger gehört, je weiter die Satzbestandteile aus dem gesprochenen Kontext verzogen, herausgezogen oder voneinander abgeschnitten werden, um sie einer Analyse zugänglich zu machen. Dr. Ferdinand ließ das Wort „Scheidung“ fallen, dem er den Mantel des Traumatischen umhängte, so dass der freundlich gesinnte Psychologe es schlagartig verstand und sich mit der weiteren Befragung zurückhielt. Er hatte sich offensichtlich sein Bild über die seelischen Zustände des Deutschen gemacht, denn er sprach nun mehr mit seinen Augen als mit dem Mund. Dennoch, und weil er es als wichtig empfand, wollte ihm Dr. Ferdinand die Probleme, die er vor der angolanischen Grenze im Allgemeinen und am Hospital im Besonderen vorfand, nicht vorenthalten. Er begann mit dem Arzt in Uniform, von dem Dr. Nestor am Morgen noch sagte, dass das eben nicht zusammenging, weil es Misstrauen bei den Menschen schürte, und er selbst bei dieser Bemerkung die Teufelsärzte in den geschniegelten Uniformen hoher SS-Offiziere vor Augen hatte, die in den Vernichtungslagern der Nazis ihr sadistisches Unwesen an hilflosen Menschen ausließen. Er stellte dem Psychologen daher die Frage, was er vom Arzt in Uniform halte. Dr. Ferdinand wusste, dass es eine schwierige Frage war, die an die Grenze des Verstandes ging, und ließ ihm genügend Zeit zum Nachdenken. Er räumte bei dieser Frage ein, dass sie als Falle verstanden werden konnte, was allerdings nicht in seiner Absicht lag, weil ihm die Sache mit den zwei Gesichtern zu ernst war. Die Nachdenkminute wurde nachdenklich, Dr. Ferdinand nippte an seinem Glas Whisky mit Sodawasser und hatte das ungute Gefühl, ein Missverständnis provoziert zu haben, obwohl die Frage noch so im Raum stand, wie sie vor zwei Minuten dort hingestellt wurde, ohne dass ein Wort hinzugefügt oder eines von den sieben Worten weggenommen wurde, weil es beim Wegnehmen eines Wortes wirklich keinen Sinn mehr machen würde. Der Psychologe fasste sich bei der Ehre, als er zu dieser Frage bemerkte, dass sie nicht nur schwierig, sondern psychologisch äußerst kompliziert sei, weil da verschiedene Dinge aus unterschiedlichen Richtungen verbunden würden, deren Verbindung beim geringsten Anstoß wieder in ihre Teile zerfalle. „Sie meinen, dass diese Verbindung, wenn ich mich einmal chemisch ausdrücken darf, instabil ist, weil die nötigen Kopplungsvalenzen fehlen.“ Der Psychologe, der nach Einschätzung des Fragestellers noch relativ jung im Fach war und auch nicht gleich mit einer platten Rhetorik über die seelische Verpackung aufwarten wollte, was ihm der Fragesteller hoch anrechnete, meinte, dass der Beruf des Arztes ethisch und moralisch in sich so geschlossen sei, dass es da keinen Freiraum oder keine freie Valenz für eine Ankopplung mit einem anderen Beruf gebe. Dr. Ferdinand fiel ein Stein vom Herzen, dass der Psychologe die Frage nicht als eine Falle verstand, sondern das Problem erkannte, bei dem Moral und Ethik auf dem Spiel stehen. Der Psychologe schien die Straße gefunden zu haben, als er auf den Uniformträger zu sprechen kam, den er gesondert mit einem zivilen Auftrag neben den Soldaten mit einem militärischen Auftrag stellte. „Kann da nicht in den Augen der zivilen Bevölkerung ein Missverständnis oder Misstrauen entstehen, weil sie beim Arzt in Uniform den zivilen Auftrag vom militärischen Auftrag nicht klar und eindeutig unterscheiden kann?“, fragte Dr. Ferdinand. Der Psychologe: „Das ist durchaus möglich, es liegt aber nicht in der Absicht des Arztes oder des Uniformträgers mit dem Auftrag, Patienten zu behandeln.“ Dr. Ferdinand sah die Sackgasse kommen und fragte deshalb, ob es psychologisch nicht besser sei, die Absicht klarer dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass der Arzt das Zivile trägt, wie es die Bevölkerung auch tut, und die Soldaten mit dem militärischen Auftrag die Uniform, damit da kein Missverständnis und kein Misstrauen aufkommen kann. Der Psychologe: „Ich hätte da überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es ist die militärische Führung, die das Tragen der Uniform für alle angeordnet hat, die hier ihren Wehrdienst ableisten, und dazu gehören nun mal auch die Ärzte am Hospital, die aus Südafrika ins Kriegsgebiet geflogen wurden. Auch ein Arzt in Uniform kann ein guter Arzt sein und kann der Zivilbevölkerung die Botschaft der Menschlichkeit bringen.“ Dass die Wehrdienstleistenden aus Südafrika bis vor die angolanische Grenze geflogen wurden, das war für Dr. Ferdinand unbestreitbar. Das Problem trat beim guten Arzt in Uniform auf, der der Zivilbevölkerung die Botschaft der Menschlichkeit bringt. Er hatte ja die beiden Beispiele vom herzensguten Dr. van der Merwe, der sich für die Patienten einsetzte und ständig seine Uniform mit Gips bekleckerte, und dem arroganten Dr. Hutman in seiner geschniegelten Leutnantsuniform, dem der Orden „Der Leutnant des Teufels“ verliehen wurde, weil er sich nur halbherzig oder gar nicht um seine Patienten kümmerte, sich wichtig nahm und andere Kollegen anschwärzte. Er musste das Beispiel bringen, wobei ihm nicht klar war, welchen der gegensätzlichen Kollegen er erwähnen sollte und welchen nicht. Er dachte einen Augenblick darüber nach, während der Psychologe die Gläser nachfüllte, und entschied sich, beide Kollegen beispielhaft anzuführen. Er begann mit dem guten Kollegen und schilderte seinen Einsatz und seine Menschlichkeit, die ihn bei Patienten, Schwestern und Kollegen gleichermaßen beliebt machten, von denen einige Tränen in den Augen hatten, als er sich von ihnen verabschiedete. Dr. van der Merwe war ein tüchtiger Arzt und ein guter Mensch, der auf seine Uniform keine Rücksicht nahm und die Nöte der Menschen mit seinem Herzen und seinen Händen begriff. Ganz anders der andere, dem die Uniform wichtiger war als die Menschen, der bei Patienten, Schwestern und Kollegen unbeliebt war, weil sie seine Arroganz und Hinterhältigkeit fürchteten. „Als der ,Leutnant des Teufels’ ging, weinte ihm nicht nur keiner eine Träne nach, alle waren sogar froh und atmeten erleichtert auf.“ Der Psychologe nickte mit seinem Kopf und sagte, dass ihm beide Kollegen bekannt seien, von denen er Dr. van der Merwe und seine Frau als gute Menschen kennen gelernt habe. Nun waren sie in der Sackgasse, und Dr. Ferdinand und der Psychologe drehten sich im Kreise, weil sich Arzt und Uniform vom Inhalt und Auftrag her nicht vertrugen, wobei die sichtbare äußere Autorität nach dem Soldateneid mit der unsichtbaren inneren Autorität nach dem Eid des Hippokrates in Konflikt geriet und umgekehrt. Die Formel vom Tragenmüssen der Uniform bei den Wehrdienstleistenden leuchtete militärisch ein, nicht aber medizinisch, wenn es um die Belange der kranken Menschen ging, die schon genug in Not und Schrecken waren. Dr. Ferdinand fügte an, dass die Menschen nach dem, was hier ablief, nicht mehr daran glaubten, dass irgendein Uniformträger ihnen noch die Botschaft der Menschlichkeit bringen konnte. Das hielten sie für einen politischen Trick, der sich weit von der Wahrheit entfernte und deshalb Grund zum Misstrauen gab, dessen Boden die Erfahrungen des Alltags waren. Der Psychologe machte ein bedrücktes Gesicht, weil er dem eigentlich nichts entgegenhalten konnte, den beide wussten, dass ein Mehr an äußerer Autorität, die sich in Macht ausdrückte, im täglichen Leben oft mit einem Weniger an innerer Autorität einherging, in der es um die ethische und moralische Integrität ging.
Dr. Lizette hatte das Essen in der Küche vorbereitet und deckte geschmackvoll den Tisch, in dessen Mitte auf einer weißen Tischdecke eine schlanke Vase mit einer frischen, gelben Rose stand. „Die Rose ist von meinem Mann, der unseren Hochzeitstag nie vergisst. Ist sie nicht schön?“ Sie beugte sich über ihn und küsste seine rechte Wange. Sie hatte ein schickliches dunkelrotes Kleid angelegt, das sie mit einem konservativen Zuschnitt attraktiv erscheinen ließ. Der Ehemann folgte ihrer Bitte nach einem mundigen Rotwein, entkorkte den „Cabernet Sauvignon“ des Jahrgangs 1984 und füllte die aufgestellten Rotweingläser auf das richtige Maß. Sie hatten am Tisch Platz genommen und ließen sich das Essen schmecken, das köstlich zubereitet war. Mit erhobenen Gläsern sprachen sie sich die freundlichen Worte des Beisammenseins zu, wobei Dr. Ferdinand dem jungen Ehepaar zum dritten Hochzeitstag gratulierte und ihm weitere glückliche Jahre wünschte. Dr. Lizette, der das Sprechen von der Zunge ging, während die Herren den würzigen Rinderbraten auf der Zunge zergehen ließen, merkte die Besonderheit des Tages an und fügte hinzu, dass sie vor drei Monaten noch nicht wissen konnte, dass sie diesen Tag unweit der angolanischen Grenze verbringen würde. Auf die Frage von Dr. Ferdinand, ob sie bezüglich des siebzehnten südlichen Breitengrades enttäuscht sei, meinte sie, dass sie nicht direkt enttäuscht sei, aber jene südlichen Breitengrade mit der höheren Zahl aus familiären Gründen vorgezogen hätte, womit sie auf Südafrika zielte. Der Ehemann war sich seiner Pflicht zur Dienstableistung im Norden bewusst und Psychologe genug, seiner Frau Trost zuzusprechen, indem er von der begrenzten Zeit sprach, die sie auf diesem Breitengrad auszuhalten hatten. Sie nahmen nach dem Essen die Weingläser mit in die Klubecke, wo sie der Ehemann nachfüllte, als Dr. Lizette sagte: „Wir können nur hoffen, dass uns in dieser Zeit nichts zustößt.“ Sie sagte es mit dem realistischen Blick einer intelligenten jungen Ehefrau, der die Welt an diesem Breitengrad nicht verborgen blieb und auch nicht geheuer war. Dr. Ferdinand vermisste es, dass sie beim Wort „zustößt“ die schwarzen Menschen in ihre durchaus berechtigte Sorge einbezog, konzedierte ihr aber aufgrund ihrer weißen Herkunft und Jugendlichkeit, dass sich ihr Blickfeld für die Schwarzen noch nicht so weit geöffnet hatte. Er ergänzte daraufhin ihre Bemerkung, dass es jedem zustoßen konnte, von einer Granate getroffen zu werden, und die schwarzen Menschen es mittlerweile gelernt hatten, das Lebensrisiko, dem sie jeden Tag in erhöhtem Maße ausgesetzt waren, gelassen hinzunehmen. Der Psychologe machte ein nachdenkliches Gesicht und brachte den Aspekt der jungen Soldaten, denen der Dienst an diesem Breitengrad und noch weiter nördlich besonders schwer fiel, weil sie beim Schießen ihre Bedenken hatten, die sie zu ernsthaftem Nachdenken brachten und bei den intelligenten regelrechte Gewissenskonflikte auslösten, die sie nicht mehr beherrschen konnten, weil sie den menschlichen Verstand überstiegen. Dr. Ferdinand fand diesen Aspekt sehr interessant und wollte mehr darüber erfahren. So fragte er den Psychologen, wie denn die Soldaten aus ihren Gewissensnöten befreit werden konnten. „Das ist ein schweres Problem, weil es sehr komplex ist. Diejenigen, die zum ersten Mal auf einen Menschen zu schießen haben, empfinden diese Not besonders groß, und manche dieser Erstschützen berichteten, dass ihre Hände zitterten und sie erleichtert waren, dass sie am Menschen vorbeischossen, was andere wiederum mit ruhiger Hand taten, weil sie den Tod eines Menschen nicht verantworten konnten.“ „Wenn ich Sie recht verstehe, muss der Soldat erst die nötige Routine im Totschießen bekommen, um mit der zunehmenden Routine seine Gewissensnöte schrittweise abzubauen. Kann ich das so sagen?“, fragte Dr. Ferdinand. Der Psychologe: „Es hört sich unvernünftig an ...“ Dr. Ferdinand unterbrach ihn: „... weil das Schießen auf Menschen immer unvernünftig ist.“ „Wenn Sie so wollen, ich weiß, was Sie da meinen“, setzte der Psychologe seinen Satz fort, „weil jeder Krieg eine Bankrotterklärung der gegenseitigen Verständigung ist, die Regeln der Zivilisation außer Kraft setzt und daher mit der Vernunft unvereinbar ist. Aber um auf die von Ihnen vorgebrachte ,Routine’ zurückzukommen, es entspricht, ohne es werten zu wollen, der Praxis eines Psychologen, dass die Gewissensnöte abnehmen, je länger der Soldat mit dem Gewehr umgeht und mit dem Gewehr Menschen erschießt.“ Dr. Ferdinand nickte ihm zu und fand es beängstigend und abscheulich, dass es dieser Mechanismus mit der wachsenden Routine im Totschießen war, der sich so nachhaltig auf das Gemüt auswirkte, dass das Gewissen dabei letztendlich keine Not mehr empfand. „Was sagen Sie jenen Soldaten, die Ihnen vom Zittern der Hände und vom Vorbeischießen mit ruhiger Hand berichten?“, fragte Dr. Ferdinand. Der Psychologe: „Viel kann ich da nicht sagen, weil das fünfte Gebot auch in meinem Hinterkopf sitzt. Doch kommt dann die Uniform herein, so ähnlich wie beim Arzt in Uniform, und ich selbst sitze in der Uniform eines kleinen Offiziers vor dem Soldaten mit der Gewissensnot, so dass der Soldat und ich als Militärpsychologe am militärischen Auftrag nicht mehr vorbeikommen. Da ist eine Schlucht, die Gewissensschlucht, über die eine Brücke gespannt werden muss, um beide Seiten zu verbinden.“ Dr. Ferdinand: „Wie kann denn eine Brücke vom fünften Gebot zum Schießbefehl gespannt werden? Ist das nicht unmöglich, weil das eine das andere grundsätzlich ausschließt?“ Der Psychologe: „Ich nenne diese Brücke deshalb ,Behelfsbrücke’ oder ,Schluchtsteg’ oder ,Kriegspfad’, Sie können auch noch andere zusammengesetzte Worte dafür einsetzen, weil ich mir der Problematik bewusst bin, dass die Vernunft da an der Schlucht eigentlich abbricht und keine Brücke zulässt, weil es da nichts zu überbrücken gibt.“ Dr. Ferdinand: „Da gebe ich Ihnen Recht, wenn ich auch nicht verstehen kann, wie so eine ,Behelfsbrücke’ oder ein ,Schluchtsteg’, oder wie Sie es sonst noch nannten, überhaupt gedacht werden kann, oder freier formuliert, wie eine Brücke zwischen fünftem Gebot und Schießbefehl gespannt werden kann, die doch widersinnig ist, von welcher Seite Sie die Brücke auch betrachten, solange man noch alle Sinne beisammen hat. Bei diesem Brückenbau kann doch nur der militärische Auftrag gelten, durch den das fünfte Gebot als der andere Brückenpfeiler gewaltsam weggesprengt und in die Schlucht geworfen wird, die Brücke also nur am militärischen Pfeiler Halt findet und an der moralischen Seite völlig in der Luft hängt, wie es der Schießbefehl will. Dieses gedankliche Monster nennen Sie Brücke oder ,Behelfsbrücke’ oder sonst wie und setzen dieses Ungebilde, das jeglichem gesunden Menschenverstand widerspricht, den Soldaten vor, die mit ihren Gewissensnöten zu Ihnen kommen, um von den Qualen des Tötenmüssens befreit zu werden. Das verstehe ich eben nicht.“ Der Psychologe hatte es verstanden und schwieg, weil es da keine Brücke gab, die solche Gegensätze miteinander verband und überbrückte. Es war ein strategischer Irrsinn, der zweckgebunden vom Leben in den Tod gespannt wurde, wofür der Koffer mit den psychologischen Sonden der völlig falsche Koffer war, so wie ein Kochbuch oder Gedichtband für einen Chirurgen unbrauchbar war, der ein Anatomiebuch brauchte, um sich für eine schwierige Operation vorzubereiten. Die Wahnvorstellung von einer Brücke über die Schlucht, die zwischen fünftem Gebot und Schießbefehl lag, war so alt wie die Menschheit selbst, und die Menschen wussten um ihre fehlerhafte Statik, weil sie einem Irrsinn aufsaß. Dr. Ferdinand hatte sich bei der Vorstellung dieses Monsters erschrocken und fand es tragisch, dass so eine Schlucht, über die es keine Brücke geben durfte, auch noch psychologisch zumindest mit einer „Behelfsbrücke“ oder einem „Schluchtsteg“ überspannt wurde oder überspannt werden musste, um der Uniform zu genügen, mit der der Schießbefehl einherging. Das Telefon klingelte, Dr. Lizette nahm beim dritten Klingelzeichen den Hörer ab, bekam ein ernstes Gesicht, als würde sie eine schlechte Botschaft empfangen und sagte am Schluss, dass sie Dr. Ferdinand davon in Kenntnis setzen werde. „Es war die Nachtschwester vom ,Outpatient department’, wo ein Mann liegt, der angeschossen wurde, dem die verletzten Darmschlingen aus dem Bauch hängen.“ Der Psychologe machte ein betroffenes Gesicht, denn zum Alltag konnte auch er keinen konstruktiven Beitrag leisten, um der Gewalt ein Ende zu bereiten. Dr. Ferdinand dankte für den schönen Abend mit dem köstlichen Essen und dem interessanten Gespräch. Sie drückten gemeinsam den Wunsch aus, dass ein solcher Abend wiederholt werden sollte, um das Gespräch fortzuführen. Das Ehepaar brachte Dr. Ferdinand zum Auto, der Psychologe öffnete das Ausfahrtstor und sie wechselten bei laufendem Heckmotor noch einige freundliche Worte durch die heruntergedrehte Scheibe. Dann fuhr Dr. Ferdinand davon und brachte den Abend als atmosphärisch und aufschlussreich in sein Gedächtnis. Er passierte die Sperrschranke am Dorfausgang nach einer oberflächlichen Kontrolle, erreichte wenig später die Hospitaleinfahrt, wo der Pförtner in aller Ruhe auf einem Stuhl saß, stellte das Auto vor der Schmalwand der „Intensiv“-Station ab, betrat das „Outpatient department“ und ging geradewegs auf die Trage zu, auf der der Verletzte lag, die von zwei anderen Männern, die sich als Brüder ausgaben, umstellt war. Dr. Ferdinand hob die Decke hoch und sah die herausgetretenen Darmschlingen auf dem Bauch, die an mehreren Stellen aufgerissen waren, als ihm der ältere der beiden Männer den Unfall schilderte, was die Schwester ins Afrikaans übersetzte. Es war dunkel, als drei Männer um ihren Kral herumstrichen und dabei waren, zwei Rinder zu stehlen. Der jüngere Bruder schlug mit dem Knüppel auf diese Männer ein, als einer mit der Pistole auf ihn schoss, was er, der ältere Bruder hörte, dem jüngeren zu Hilfe eilte und die drei Männer wegrennen sah, die dann mit einem „Casspir“ davonfuhren. Es waren Männer der Koevoet, jener gefürchteten Spezialeinheit, die mit dem „Casspir“ kamen, um nun auch Rinder zu stehlen und dabei dem, der Im Recht war, in den Bauch schossen. Dr. Ferdinand nahm Blut zur Kreuzprobe ab, während die Schwester den Laboranten telefonisch aus dem Bett holte. Die Nachtschicht im OP-Raum und Dr. Nestor wurden von der Notfalloperation in Kenntnis gesetzt, dann rollten Arzt und Schwester den Patienten zum „theatre“. Dr. Ferdinand saß umgezogen im Teeraum und dachte bei einer Tasse Tee über den Abend bei Dr. Lizette und ihrem Ehemann nach. Er konnte es einfach nicht verstehen, dass Menschen dort Brücken bauten, wo sie nicht hingehörten, und damit den Versuch an der falschen Stelle machten, das Unmenschliche menschlich einzukleiden, um dem unmoralischen Verhalten einen moralischen Anstrich zu geben. Er nannte es die „moralische Verwerfungszone“, die er sich wie einen riesig aufgeworfenen Vulkan mit dem großmäulig gähnenden Rachen eines hundert Meter langen Riesenkrokodils vorstellte, das die perverse Bande mitsamt dem unmenschlichen System mit seinen scharfen Reißzähnen zerkleinerte und verschluckte, weil sie mit Brücken hantierte, deren Statik vorn und hinten nicht stimmte. Dr. Nestor war eingetroffen, zog sich um und versuchte mit verschlafenem Gesicht, das Problem mit der Schussverletzung gedanklich in den Griff zu bekommen. Sie hoben den Patienten von der Trage auf den OP-Tisch. Die OP-Schwester ließ sich in den grünen Kittel helfen und die Spritze zur Narkoseeinleitung und der Atemtubus lagen bereits auf dem Narkosetisch, als Dr. Ferdinand sich die Hände wusch, sich ebenfalls in den grünen OP-Kittel helfen ließ und die Handschuhe dabei über die Ärmel streifte. Er umfasste den herausgetretenen Darm mit einer großen sterilen Kompresse, damit die OP-Schwester die Bauchhaut mit der braunen Desinfektionslösung überstreichen konnte. Der Patient war intubiert und an die Narkosemaschine angeschlossen, als Dr. Ferdinand die Haut längs und in der Mitte einschnitt. Nach Eröffnung der Bauchhöhle wurde das in ihr angesammelte Blut abgesaugt, welches immerhin fast einen Liter ausmachte. Da waren noch mehrere Risswunden am Darm, wobei auch der Querdarm und das Darmgekröse betroffen waren, die durch Einblutungen erhebliche Hämatome aufwiesen. Es wurde durch Naht geschlossen, was durch Naht geschlossen werden konnte, doch von den herausgetretenen Dünndarmschlingen, die zum Teil regelrecht zerfetzt waren, mussten zwei Schlingen reseziert werden. Insgesamt waren es etwa vierzig Zentimeter Darm, die herausgeschnitten wurden. Die neue Darmverbindung war genäht und der Bauchraum gesäubert und revidiert, als aus dem Kreißsaal die Nachricht von einer blutenden extrauterinen Schwangerschaft kam, die eine Operation dringend erforderlich machte. Auch meldete das „Outpatient department“, dass dort zwei Patienten mit Schnittverletzungen eingetroffen waren. Es war genau zwei Uhr morgens, als die erste Operation beendet war, der Patient im Aufwachraum lag und die Patientin mit der blutenden Schwangerschaft auf den OP-Tisch gelegt wurde. Die Doktoren hatten eine Tasse Tee zu sich genommen und gingen zum „theatre 1“, wo die OP-Schwester die Patientin bereits gesäubert und mit sterilen Tüchern abgedeckt hatte. Die Patientin war in Narkose, als Dr. Ferdinand im grünen Kittel die Handschuhe überstreifte und die Schwester das Skalpell schon für ihn in der Hand hielt. Der Bauchraum wurde eröffnet und mehr als ein Liter Blut abgesaugt, als ein Föt, dessen Größe einer etwa vier Monate alten Schwangerschaft entsprach, tot hinter dem rechten Eierstock sichtbar wurde. Er wurde herausgenommen und in ein Glas mit vierprozentigem Formalin gelegt. Der blasig vergrößerte, blutig gefleckte und rupturierte Eierstock und der dazugehörige Eileiter wurden abgetragen und der kurze Eileiterstumpf vor dem Eintritt in die Gebärmutter durch Naht verschlossen. Geblutet hatte es aus dem Eierstock. So bestand die lebensrettende Maßnahme in der Unterbindung der in den Bauchraum hineinpulsierenden Eierstocksarterie. Die Schichten der Bauchdecke wurden vernäht und der Verband aufgelegt, als sich das Team noch einige ruhige Stunden bis zum Sonnenaufgang wünschte, die es unter normalen Umständen längst verdient hätte. Dr. Ferdinand dankte allen für ihre Bereitwilligkeit und die geleistete Arbeit. Er machte sich am Waschbecken im Umkleideraum frisch, zog das weiße Hemd mit den langen Ärmeln und die dunkle Hose an, krempelte die Ärmel bis zu den Ellenbogen hoch und ging zum „Outpatient department“, um nach den beiden Patienten mit den Schnittverletzungen zu sehen, die dort nebeneinander auf der ersten Bank saßen. Der eine hatte sich in die rechte Hand geschnitten, wobei er gleich die Beugesehnen des zweiten und dritten Fingers mit durchtrennt hatte, während der andere eine Schnittwunde im Gesicht hatte, bei der auch die Oberlippe tief eingeschnitten war. Eine junge, weniger erfahrene Schwester hatte die schief hängende Lampe im kleinen OP-Raum des „Outpatient departments“ angestellt und legte die erste steril verpackte Nierenschale mit den Instrumenten auf den Instrumententisch, als Dr. Ferdinand mit dem ersten Verletzten hereinkam und ihn zum Hinlegen auf den völlig veralteten OP-Tisch aufforderte. Er holte die Nierenschale aus der weißen Papierverpackung, in der die Instrumente mit der Patina der letzten Jahrhundertwende von der Zusammenstellung her völlig unproportioniert und trostlos herumlagen, was den plumpen Nadelhalter, die zu großen Klemmen und die feine Spitzpinzette betraf, die als einzige Pinzette in der Schale lag und sich zwischen den groben Klemmen quer legte, deren Fasszähne allerdings nicht mehr schlossen, sondern sich verbogen ineinander verklemmten. Der rechte Arm lag abgestreckt auf einem alten, am Tisch eingehängten Armbrett. Die Hand wurde örtlich betäubt und mit der braunen Desinfektionslösung bestrichen. Dr. Ferdinand, der auf einem Drehhocker saß, zog sich den mit einem sterilen Tuch überzogenen Instrumententisch, auf dem die nicht zusammenpassenden Instrumente ausgelegt waren, auf klemmenden Laufrollen in Reichweite heran; während die Schwester die OP-Lampe mit einer Hand hielt, um sie am Weggleiten zu hindern und das Licht auf die Hand zu zentrieren. Es strengte an, die Sehnenchirurgie unter fast mittelalterlichen Bedingungen auszuführen, was Dr. Ferdinand erfolgreich tat und nach einer gut einstündigen Operation und einem ständigen Ringen um ein ausgeleuchtetes Operationsfeld den Handverband anlegte. Der zweite Patient, dem ein Messer das Gesicht zerschnitten und die Oberlippe tief eingeschnitten hatte, legte sich auf den OP-Tisch und bekam die örtliche Betäubung. Die Zusammenstellung der Instrumente in der ausgepackten Nierenschale war anders, aber ebenso disproportional. So war der Nadelhalter nicht von der Patina der Jahrhundertwende überzogen und im Gelenk angerostet, aber er war unverhältnismäßig klein gegenüber der langen anatomischen Pinzette. Die beiden Klemmen und die eine gebogene Schere, die der jahrelange Gebrauch abgestumpft und kratzig gemacht hatte und deren Gelenke ausgeleiert oder schwergängig waren, lagen größenmäßig dazwischen. Damit wurden die Schnittwunden im Gesicht vernäht und die Oberlippe nach den Gesichtspunkten der plastischen Chirurgie wiederhergestellt. Die Schwester war wegen der Ermüdung ihres hochgehaltenen Armes häufiger daran zu erinnern, das Licht auf das Gesicht des Patienten einzustellen. Es war der letzte Patient, der chirurgisch versorgt wurde. Er setzte sich mit dem Gesichtsverband neben den anderen Patienten mit dem Handverband auf die Bank zurück, weil beide hier auf die nahende Tagesdämmerung warten wollten, um den Heimweg anzutreten. Dr. Ferdinand verließ gegen halb sechs mit seinem Käfer das Hospital. An ein Schlafen wollte er zu dieser frühen Morgenstunde nicht mehr denken, und so stellte er sich unter die Brause, um den ausgebliebenen Schlaf auf die nasse Weise wettzumachen. Er hörte die Hähne krähen, ohne ihnen die gewohnte Aufmerksamkeit zu schenken, machte sich einen Kaffee und rauchte eine Zigarette dazu. Er hatte sich die weiße Arbeitskleidung angezogen und das Sonntägliche in den Schrank zurückgehängt, als er sich gegen halb sieben in den abgelaufenen Sandalen wieder auf den Weg zum Hospital machte und die Sperrschranke am Dorfausgang erreichte, wo es die Wachhabenden nicht glauben konnten, dass ein Arzt überhaupt keinen Schlaf mehr braucht. Sie ließen ihn ungläubig, doch freundlich passieren. Der Pförtner an der Toreinfahrt erhob sich schwerfällig von seinem Stuhl. Ihm fiel der Morgengruß verspätet ein, wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass er es nicht glauben wollte, den Doktor jetzt schon wiederzusehen, der bereits über den Vorplatz schritt und auf halbem Wege zur „Intensiv“-Station war. Dort wunderten sich die Schwestern allerdings über sein verspätetes Kommen. Er erklärte es ihnen ohne jegliche Schlaffalte im Gesicht.
Dicke Schlaffalten hatte dagegen der Superintendent im Gesicht, als er mit stark geröteten Augen und hemdsärmelig hinter seinem Schreibtisch saß, seine morgendliche Nasentoilette durchführte, das Taschentuch schließlich in die Hosentasche stopfte und die Besprechung mit einer Verspätung von etwa zehn Minuten eröffnete. Es war Dienstag, der Raum hatte sich gefüllt. Die Klimaanlage ratterte über den Köpfen derjenigen, die an der Fensterseite saßen. Einige Kollegen trafen später ein, unter denen auch Dr. Witthuhn und Dr. Nestor waren, wobei Letzterer bis in die frühen Morgenstunden mit Dr. Ferdinand gearbeitet hatte. Der Superintendent ließ sich dadurch nicht stören, denn er befand sich bereits in der Mitte seines Vortrags über die schlechter werdende Sicherheitslage am Hospital. Er sprach von den zunehmenden Diebstählen von Ersatzteilen im Fuhrpark, wobei sich Dr. Ferdinand gleich wieder den verluderten, völlig verwahrlosten Schrottplatz mit den restlichen zwei Fahrzeugen vorstellte, die eigentlich auch schrottreif waren. Die Diebstähle dehnten sich nun auf die Hauptküche aus, wo Brote, Milch und Zucker und aus dem Gefrierschrank große Mengen Fleisch gestohlen wurden. Auch das Apothekenlager blieb nicht verschont, wo ganze Kartons mit Infusionen und Medikamenten fehlten. „Diese Aktivitäten müssen gestoppt werden, wenn das Hospital noch funktionsfähig bleiben soll. Wo kommen wir denn hin, wenn das so weitergeht? Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, die ich für das Hospital und die Patienten übernommen habe. Ich appelliere an die Verantwortung eines jeden von Ihnen, dafür zu sorgen, dass diese kriminellen Aktivitäten unterbunden werden.“ Das Apothekerehepaar machte betroffene Gesichter, wenn auch nur der Ehemann für das Lager zuständig war. Der Superintendent verließ dieses Thema noch nicht, weil es genug zu denken gab, und merkte Folgendes an: „Der Verdacht liegt nahe, dass es ,Insider’ sind, die mit der SWAPO kollaborieren und ihre Leute mit Medikamenten und Nahrungsmitteln versorgen, die eigentlich unseren Patienten zukommen sollen.“ Dr. Ferdinand hatte noch einen anderen Verdacht, den er strengstens sich selbst anvertraute, nämlich dass es durchaus „Insider“ waren, die aber nicht mit der SWAPO, sondern mit der Koevoet kollaborierten, aus welchen Gründen des Überlebens auch immer, die die Familien der „Insider“ einschlossen, denn der Koevoet blieb bei ihren nächtlichen Hospitalkontrollen keine Tür versperrt. Sie hatte ein leichtes Spiel, einzuladen, was sie wollte, und wenn es das Fleisch aus dem Gefrierschrank der Hauptküche war. Diesen rücksichtslosen Burschen waren die Patienten völlig egal. Er kam auf diesen Verdacht durch den Patienten der vergangenen Nacht, dem einer der Koevoetmänner mit der Pistole in den Bauch geschossen hatte, weil er verhindern wollte, dass diese Leute zwei Rinder stahlen. Das mit der Apotheke, das schien ihm ein gesondertes Problem, bei dem er noch nicht durchblicken konnte. Es wollte Dr. Ferdinand nicht einleuchten, dass sich diese rüden, ungebildeten Burschen, die doch ständig ans Fressen dachten, in den pharmazeutischen Dingen auskannten und eine Auslese zum Mitnehmen trafen, wofür doch wesentlich mehr Grips erforderlich war, der solchen Männern von vornherein abging, den sie auch nicht brauchten, weil sie im Krankheitsfall ohnehin vom Militärlazarett gut versorgt wurden, wo es an Medikamenten und Infusionen, im krassen Gegensatz zum Hospital, nicht fehlte. „Ich denke“, fuhr der Superintendent fort, „dass für die Sicherheit etwas getan werden muss. Die nächtlichen Kontrollen müssen verstärkt und die Eingänge zur Hauptküche und zum Apothekenlager durch eine Stahlgittertür gesichert werden. Ich fordere Sie auf, wachsam zu sein und mir die kriminellen Elemente unverzüglich zu melden, damit denen endlich das Handwerk gelegt wird, denn so kann es nicht weitergehen.“ Dr. Ferdinand stellte die Frage, was denn bezüglich des Einfahrtstores unternommen wurde, das nicht geschlossen werden konnte, nachdem es von der Koevoet zusammengefahren wurde. Das war nun schon einige Wochen her. „Da beginnt doch die Sicherheit, und solange das Tor nicht in Ordnung gebracht ist, kann auch keine Kontrolle sein. Ich kann zwar keine Gedanken lesen, aber die weggeknickten Rohrpfosten und das herausgerissene Tor, das seit Wochen verbogen und verbeult daneben liegt, lassen doch keinen Zweifel zu, dass da vorsätzlich Gewalt angewendet und der entstandene Schaden anderen überlassen wurde. Das kann meines Erachtens nicht gehen, wenn wir über die Sicherheit am Hospital sprechen, wofür der Superintendent die bevorzugte Verantwortung trägt.“ Die Niesattacke des Superintendenten war vorprogrammiert und kam lediglich für die philippinischen Neulinge überraschend, die mit großen Augen verfolgten, wie er sich das Taschentuch aus der Hosentasche zerrte und lautstark hineinnieste, die Brille dabei auf dem breiten Nasenrücken so schief verrutschte, dass das rechte Brillenglas unter dem rechten Auge hing und man sich hätte schief lachen können, wenn der Anlass nicht ein so ernster gewesen wäre. Die Attacke klang ab, die Brille wurde in die Waagerechte zurück- und auf dem Nasenrücken hochgeschoben, so dass die geröteten Augen hinter den Gläsern noch größer wurden und den Eindruck des Heraustretens machten, als er mit dem Taschentuch vor der Nase Dr. Ferdinand fragte, wie er denn darauf käme, dass es die Koevoet gewesen war, die das Einfahrtstor zertrümmert hatte. Dr. Ferdinand wunderte sich zunächst über diese politisch motivierte Blindheit und berichtete dann von der breiten Reifenspur mit dem groben Profil, die bis an den weggeknickten Torpfosten heranging. „Davon hat mir keiner etwas gesagt“, begann die Verteidigung des Superintendenten. „Das können Sie von dem Pförtner auch nicht erwarten, dem sein Leben lieber ist, als Ihnen zu sagen, was er gesehen hat. Das hätten Sie an dem betreffenden Morgen schon selbst anschauen müssen, als die Reifenspuren noch frisch in den Sand gedrückt waren und das Lesen dieser Spuren jeden Zweifel ausschloss, wie es zu dieser Zerstörung gekommen ist.“ Der Superintendent hatte das Taschentuch wieder weggesteckt und wollte die Ausführungen des Dr. Ferdinand mit dem Spurennachweis nicht glauben. Er fragte ihn, wie er denn von den Reifenspuren auf einen „Casspir“ schließen und der Koevoet den Schaden anlasten könne. Dr. Ferdinand wunderte sich nun über die politisch motivierte Denkblindheit nicht mehr. Für eine Sekunde überfiel ihn die Stimmung eines „Dann leck mich doch kreuzweise“, doch dann konterte er mit der Gegenfrage, ob der Superintendent schon einmal ein Zivilfahrzeug mit so breiten, grobprofiligen Reifen gesehen hätte. Nun gab sich der Superintendent geschlagen. So unterließ er aus Gründen des eigenen Überlebenwollens die weitere Erörterung, um aus dem Fangnetz zu entkommen und der kurzen Antwort mit dem Wort „Nein“ zu entgehen. Er wollte eigentlich das Thema um die „Sicherheit“ des Hospitals abgeschlossen haben, wenn nun nicht Dr. Witthuhn mit der Frage nachgesetzt hätte, wie es denn um die neue Toreinfahrt stünde. Der Superintendent schaute ihn an, wobei er die Brille mit dem linken Zeigefinger am Nasenbügel zurückschob. Entrüstung und Entwaffnung hielten sich die Waage, Konkretes konnte er nicht sagen, als er von der Administration sprach, die er noch am selben Tage von der zertrümmerten Einfahrt in Kenntnis gesetzt hatte. Dr. Witthuhn sah auf irgendeinen Punkt oder Fleck am Fußboden, da er mit seinen Erfahrungen und falschen Versprechungen vonseiten der Administration noch voll eingedeckt war. „Da können Sie lange warten“, meinte Dr. Nestor, und Dr. Ferdinand dachte dabei an den „Sankt-Nimmerleins-Tag“ in Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“, als er sagte: „Solange können Sie aber diesmal nicht warten.“ Der Superintendent hörte es sich an. An was er dachte, als er es hörte, das wusste in diesem Augenblick keiner, denn er sagte kein Wort mehr dazu.
Die Sirenen heulten über dem Dorf auf, so dass keiner das Klopfen an der Tür hörte, und ein Offizier vom Range eines Majors den Raum betrat, der diesmal nicht als Spezialist vom Lazarett des Militärcamps in Ondangwa kam, sondern vom Brigadegeneral aus dem Dorf geschickt wurde, um mit dem Superintendenten zu sprechen, dem er eine Botschaft von höchster Stelle zu überbringen hatte. Damit war die Morgenbesprechung beendet, obwohl vieles mehr hätte besprochen werden müssen. Die Teilnehmer nahmen es gelassen hin und verließen den Raum mit der klaren Erkenntnis, dass diese Besprechungen bislang so gut wie nichts am Zustand des Hospitals geändert hatten, die deshalb der Schweizer Kollege seinerzeit als sinnlose Zeitverschwendung deklarierte und sich persönlich von diesem Zirkus, wie er es nannte, ausschloss, was er konsequent bis zu seinem Rückflug in die Schweiz befolgte. Der junge Kollege, der in seiner Freizeit an einem Buch über das Leben eines jungen Ehepaars schrieb, das wegen der Rassengesetze Südafrika verlassen hatte und nach Neuseeland emigriert war, eilte Dr. Ferdinand nach, um ihm über den neuesten Stand seiner Erzählung zu berichten. „Als ich die Sirene über dem Dorf heulen hörte“, sagte der junge Kollege fast aufgeregt, „hörte ich die kleine Glocke der Dorfkirche an der Palliser Bucht läuten. Sie läutete in der Nacht und lange, um die Dorfbewohner vor dem anrückenden Taifun zu warnen, der jedes Jahr im Juni über die Insel stürmt, Dächer abhebt und Häuser eindrückt und umkippt, wobei die anrollenden Flutwellen das Land hinter der Bucht überschwemmen. Einige Male stand das kleine Dorf unter Wasser, und auch die aufgeschichteten Sandsäcke vor den Eingängen konnten nicht verhindern, dass das Wasser in die Häuser drang. Die Menschen fuhren in Kanus, die übers Jahr mit dem Kiel nach oben neben den Häusern auf niedrigen Holzböcken lagen und in größeren Booten durchs Dorf und brachten ihre Schafe und Ziegen ins Trockene zum Weiden.“ Dr. Ferdinand freute sich, dass der junge Kollege an seiner Geschichte arbeitete. Er fand die Assoziation mit der heulenden Sirene nicht uninteressant und wollte an das nächtliche Sturmläuten der kleinen Kirchturmglocke an der Palliser Bucht denken, wenn die Dorfsirenen das nächste Mal heulten, und an das Sirenenheulen denken, wenn er im fertig gestellten Buch die Stelle mit dem Sturmläuten der Glocke las, das die Dorfbewohner vor dem anrückenden Taifun warnen sollte. Auf dem Weg zum „theatre“ wurden sie aus dem Gespräch gerissen, als eine schwarze Frau, die weiß geblieben war, weil ihr als „Albino“ die Melanozyten nicht in die Haut mitgegeben waren, vor ihren Augen plötzlich zusammenbrach und einen epileptischen Anfall auf dem harten Betonboden bekam. Das kleine Mädchen von normaler schwarzer Hautfarbe, das die Albinomutter an der Hand geführt hatte, war hilflos und weinte in kindlicher Sorge um die Mutter. Dr. Ferdinand bucket sich über die Krampfende, der der Schaum vor dem Mund stand, drehte und hielt ihren Kopf zur Seite, wischte ihr den Schaum mit seinem Taschentuch vom Mund und beugte einer Aspiration vor. Er konnte nicht verhindern, dass sich die Frau auf die Zunge biss, denn er konnte ihren Mund nicht öffnen. Ihr Kaumuskel krampfte, gegen dessen Stärke seine Finger nicht ankamen. Das Mädchen stand ihm gegenüber und ließ sich den traurigen Anblick der Mutter nicht nehmen, während er es sich gefallen ließ, dass die Krampfende ihm den Schaum ins Gesicht spuckte. Der junge Kollege und eine Schwester brachten die Trage auf quietschenden Rollen. Gemeinsam hoben sie die Mutter auf die Trage, Dr. Ferdinand nahm das Mädchen an die Hand, und sie fuhren mit ihr zum kleinen OP-Raum des „Outpatient departments“, um ihr den Schaum aus dem Mund zu saugen, die Platzwunde über dem Hinterkopf zu nähen und die Risswunden an den Armen ihrer ohnehin rissigen, vom Ultraviolett der Sonne verstrahlten Haut zu säubern und zu verbinden, die von zahlreichen fleckigen Narben und Geschwüren überzogen war. Das Mädchen schluchzte noch in den Armen einer alten, verständigen Memme auf der Bank vor dem kleinen OP-Raum, als die Mutter zu sich kam und mit Kopfverband und Verbänden an den Armen von Dr. Ferdinand hinaus- und dem verweinten Mädchen zugeführt wurde. Sie setzte sich neben die ältere Memme, nahm das Töchterchen, das große Augen machte, auf ihren Schoß, drückte es an sich und dankte dem Arzt herzlich für seine Mühen. Wie so oft nahm Dr. Ferdinand diesen Dank berührt entgegen, weil er spürte, dass dieser Dank aus dem Herzen kam, und strich mit der Hand dem Mädchen über die verweinten Wangen. Die Schwester brachte noch die Tabletten zur Sedierung des zentralen Nervensystems und drückte das Tütchen mit dem Abgezählten der Mutter mit dem Töchterchen auf dem Schoß in die Hand. Die Augen der Mutter hatten die Ruhe noch nicht gefunden. Die Tabletten sollten für die nächsten zwei Monate reichen. Nach dieser unvorhergesehenen Verspätung betrat Dr. Ferdinand das „theatre“ und wechselte die Kleidung im Umkleideraum. Der junge Kollege war schon vorausgegangen, um Dr. Lizette und die OP-Schwester vom Grund der Verspätung zu unterrichten. An diesem Tage standen chirurgische Patienten auf dem Programm, eine Frau im mittleren Alter mit einer enorm vergrößerten Schilddrüse, ein Kind mit einem Zungenbändchen, dem das Bändchen das Herausstrecken der Zunge unmöglich machte, eine Frau, die mit Steinen in der Gallenblase unter starken Koliken litt, der die Gallenblase entfernt werden musste, und eine Probelaparotomie bei einem älteren Mann, der an Gewicht verloren und einen tastbaren Tumor im Oberbauch hatte. Die Besuche der Spezialisten aus Ondangwa, die eine Hilfe bei der Abwicklung der Dienstags- und Freitagslisten waren, hatten mit dem Weggang der meisten uniformierten Kollegen, die nicht mehr durch neue ersetzt wurden, das Prinzip der Regelmäßigkeit verlassen. Diese Besuche hatten den Charakter des Sporadischen angenommen, wobei der Grund des Kommens sich häufig auf Besprechungen mit dem Superintendenten oder ärztlichen Direktor beschränkte. Da die Patienten und jüngeren Kollegen, die noch im Lernstadium waren, von diesen Besuchen immer weniger profitierten, konnte Dr. Ferdinand mit einer akademischen und operativen Unterstützung durch diese Spezialisten in ihren hochkarätigen Uniformen nicht mehr rechnen. Er hatte ja von jeher seine Bedenken bei den Ärzten in Uniform, warum sollte es bei den Spezialisten in den Offiziersröcken anders sein? So stellte er seine persönlichen Vermutungen an, dass da in der Doppelfunktion dieser Akademiker in Anbetracht der immer kritischer werdenden Situation, wo der Umschlag des Pendels doch nur noch eine Frage der Zeit war, das analytische Differential zugunsten der Uniform gezogen wurde. Wie dem auch war, es bedeutete mit weniger Ärzten ein erhebliches Maß an Mehrarbeit, die gemacht werden musste, um das Hospital am Laufen zu halten. Er wusch sich die Hände und ließ sich in den OP-Kittel helfen, streifte sich die Handschuhe über und trat an den OP-Tisch, auf dem die Patientin in Narkose und mit sterilen Tüchern abgedeckt lag. Wie schon gesagt, die Schilddrüse war enorm vergrößert und reichte bis ans Brustbein heran. Die Präparation war zeitaufwändig und das Auffinden der oberen Polarterie schwierig, die auf beiden Seiten zu unterbinden und zu durchtrennen war. Die Operation dauerte fast zwei Stunden, als Dr. Ferdinand völlig durchgeschwitzt das Rohr der Wunddrainage an den zusammengedrückten Ziehharmonika-Plastikbehälter anschloss und den Wundverband auflegte. Er rieb sich den Schweiß im Umkleideraum von Gesicht, Hals und Brust, fuhr einige Male mit einem trockenen Hemd durch die nassen Haare, harkte die feuchten Strähnen zwischen den gespreizten Fingern einigermaßen zurecht und ließ sich mit frischem grünen Hemd und frischer grüner Hose im Teeraum nebenan den gesüßten „Rooibos“-Tee schmecken, während Dr. Lizette die Spritze zur Kurznarkose für das Kind mit dem Zungenbändchen aufzog. Die Durchtrennung des Bändchens mit dem Thermokauter dauerte etwa eine Minute, und Dr. Ferdinand hielt diesen operativen Eingriff für den kürzesten, den es in der Chirurgie gab, wenngleich ihm eine beachtliche Bedeutung beim Herausstrecken der Zunge zukam. Dr. Lizette stellte sich für einige Minuten neben Dr. Ferdinand, als dieser sich für die dritte Operation, die Entfernung der Gallenblase mit den Steinen, wusch, um ihm zu sagen, dass sie und ihr Mann das Gespräch am vergangenen Abend als interessant und aufschlussreich empfunden hätten, was er von sich aus ebenfalls bestätigte. Sie fügte hinzu, dass sie noch bis in die Nacht hinein über das Problem des Arztes in Uniform diskutiert, aber keine Lösung der Doppelberuflichkeit in einer Person gefunden hatten, die dem Eid des Hippokrates voll Rechnung trug. „Das ist es ja, was die Sache so schwierig macht“, meinte Dr. Ferdinand beim Betreten des OP-Raums, wo Dr. Lizette mit der Narkose begann. Er sagte, dass man sich für einen Beruf entscheiden müsse, weil man zwei Berufe in einer Person nicht ausführen könne, vor allem dann nicht, wenn der eine ein militärischer ist und der andere ein ärztlicher. Sie stand hinter dem Narkosebügel und schaute der Operation so aufmerksam zu, dass Dr. Ferdinand den Eindruck hatte, sie wollte die abendliche Diskussion fortsetzen, während er die Gallenblase frei präparierte und die Klemme am Blasenhals vor der Einmündung in den quer verlaufenden Gallenhauptgang ansetzte, weil bei dem Gespräch das ärztliche Ethos auf dem Spiel stand, dem die Uniform mit dem militärischen Auftrag abträglich war. Der junge Kollege hatte sein anatomisches Wissen durch das einfühlsame und geschickte Assistieren bewiesen, wofür ihm Dr. Ferdinand beim Auflegen des Verbandes als Erstem dankte. Sie machten eine kleine Teepause, als er nun den jungen Kollegen ein bisschen mehr von den Menschen an der Palliser Bucht erzählen ließ, was Dr. Lizette mit größtem Interesse verfolgte. Er erwähnte wieder das Sturmläuten der kleinen Kirchturmglocke, als Dr. Ferdinand es nicht vergaß, an das morgendliche Sirenenheulen über dem Dorf bei der dann vorzeitig abgebrochenen Besprechung zu denken, weil ein Major dem Superintendenten eine Botschaft vom Brigadegeneral überbrachte. „Wo ist die Palliser Bucht? Das hört sich ja geheimnisvoll an“, sagte Dr. Lizette, und der junge Kollege begann seine Geschichte von vorn, die die Kollegin aufregend fand. Als er nach der verkürzten Rückschau wieder beim Sturmläuten der kleinen Kirchturmglocke angekommen war und Dr. Ferdinand wieder das Heulen der Sirenen im Ohr hatte, ließ die OP-Schwester durch eine Schülerin ausrichten, dass der Patient auf dem Tisch lag, womit die Geschichte abgebrochen wurde, was Dr. Lizette, die da offensichtlich ihre Phantasie schon spielen ließ, gar nicht gefiel. Sie gingen an die Arbeit zurück, die bei den Chirurgen mit dem Händewaschen und bei Dr. Lizette mit den Vorbereitungen der Narkose begann. Die OP-Schwester hatte gewechselt, da die Mittagspause eingesetzt hatte, und so war es nun eine jüngere, die sich selbst im grünen Kittel ein hübsches Gesicht bewahrte. Es blieb eine Probelaparotomie (diagnostische Eröffnung der Bauchhöhle) im wahrsten Sinne des Wortes, da das Karzinom nicht nur den Großteil des Magens erfasste, sondern bereits inden Querdarm eingewachsen war und dazu noch große Metastasen in der Leber und weitere Metastasen im großen Netz und in zahlreichen Lymphknoten gesetzt hatte. Diesem Patienten, der so alt noch nicht war, hatte das Schicksal nur noch eine kurze Frist gegeben. Dr. Ferdinand übergab Nadelhalter und Pinzette dem jungen Kollegen und assistierte ihm beim Zunähen der Bauchwandschichten. „So ein Kranker würde wahrscheinlich auf das Sturmläuten der kleinen Kirchturmglocke an der Palliser Bucht nicht mehr reagieren“, meinte Dr. Ferdinand nachdenklich, als der junge Kollege die vorletzte Hautnaht setzte.
Es gab einen Riesenknall, Boden und Wände wackelten, in der OP-Lampe gingen die Lichter aus, im OP-Raum und dem angrenzenden Waschraum war es schlagartig dunkel, die Instrumente auf dem Instrumententisch klapperten metallisch und der Tisch verrollte sich in der Dunkelheit. Knall und Erschütterung glichen einem Erdbeben, dessen Wucht das Hospital in Stücke geschlagen hätte, wenn das Epizentrum nur ein bisschen näher gewesen wäre. Da es nicht das erste Mal war, dass ein solcher Schlag durch Mark und Bein fuhr, meinte Dr. Ferdinand, als eine Schwester die Markise vor dem Fenster hochzog, um das Tageslicht in den OP-Raum zu lassen, dass sich da offenbar wieder eine Granate verflogen hatte. Der junge Kollege hatte sich dennoch erschrocken und sagte, als er sich wieder gefangen hatte, dass die Palliser Bucht vor derartigen Beben relativ sicher sei. Dr. Lizette stand der Schrecken noch im Gesicht, als sie in den abgedunkelten Teeraum kam, sich auf einen der verschlissenen Stühle fallen ließ, tief ausatmete und mit ruhiger werdender Atmung feststellte, dass das Hospital noch einmal gut davongekommen sei. Sie drückte ihre Erleichterung aus, dass die Operationen noch rechtzeitig beendet wurden, da es ihr schwer gefallen wäre, unter solchen Schlägen eine vernünftige Narkose zu geben. Dr. Ferdinand nahm diesen Schlag dagegen gelassen hin, da er bereits in seiner Kindheit mit solchen Schlägen vertraut gemacht wurde. Sie verließen das „theatre“, und Dr. Lizette machte sich auf den Heimweg, um ihre Mahlzeit zu Hause zusammen mit ihrem Mann einzunehmen. Dr. Ferdinand und der junge Kollege schauten auf dem Weg zur Kantine ins „Outpatient department“ herein, um sicherzugehen, dass dort keine Verletzten waren, die vom Schlag getroffen wurden. Da es nicht der Fall war, gingen sie erleichtert in Richtung Mittagessen und stellten sich in die Reihe, um ihre Teller mit einem Stück Fleisch und zwei großen Küchenlöffeln voll Reis gefüllt zu bekommen, über den eine scharfe Sauce aus einer noch größeren Kelle gekippt und die zwei halben Pumpkins gelegt wurden. Das Fleisch war zäh, der Reis versalzen und die Sauce so scharf, dass nach den ersten Bissen die gesüßte Chemie mit Orangengeschmack herhalten musste, um das Salzig-Bittere des Gekauten und Geschluckten geschmacklich zu neutralisieren. Dr. Ferdinand konnte diese Kost nicht fertig essen, dafür fehlte ihm noch die Zähigkeit, um das zähe Fleisch mit dem stumpfen Messer klein zu kriegen, und der Zunge die Abgebrühtheit, so viel Salz und so viele Bitterstoffe über sich rutschen zu lassen und ohne ein Würgegefühl in die Speiseröhre hereinzuschieben. Er trank bereits die dritte Tasse der Süßchemie und fand es beachtlich, dass der junge Kollege seinen Teller sauber räumte, dem er, was das Essen betraf, Disziplin mit der nötigen Zähigkeit und Abgebrühtheit der glossalen Geschmacksrezeptoren bescheinigen konnte. „Wie geht es denn dem jungen Ehepaar an der Palliser Bucht?“, fragte er nun den jungen Schriftsteller, der vorhin im Teeraum nicht zu einer eingehenden Schilderung gekommen war. „Wie ich schon gesagt hatte“, setzte der junge Romancier an, „die Frau erwartet ihr erstes Baby, und der Mann hat eine Arbeit als Kfz-Mechaniker in Wellington gefunden, die er nun schon seit einigen Monaten ausführt. Er stellt sich bei der Arbeit geschickt an, und der Meister ist mit ihm zufrieden. Doch das Geld, das er am Monatsende in einem Umschlag mit einem Lohnzettel ausgehändigt bekommt, ist knapp, fast zu knapp, um die kommende Familie über Wasser zu halten, zumal er die Kosten für die tägliche Hin- und Rückfahrt selbst zu tragen hat. Da aus dem Dorf nur gelegentlich mal jemand nach Wellington fährt, hat er ein kleines Gebrauchtauto in einer anderen Garage erstanden, das er mit monatlichen Raten abstottert. Die beiden Zimmer, die er und seine Frau bei dem alten Bauern am Dorfrand zur Miete bewohnen, verschlingen einen weiteren Teil des Geldes, so dass es lediglich zu einem Tisch mit zwei Stühlen reicht, aber noch nicht zu einem ordentlichen Bett und zu neuen Kleidern. Sie schlafen weiterhin auf einer geliehenen Matratze auf dem Boden, was der Mann seiner Frau nach den Monaten eigentlich schwer zumuten kann. Er hatte mit dem Meister wegen einer Lohnerhöhung gesprochen, was dieser aber erst nach Ablauf des Probejahres ins Auge fassen will. So dauert die Durststrecke länger als erwartet, und das Essen auf dem Tisch nimmt sich dementsprechend bescheiden aus. Die junge Frau ist im vierten Monat schwanger, und die Dorffrauen sehen es ihr an, die sie seit einiger Zeit grüßen, wenn auch ohne größere Anteilnahme, um dem Gebot der Nächstenliebe Folge zu leisten. Die Männer betrachten ihre Schönheit mit den vollen Brüsten, wenn sie lächelnd an ihr vorübergehen und denken nicht an eine Schwangerschaft. Sie haben den Sex im Hinterkopf, wenn sie mit dem Vorderkopf freundlich grüßen. Die junge Frau spürt es, deshalb holt sie den Stuhl erst dann vors Haus, wenn die Männer aufs Feld gegangen sind, um sich eine Bluse und einen Rock mit weiterem Umfang zu nähen. Das Dorfleben hat also geldliche und männliche Probleme, geldlich, weil das Probejahr noch sechs Monate dauert, männlich, weil die gut genährten Männer des Dorfes nicht ausgelastet sind und ans Bumsen denken. Da kann der junge Ehemann die schwangere Ehefrau nur schwer allein lassen, wenn er sich jeden Morgen kurz nach fünf mit seiner gebrauchten Hippe nach Wellington auf den Weg macht und abends erst gegen acht zurückkommt.“ „Geld und das Geschlecht, die uralten Balken im Auge“, dachte Dr. Ferdinand, als er nach dem Pastor fragte. „Der nimmt sich für die junge Frau auffallend viel Zeit“, fuhr der Romancier fort, „wenn er sich den zweiten Stuhl aus dem Zimmer holt und sich ihr gegenübersetzt, um Stunden mit ihr zu sprechen. Das muss ich noch herausfinden, warum der das so regelmäßig und geduldig tut, ob er das ihres gläubigen Herzens wegen oder ihrer vollen Brüste wegen macht. Er könnte sich ja neben sie setzen, wenn es um den Glauben geht, und ihr nicht ständig auf die strammen Brüste sehen. Jedenfalls läuft die Dorfschiene noch nicht so gerade, wie man sich die Schiene ursprünglich vorgestellt hat. Die einzige Erleichterung besteht darin, dass das Zusammenleben zwischen schwarz und weiß hier möglich ist, was in Südafrika undenkbar wäre.“ Dr. Ferdinand hatte verstanden, dass in dem kleinen Dorf an der Palliser Bucht die Schönheit der jungen Frau das Problem war, wobei die Hautfarbe keine Rolle spielte.
Der freundliche Küchenwärter stand schon an der Tür, um sie von innen abzuschließen und den Küchenwagen mit den leeren Töpfen, Schüsseln, Tellern und den Schöpf- und Essbestecken zur Hauptküche zurückzufahren. Die Topf- und Schüsselreste waren in kleine Töpfe abgefüllt, die unauffällig in der Teeküche verblieben, damit es in der Hauptküche keine Missverständnisse bezüglich der erforderlichen Mengen gab. Diese erweiterte Mengenlehre der zweiten Instanz der Teeküche hatten sich die freundlichen Wärter ausgedacht, die das Denkresultat für sich in Anspruch nahmen, das weitere Verteilungsprinzip unter sich ausmachten und das Eingetopfte als ein essbares Dankeschön für sich und ihre Familien mit nach Hause nahmen. In welcher Küche wurde das nicht getan, dachte Dr. Ferdinand und erinnerte sich mit einem Schmunzeln an etliche Küchenmänner und Küchenfrauen, die mager in der Küche begonnen hatten, nach wenigen Monaten der Küchentätigkeit die Magerkeit durch das beständige Nachfüllen ablegten und nach ein oder zwei Jahren nicht wiederzuerkennen waren. Auf dem Weg zum „Outpatient department“ kam ihnen der Superintendent mit rotem Kopf entgegen, da er auf dem Weg zum ärztlichen Direktor war. Er grüßte fast geistesabwesend, denn seine Gedanken waren ihm vorausgeeilt, so dass Dr. Ferdinand die Röte in seinem Gesicht verstand, die sich bei einem Spitzengespräch im Büro der höheren Klasse intervallartig mit der Blässe infolge verminderter Blutzufuhr durch emotionale Engstellung der Hirn- und Kopfarterien abwechselte. Sie erreichten den Untersuchungsraum 4 und hatten ihre gewohnten Plätze am Tisch eingenommen, wobei der junge Kollege Dr. Ferdinand gegenübersaß. Es gab reichlich zu nähen und zu gipsen, was er dem jungen Kollegen in einfachen Fällen überließ, der von Tag zu Tag diagnostische und praktische Fortschritte machte und mit zunehmender Selbständigkeit in kurzer Zeit die Erfahrungen sammelte, die er später gut gebrauchen konnte. Es kam hinzu, dass Dr. Ferdinand häufig in den chirurgischen Untersuchungsraum gerufen und um Rat gefragt wurde, weil es dort auch nur junge Kollegen gab, die klinisch noch im Lernstadium waren. Es wurde ihm nicht zu viel, beides zu tun, auch wenn er abgespannt war durch die anstrengenden Operationen der letzten Nacht und des Tages und den Schlaf nötig hatte, was man ihm deutlich ansehen konnte. An diesem Nachmittag saß die alte Frau vor ihm, die ihn nach dem Ostergottesdienst vor der finnischen Missionskirche so herzlich begrüßt und sich für die gute Behandlung bedankt hatte. Die Tochter führte sie nun mit einem Bruch des linken Handgelenks in diesen Raum, den sie sich nach einem Sturz am Ostermontag zugezogen hatte. Die Patientin kannte Raum und Behandlung noch vom ersten Mal. Sie legte sich auf die Liege im Gipsraum, ertrug den Einstich der Nadel zur örtlichen Betäubung, die Einrenkung des Bruchs mit dem kräftigen Daumenzug und das Anlegen des Gipsverbandes wortlos, ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken. Eine tapfere Frau, von der jüngere Frauen viel lernen konnten. Dr. Ferdinand bewunderte diese Tapferkeit. Eine Mutter saß auf dem Schemel, die ihr vierjähriges Töchterchen auf dem Schoß hatte, dessen rechter Fuß entzündet und geschwollen war, nachdem es vor einer Woche in einen Dornbuschast getreten war. Es hatten sich wässrige Blasen unter der Haut der Fußsohle gebildet, in denen noch drei Dornen steckten. Er öffnete die Blasen im kleinen OP-Raum, fasste mit einer Klemme die Dornenden und entfernte sie, während die Mutter die Hände des auf dem OP-Tisch liegenden Kindes hielt und es tröstete. Der Fußverband war angelegt, als es noch die Spritze gegen den Wundstarrkrampf bekam, und Dr. Ferdinand die erforderlichen Antibiotika im Gesundheitspass eintrug. Ein alter Mann wurde vom Sohn gebracht, der mit einem Panga Buschäste abgeschlagen hatte und sich dabei den linken Zeigefinger amputierte. Der Finger hing noch an einer dünnen Hautbrücke, an der er abgetrennt, das Grundglied gekürzt und der Fingerstumpf mit den überstehenden Hautlefzen gedeckt wurde. Der junge Kollege zeigte ihm das Röntgenbild einer ausgekugelten Schulter, und Dr. Ferdinand sah ihm zu, wie er den Arm fasste und den Oberarmkopf durch die logischen Drehbewegungen nach der Kocher’schen Rotationsmethode ins Gelenk zurückreponierte. Dr. Lizette, die nachmittags im chirurgischen „Outpatient department“ aushalf, kam mit einem Patienten herein, der einen Hauttumor über der linken Wange hatte, der bereits geschwürig zerfiel und den Geruch der Fäulnis verbreitete. Sie fragte, ob da chirurgisch noch etwas zu machen sei. Da der Patient so alt noch nicht war, bejahte Dr. Ferdinand ihre Frage, um dem Patienten das Leben zu erleichtern, auch wenn dem Tumor die Eigenschaften der Bösartigkeit von Weitem anzusehen waren. Er erklärte dem Patienten, dass der Tumor bereits weit fortgeschritten war und im Gesunden ausgeschnitten werden musste, wo dann der große Hautdefekt durch ein Transplantat zu decken war. Die Schwester übersetzte ihm die operative Vorgehensweise in seine Sprache, der es dann auch verstand und in die Operation einwilligte. Dr. Ferdinand konnte ihm trotz des aufwändigen Eingriffs eine Heilung nicht versprechen, ihm aber eine Linderung der Symptome zusagen. Die Schwester übersetzte ihm die vorgetragenen Vorbehalte bezüglich einer Heilung. Der Patient dachte darüber einen Augenblick nach und änderte seine Meinung nicht. Dr. Lizette setzte seinen Namen auf die chirurgische Liste und ging mit dem Patienten zum chirurgischen Untersuchungsraum zurück. Dr. junge Kollege reichte ihm das Röntgenbild einer Männerhand über den Tisch, auf dem die Dreiecksfraktur an der Basis des ersten Mittelhandknochens zu sehen war, die den Namen „Bennett-Fraktur“ trug, nach dem irischen Arzt Edward Bennett, der diesen Bruch um die vorletzte Jahrhundertwende das erste Mal beschrieb. Dr. Ferdinand erklärte ihm das besondere Problem, dass diese Fraktur mit einem Gipsverband nicht zu stellen war und einer operativen Einrichtung bedurfte, in der das kleine Basisfragment durch zwei „eingeschossene“ Drähte am Mittelhandknochen des Daumens gehalten werden musste. So wurde der Patient stationär aufgenommen und sein Name auf die orthopädische Liste gesetzt. Drei Ovahimbafrauen mit freien Oberkörpern und ledernen Lendenschürzen, die Schmuckbänder und -reifen an Armen und Beinen oberhalb der Knöchel trugen, betraten den Raum, der sich im Nu mit einem scharfen Geruch füllte, der von ihrer mit Rinderfett eingeschmierten braunen Haut ausging. Diese Frauen waren mit einem Ambulanzwagen aus dem zweihundertachtzig Kilometer entfernten Kaokoland im Westen gebracht worden. Die beiden jüngeren Frauen halfen der alten auf den Schemel, die einen Gehstock in der rechten Hand hielt. Dr. Ferdinand kämpfte vergeblich gegen den scharfen Hautgeruch an, der noch penetranter wurde, als ihm eine der jüngeren Frauen den rechten Fuß der alten Frau fast unter die Nase hielt, was er nicht verriechen konnte. Das von tiefen Rissen durchzogene Schwielenmuster der Fußsohle war ein eindrückliches Abbild des steinig-sandigen Wüstenbodens, dessen Tentakel immer tiefer zwischen das verbliebene, sich auszehrende Buschwerk griffen. Die Fußsohle erzählte die Geschichte vom eimerweisen Wassertragen über weite Entfernungen durch ein langes Leben. Die alte Frau, deren Brüste als leere Hautfalten schlaff herunterhingen, betrachtete Dr. Ferdinand ungläubig. Sie traute ihm weit weniger zu als dem traditionellen Medizinmann im Busch, dem „Traditional healer“, den sie ihr Leben lang aufsuchte, wenn ihr oder ihren Kindern etwas an der Gesundheit fehlte. Dr. Ferdinand hatte sich einen Handschuh übergezogen und betastete den Fuß mit seinen schrundig zerschundenen, mageren Zehen, von denen der zweite bis fünfte die Zeichen der gestörten Durchblutung hatten. Ihre Kuppen waren bereits schwarz verfärbt und beim Betasten hart wie gegerbtes Leder. Er konnte ihr da auch nicht viel Hoffnung machen und dachte sich, dass der „Traditional healer“, den sie sicherlich vorher aufgesucht hatte, es schon mit seinen Eingebungen aus Mixturen von gepressten Kräutern, zerkleinerten Wurzeln, fein geriebenem Rinderhorn und Knochenmehl probiert hatte, die zusammen in einem verbeulten Blechtopf, dem der Ruß des häufigen Gebrauchs anhaftete, vermengt und mit etwas Wasser unter Einstreuen von Kieselsalz und kleinen Baumrindenstückchen auf offenem Feuer so lange gekocht wurden, bis eine dunkle Brühe daraus entstand, deren Dampf bereits zum Himmel stank. Der kundige Medizinmann mit der langen Tradition und dem Wissen von den natürlichen Heilkräften musste es mit seinen Heilsprüchen schon versucht haben, sonst säße die alte Frau nicht am Schalter der westlichen Schulmedizin. Dr. Ferdinand schaute sie an, und seine Augen sagten ihr voraus, dass da außer Amputationen nichts zu machen war. Die Frau mit dieser geprägten Sohle war eine stolze Frau, die sich von diesem Doktor nicht mehr an ihren Zehen herumfummeln lassen wollte. Sie rief ihre Töchter, ihr beim Aufstehen unter die Arme zu greifen, nahm selbstbewusst den Stock in die rechte Hand und verließ, ohne zur Seite zu blicken, den Untersuchungsraum auf Nimmerwiedersehen. Dr. Ferdinand war von so viel Stolz beeindruckt. Er verstand, dass so etwas Großes nur in der Wüste wachsen und sich halten konnte, weitab von der westlichen Zivilisation mit all den Verkrümmungen und Verkümmerungen, wo das Geld zählte und der technische Fortschritt das Maß der Dinge war. Bei der ausgezehrten Frau war der Mensch nach einem langen Leben im Ringen um Wasser innerlich noch groß und stark, der sich in der verfetteten westlichen Gesellschaft schon längst im Luxus verabschiedet und zu einem lächerlichen Zwerg verbogen und meinungslos verschrumpft hatte. Es war die Fußsohle mit der eingetretenen Landschaft, die sich einer westlichen Betrachtungsweise entzog, eine westlich ausgerichtete Schulmedizin ablehnte, die ja ohnehin nur noch die Amputation der Zehen oder gar des ganzen Fußes anzubieten hatte. Dafür war sich dieser Fuß allerdings zu schade, weil er zum Wasserholen gebraucht wurde. Die alte Frau wusste, dass es ohne Wasser kein Leben gab, und darum wollte sie den Fuß bis zu ihrem Ende behalten, wofür sie die Vertrocknung der Zehen für den Rest ihres Lebens in Kauf nahm. Sie hatte sich die Entscheidung selbst vorbehalten, dass an ihrer Würde, und dafür brauchte sie noch den Fuß, keiner herumzufummeln hatte. So ließ sie sich von den Töchtern äußerlich führen, indem sie innerlich fest blieb und da nicht mit sich reden ließ. Die Töchter wiederum kannten den Menschen in der Mutter und widersprachen ihr da mit keinem Wort, während sie geradeaus blickend durch die Tür humpelte, als hätte sie es vorher gewusst, dass die weite Reise zum Hospital sinnlos war und nur unnützes Geld kostete, was sie besser hätte verwenden können. Dr. Ferdinand mit seiner westlichen Ausbildung und Denkweise zog da seine Lehre, dass nicht alle Menschen, besonders jene nicht, deren Fußsohle eine solch eingetretene und gegengedrückte Geschichte von der Kostbarkeit des Wassers erzählte, das von weither geholt werden musste, der Schulmedizin mehr Glauben schenkten oder ihr das noch zutrauten, was der „Traditional healer“ mit seiner großen Kenntnis der natürlichen Heilkräfte nicht mehr konnte. Er legte sich diese Notiz ins Hinterstübchen seiner Erinnerungen. Für ihn war es ein merkwürdiger Nachmittag, weil ein willensstarker Mensch vor ihm auf dem Schemel gesessen hatte, dem man mit solchen Sachen, die er doch mühsam an der Universität gelernt und unter den kritisch prüfenden Blicken bebrillter Professoren so ausführte, weil es anders nicht gemacht werden durfte, hier nicht kommen konnte. Er hatte etwas gelernt, was an der Universität nicht gelehrt wurde. Er hatte es vorausgeahnt, dass sich die Medizin auf dem sandig-steinigen Boden an den Grenzen der Wüste stößt. Er hatte aber nicht geahnt, dass sich das Leben und Denken in der Wüste so stark vom europäischen unterschied. Das war ihm eine afrikanische Lehre, die er nur hier lernen und nur auf diesem Boden verstehen konnte.
Er machte sich auf den Heimweg und schaute vorher noch in die „Intensiv“-Station hinein, um sich vom Leben der kritischen Patienten ein letztes Bild zu machen, denen seine besondere Aufmerksamkeit galt. Er hatte sich die Patienten angesehen und die Eintragungen in den Krankenblättern gemacht, als ihm die Schwestern, die ihn bei der Saalrunde begleiteten, von dem großen Erdtrichter berichteten, den die „verirrte“ Granate am Morgen nicht weit vom Hospitalgelände aufgerissen hatte, wobei zwei Häuser zerstört und fünf Menschen getötet wurden und es zu Verletzten erst gar nicht kam. Die gewaltige Detonation hatte einige Risse durch die Wände zwischen den Patientenräumen und neben dem Untersuchungsraum gezogen, in dem der weiße Kollege mit dem Burenkopf und dem blassen Gesicht, der für die Augenheilkunde kam und sich den Privatpatienten hingab, so dass die Tür zu diesem Raum klemmte und nicht zu öffnen war. Der emsige Kollege mit dem besonderen Sinn fürs Geld hatte sich schließlich mit seinem ganzen Körpergewicht gegen die Tür geworfen, um sie zu öffnen, wobei er mit seinem Hintern ein großes Loch in die Füllung schlug, darin hängen blieb und mit seinem Hintern in der Tür schon im Untersuchungsraum war, während Kopf, Arme und Beine noch draußen im Korridor waren. Er hatte sich in der Türfüllung regelrecht verklemmt und war auch mit dem unteren Teil des Rückens schon im Untersuchungsraum, weil sich der Hintern bereits weit durchgestoßen hatte. Die Schwestern der Frühschicht sahen ihn hilflos wie einen eingeknickt zusammengestauchten Gartenzwerg in der Tür sitzen, der sich nicht befreien konnte. Sie riefen den Fahrer der Ambulanz, der zufällig im Saal war, um nach einem Patienten zu sehen. Gemeinsam zogen sie den eingeklemmten Doktor aus der Tür. Es war eine schwierige Befreiungsprozedur, die länger dauerte. Schließlich stand er mit zerrissenem Hemd und über dem Gesäß eingerissener Hose vor der eingedrückten Füllung und sah durch das Loch auf den Boden des Untersuchungsraums. Dem Fahrer war es dann gelungen, mit einem Metallhebel, den er zwischen Tür und Rahmen setzte, die Tür aus dem Schloss zu brechen und mit einigen wuchtigen Schlägen aufzudrücken. Dr. Ferdinand hätte lachen müssen, wenn die Situation nicht so ernst gewesen wäre, und wiederholte den Satz, den Dr. Lizette unmittelbar nach der Erderschütterung mit erschrockenem Gesicht ausgesprochen hatte, dass das Hospital da noch einmal gut davongekommen sei. Er wünschte den Schwestern eine ruhige Nacht und machte sich auf den Weg. Die Sonne neigte sich dem Horizont zu, lag ihm auf, versank dahinter, schickte noch feuerrote Strahlen in den Abend und ließ sie am Himmel des alten Tages vergleißen. Dr. Ferdinand nahm den längeren Weg, um den Heimweg mit einem Spaziergang zu verbinden, und prägte sich das Muster der Schlaglöcher auf der ausgefahrenen Straße ein. Er zeigte sein „Permit“ an der Schranke zum Dorfeingang vor, wo ihn der Wachhabende, der schon am Morgen hier stand, ungläubig wegen seiner Schlaflosigkeit ansah und ihn fragte, ob er denn nicht müde sei und wenigstens diese Nacht schlafen wolle. Dr. Ferdinand lächelte ihn an und sagte, dass er seinen Rat diese Nacht befolgen werde. Er streifte sich die Sandalen mit den weich geschwitzten Korksohlen in der Veranda ab und wusch den Schweiß von den Füßen. Er machte sich einen Kaffee, setzte sich mit der Tasse auf die Treppenstufe vor der Veranda und zündete eine Zigarette an. Es war ein langer Tag, ein aufregender und lehrreicher dazu. Der Boden bebte, doch die Füße konnten von ihm nicht lassen. Der Fuß der alten Frau mit der rissigen Sohle und den vertrockneten Zehen nahm es unerschrocken hin, weil für sie das Beben zum Leben gehörte wie das Wasser zum Trinken. Er sah zwei spielende Hunde auf der Straße, von denen der größere ein Aststück in der Schnauze schleppte und der kleine bellend hin und her und über die auslaufenden Verzweigungen des Astes sprang, die beim Schleifen mit dem Knacklaut des Vertrockneten weiter zerbrachen. Er sprang an dem großen hoch und biss ihm ins Ohr, weil er dem kleinen nichts von dem Ast abgab, ihn lieber zerspleißen ließ. Da kam ein Mann, der eine noch größere, schwarz-weiß gescheckte Dogge an der Leine führte, die das Astschleifen interessiert verfolgte. Sie war stark und sprang mit einigen Sätzen von einer Straßenseite zur anderen, wobei sie den Halter gleich mitzog, der über die Straße rutschte, als drehte er auf Schlittschuhen eine Kurve übers Eis. Die beiden kleineren bekamen es mit der Angst zu tun, der kleinste sprang bellend um die Dogge herum, machte den Abstand jedes Mal größer und versprang sich in den Straßengraben, aus dem er heiser herausbellte und wieder zum Vorschein kam. Der größere der beiden legte den Ast ohne Frage aus der Schnauze, den die Dogge an der dicksten Stelle packte und das verzweigte Gestänge wie ein schief gestelltes Geweih hochhielt, als sie und der Leinenhalter davongingen, der sein Leinenende zweimal um das Handgelenk schlang, um sich die Führung zu sichern. Die Dämmerung schritt voran, und die Kolonne der fünf „Eland-90“ nahm vor dem Haus die rechtwinklige Linkskurve, um ihre abendliche Patrouille zu fahren. An dieser Regelmäßigkeit hatte sich bislang nichts geändert, und Dr. Ferdinand hätte seine Uhr danach stellen können. Seine Gedanken gingen noch bei dem jungen Schriftsteller vorbei, der da nach dem erdbebengleichen Granateneinschlag sagte, dass die Palliser Bucht vor derartigen Beben relativ sicher sei. Überhaupt machte der junge Kollege Fortschritte beim Schreiben, wobei der Verlauf der Geschichte, die ihren Ursprung in einer verbotenen Liebesgeschichte nahm, mit der Buntheit menschlicher Facetten und der Verästelung der Gedanken beeindruckte. Dr. Ferdinand schnitt sich in der Küche zwei Scheiben vom Brot ab, bestrich sie mit Margarine und legte einige Käsestücke darauf, da ihm die Wurst ausgegangen war. Er aß am kleinen Tisch im Wohnraum und trank die zweite Tasse Kaffee dazu. Nach dem Essen wollte er noch etwas lesen, um dem Tag, der ihm Nachdenkliches gegeben hatte, einen sinnvollen Abschluss zu geben. Er wollte noch einmal den Dingen des Tages nachgehen und sie ordnen, bevor sie im Hinterstübchen der Erinnerung verschwanden. Dazu setzte er sich an den höheren Gartentisch und machte sich Notizen. Er hatte das Hospital vor Augen und sah sich kommen und gehen. Er wunderte sich, dass trotz der Einsamkeit jeder Tag etwas Neues brachte, das ihn belebte und das Leben bedenkenswert machte.
Die Fußsohle spricht die Geschichte ohne Verschönerung; sie ist wahr und eindrücklicher als das Wort es kann. Vom Wasser erzählt die Geschichte vom Durst der Menschen und der Tiere. Die Risse zwischen den Schwielen sagen es: das Wasser kommt nicht aus den Hähnen, es muss gelaufen und getragen werden. Dafür gehen Füße ein ganzes Leben lang, die Entfernungen und Weiten nehmen, die nicht leicht aufzusagen sind.
Dr. Ferdinand las es noch einmal durch und fügte folgende Stichworte hinzu:
Ein alter Fuß, dessen Zehen ausgetrocknet sind. Eine alte Frau lässt sich an ihren Zehen nicht rumfummeln. Die Tentakel der Wüste drücken sich in der Fußsohle ab. Der Fuß ist für die Würde des Menschen unerlässlich. Wenn der Fuß spricht, schweigt der Mund, die Fußsohle spricht die Wahrheit, wohin die Füße das Leben auch tragen.
Er ließ es dabei bewenden und legte sich ins Bett. Einschlafen konnte er so schnell nicht, da ihm die Stichworte im Denkstübchen durcheinander schwirrten, von denen jedes ein Buch wert wäre, wenn die Menschen fähig wären, solche Füße zu betrachten und sich für ihre Wahrheit interessierten, denn Füße lügen nicht. Er sah ein Heer von Füßen auf sich zukommen, Füße von Männern, alten und jungen Frauen und Kindern, und alle drückten sich vor seinem Auge ab. So viele Füße auf einmal hatte er noch nie gesehen, wobei jeder Fuß sich anders an der Sohle verschwielte und verriss. Nur die kleinen Kinder, die erst mit dem Laufen begannen, hatten dort noch eine zarte Haut. Die Zehen der alten Füße hatten ihre eingetretenen Schrunden, bei einigen fehlte der eine oder andere Zeh, auch waren einige an den Kuppen schon schwarz, diese ließ das Leben an den Felsklippen verstoßen. Es war eine Fülle von Abbildern, die sich da vor seinem Auge abdrückten, und jeder Fuß erzählte seine Geschichte vom Leben auf dem sandig-steinigen Boden und von der Stärke des Lebenswillens. Zwischen den Füßen schaute er hoch zu den Köpfen, die an diesem Willen keinen Zweifel ließen. Den Sohlenbildern gemeinsam war das eingedrückte Muster der weiten Wege zur Lebensquelle, dem Wasser, und diese Muster trogen nicht. Sie prägten so plastisch den Ablauf des Lebens, dass jedes Wort dagegen platt und bedeutungslos war, weil Worte es so plastisch nicht brachten. Jeder Fuß hatte seine Wahrheit und seinen eigenen Stolz, so dass ein ganzes Leben nötig gewesen wäre, um die Fußgeschichten mit dem Abbild dessen zu erzählen, was da die ausgreifenden Tentakel der wachsenden Wüste zwischen dem versandenden Buschwerk und den austrocknenden Bäumen in die Fußsohlen drückten. Die letzten Füße bildeten sich noch ab, als er sie nicht mehr fasste und in die Tiefen des Schlafes versank.
Die Hähne krähten mit gewohnter Regelmäßigkeit, und doch hatte Dr. Ferdinand verschlafen, weil er den ersten Ruf verträumt hatte. Er sprang aus dem Bett, kürzte das Brausen auf wenige Minuten ab, machte sich auf den Weg und dachte an eine Tasse Kaffee, zu der es nicht mehr reichte. Er legte einen Schritt zu und passierte den Kontrollpunkt leicht außer Atem, was einer der Wachhabenden als sportliche Betätigung ansah, während der von gestern ihn fragte, ob er an diesem Morgen ausgeschlafen sei, sich persönlich von den verbliebenen Schlaffalten im Gesicht des Arztes überzeugte und ihm dieses Gesicht schon besser abnahm. Er hastate am Pförtner vorbei, der ihm den Morgengruß schenkte, was ihm erst einfiel, als er den Vorplatz überquert und die „Intensiv“-Station betreten hatte. Es war halb sieben, und die Schwestern der ausgehenden Nachtschicht wunderten sich wie am Morgen zuvor über sein verspätetes Kommen. Er redete sich nicht heraus und sagte, dass er es verschlafen hatte, was die Schwestern seinem Gesicht auch glaubten. Einige der Patienten konnten auf die allgemeinen Säle verlegt werden, da sich ihr Zustand deutlich gebessert hatte. Die Runde durch die anderen Säle kürzte er ab, denn er wollte nicht der Letzte sein, der zur Morgenbesprechung kam, auch wenn ihm das Gequassel über die Sicherheit des Hospitals auf die Nerven ging. Auf dem Weg zum Besprechungsraum sprach ihn der schwarze Kinderarzt wegen eines dreijährigen Kindes an, bei dem er die Diagnose eines Darmverschlusses gestellt hatte, was der dringenden Operation bedurfte, bei der er, der Kinderarzt, assistieren wollte. Dr. Ferdinand wollte sich das Kind vorher im Kindersaal ansehen und hatte gegen den Wunsch des Kinderarztes nichts einzuwenden. Sie betraten gemeinsam den Besprechungsraum, der bereits bis auf den letzten Platz gefüllt war, so dass sich die beiden Verspäteten ihre Stühle aus dem Sekretariat holten und sich unweit vom Schreibtisch des Superintendenten setzten, der noch mit seiner Nasentoilette beschäftigt war. Dann putzte er die Gläser der Brille, setzte diese bedeutungsvoll auf die Nase, stopfte das Taschentuch weg und eröffnete die Besprechung. Er kam gleich auf die Unterredung zu sprechen, die er am vergangenen Nachmittag mit dem ärztlichen Direktor hatte und trug Folgendes vor: „Der Direktor ist über die Verschlechterung der Sicherheitslage besorgt. Die Diebstähle aus der Hauptküche, dem Pharmazielager und dem Fuhrparkgelände sind für ihn eindeutige Zeichen der heruntergekommenen Moral und der Kollaboration von Hospitalbediensteten mit Elementen der SWAPO. Er hat die Kriminalpolizei mit einer gründlichen Untersuchung beauftragt und drückte die Befürchtung aus, dass die Kriminalität das Hospital an den Abgrund bringen werde, wenn nicht drakonische Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Der Kommandeur der Koevoet hat ihm seine Unterstützung zugesagt, was bedeutet, dass die Männer dieser Spezialeinheit noch häufiger das Gelände abfahren und kontrollieren werden. Der Direktor ermahnte alle noch einmal eindringlich, an die Verantwortung zu denken, die jeder für die Sicherheit zu tragen hat, und drohte bei jedem Versäumnis mit disziplinarischen Maßnahmen.“ Dazu hatte eigentlich keiner etwas zu sagen, weil es keinem einleuchtete, was die Diebstähle mit der SWAPO zu tun hatten, von der keine Spur zu sehen war, die aber seit Monaten wie ein Geist in den Köpfen des ärztlichen Direktors und des Superintendenten herumspukte. Dr. Lizette drückte die Hoffnung aus, dass die kriminalistische Untersuchung da Licht hereinbringen werde, wer hinter den Diebstählen steckt, denn das mit der zunehmenden Unsicherheit bedrückte sie schon, wenn sie auch an den SWAPO-Spuk nicht so ohne Weiteres glauben wollte. Über die Botschaft des Truppenkommandeurs, die ihm der Major tags zuvor überbrachte, fiel kein Wort. Da schwieg sich der Superintendent aus, als wäre es ein persönlicher Rat, aber noch nicht das letzte Wort gewesen. Die alten Themen kamen auf den Plattenteller: die fehlenden Türschlösser zu den Sälen, die zerbrochenen Fensterscheiben, die gebrochenen Bettgestelle mit den längst ausgelegenen, urinrüchigen Schaumgummimatratzen, die verstopften Toiletten mit den gebrochenen Schüsseln und die verklemmten Wasserhähne. Der Superintendent hörte es das hundertste Mal und machte ein gelangweiltes Gesicht. Ein Wort dazu zu sagen hatte er nicht mehr. Darüber wunderten sich nur die, die neu gekommen waren, wie die philippinischen Kollegen. Es ärgerte aber Dr. Ferdinand und einige andere, die das für eine unverantwortliche Sauerei hielten. Die Matronen schüttelten die Köpfe, nicht etwa, weil sie nicht glaubten, dass es so war, sondern weil sie den Glauben an den Verstand verloren hatten, und daran, dass da zu Lebzeiten noch etwas passierte. Ein Ersatz für den gestohlenen Wasserschlauch zum Abspritzen des Vorplatzes stand ebenfalls noch aus. Dabei hatte die Anschaffung des Schlauches Dr. Witthuhn, als er noch auf dem Stuhl des Superintendenten saß und der Schreibtisch auf der anderen Seite stand, ein halbes Jahr unermüdlichen Einsatz von der Bestellung bis zum Eintreffen gekostet. Dass die Koevoet dann diesen Schlauch buchstäblich gestohlen hatte, belegte ihre rüpelhafte Rücksichts- und Skrupellosigkeit. Wie bei den meisten Morgenbesprechungen war auch diesmal kein Raum für die medizinischen Reporte der vergangenen Nacht, so dass über alles Mögliche gesprochen wurde, was aufgrund der Wiederholung wie bei einer Tretmühle bloße Zeitverschwendung war, aber nicht über das Wichtigste, die Patienten. Der fehlende Informationsaustausch im Rahmen dieser Besprechung hatte für die Patienten schon einige Male tragische Folgen. Die Besprechung war zu Ende ohne ein einziges Ergebnis von Substanz. Dr. Ferdinand gab dem Schweizer Kollegen Recht, der einst diese Besprechungen als Affenzirkus bezeichnete und sich persönlich davon ausschloss.
Dr. Ferdinand ging mit dem Kinderarztkollegen zum Kindersaal, um nach dem kleinen Patienten zu sehen, der am Tropf lag und aus der Magensonde grünbraune Flüssigkeit förderte. Der Bauch war gespannt, eine Rolle zu tasten und auf dem Röntgenbild ein Spiegel im rechten Unterbauch zu sehen. Er hatte sich im Umkleideraum umgezogen, berichtete Dr. Lizette, die im Teeraum bei einer Tasse Tee auf ihn wartete, von der Notoperation und fügte auf der OP-Liste den Namen des Kindes mit Station und Diagnose hinzu. Die Operation sollte als zweite nach der Nagelung einer Oberarmfraktur erfolgen, und so gab er dem Kollegen die ungefähre Zeit an, der schon vor dieser Zeit im „Doctors tearoom“ saß und es sich bei einer Tasse Tee gemütlich machte. Sie gingen zum „theatre 3“, wo der kleine Patient schon auf dem OP-Tisch lag und Dr. Lizette die Narkose einleitete, die bei Kindern in diesem frühen Alter so einfach nicht war. Eine erfahrene Schwester packte das Sieb auf dem Instrumententisch aus und rieb den Bauch mit der braunen Lösung ein. Die Bauchhöhle war eröffnet und die Rolle im rechten Unterbauch zu sehen und zu tasten, wo sich Dünndarm in Dünndarm (Invagination) geschoben hatte. Dr. Ferdinand erinnerte sich noch an die Operation mit der zweifachen Einstülpung, wo ein Großteil des unteren Dünndarms bis hoch zur rechten Dickdarmkrümmung reichte und ein Teil infolge der Gefäßstrangulation abgestorben war und herausgeschnitten werden musste. Der assistierende Kinderarzt sagte wenig bei der Operation, als wäre er mit seinen Gedanken nicht ganz dabei, was in der kritischen Situation mit dem ganzen Durcheinander, in dem sich die Menschen befanden und auf das Ende der weißen Apartheid hofften, kein Wunder war. Der eingestülpte Darm wurde herausgezogen, ohne verletzt worden zu sein. Eine Resektion hatte sich damit erübrigt, was den Eingriff wesentlich erleichterte. Der Kinderarzt hielt bis zur letzten Hautnaht durch, dann verließ er den OP-Raum, nachdem er vorher noch ein Späßchen mit den Schwestern in ihrer Sprache machte und sie damit zum Lachen brachte. Dr. Ferdinand, der junge Kollege und Dr. Lizette setzten ihr Programm im „theatre 2“ fort, wo der äußere Rollhügel, der vom Kondylenmassiv des linken Oberschenkelknochens gebrochen war, in anatomische Position zurückgebracht und mit zwei Schrauben am inneren Rollhügel befestigt wurde. Dabei war auch eines der kräftigen Kreuzbänder zu nähen, die für die Festigkeit des Knies von großer Bedeutung sind. Am Ende der Operation wurde noch eine Gipshülse angelegt, um das Knie für vier Wochen in leichter Beugung ruhig zu stellen. Als letzte Operation kam der vierzehnjährige Junge, der noch wie ein Achtjähriger aussah, dem die unvollständige Knochenbildung das Laufen zeitlebens verbot, der bereits über ein Jahr wie ein trauriger Buddha im Bett saß und seitdem von Vater, Mutter und Geschwistern verlassen war, dem vor einiger Zeit das verstellte rechte Bein im Hüftgelenk abgesetzt wurde, weil er sich beim Sitzen mit dem eingeknickten rechten Fuß ein tiefes Geschwür ins linke Gesäß gedrückt hatte. Diesmal war der große Haut-Muskel-Defekt, der bis zum Sitzbeinhöcker reichte, mit einem Weichteillappen zu decken, was nur mit einer Verschiebeplastik zu machen war. Es war eine mühsame Operation. Der Patient war in Bauchlage auf dem OP-Tisch, und das kontrakte linke Bein war ständig im Wege. Es dauerte gut zwei Stunden, bis sie beendet war, der Patient auf die Trage herübergehoben und auf der Seite liegend in den Aufwachraum gefahren wurde. Für Dr. Ferdinand war es ein Schlag aufs Auge, den Patienten nach dieser schwierigen plastischen Operation dann im Bett auf einem verdreckten Bezug und der ausgelegenen, stinkenden Schaumgummimatratze zu finden. Er konnte es nicht verstehen, wenn die pflegerische Nachsorge der Schwere der vorangegangenen Operationen nicht entsprach. Die Schwestern hätten einen frischen Bezug überziehen können. Eine neue Schaumgummimatratze, die konnten auch sie nicht beschaffen, denn in Sachen Matratzen geschah seit Jahren nichts. Der Superintendent bat Dr. Ferdinand, zwei Leichenöffnungen in der „Mortuary“ hinter dem Polizeigebäude vorzunehmen. Ein weißer Polizist mit einer breiten Offiziersepaulette, dem vielleicht noch zehn Jahre bis zur Pensionsgrenze fehlten, fuhr ihn in einen Seitenhof eines Komplexes aus zwei parallel gestellten Flachbauten ganz in der Nähe des zweiten Wasserturms mit den zwei MGs auf dem Dach, etwa hundert Meter hinter der Sperrschranke des zweiten Dorfausgangs. Um dorthin zu gelangen, fuhr er zwischen zwei von sechs „Casspirs“ durch, die sich am Straßenrand so dicht hintereinander aufgestellt hatten, dass beim Durchfahren zwischen dem vierten und fünften „Casspir“ auf beiden Seiten nur wenige Zentimeter bis zu den kantig stählernen Stoßstangen fehlten. Der Seitenhof war von Leuten der Koevoet gefüllt, die in grauen Uniformen herumstanden oder auf ausrangierten Reifen saßen, Zigaretten rauchten, Coca-Cola aus Büchsen tranken, die Stummel in die geleerten Büchsen warfen und beides in die Felgenöffnung der Reifen oder, einfacher, in Richtung eines großen Baumes schmissen, der ihnen den Schatten dazu gab. Im Leichenraum stand ein Sektionstisch aus Stahlblech, dem eine große Wand mit etwa dreißig kleinformatigen Kühlschranktüren gegenüberlag. Auf dem Tisch lag ein Toter, bei dem das Alter mit dreißig angegeben wurde. Er war schwarz und hatte eine scharf geschnittene Wunde über dem Scheitel, als wäre sie mit dem Panga gemacht. Der Sektionsgehilfe, ein schwarzer Koevoetmann, entfernte das blutig eingerissene Hemd, wobei eine Stichwunde am linken Brustkorb zum Vorschein kam, dann die blutig verschmierte Hose und die kotig eingeschmierte, graue Unterhose. Der Gehilfe verfügte über die nötige Erfahrung und eröffnete Brustkorb und Bauch in wenigen Zügen, wobei er die Rippen auf beiden Seiten an der Knorpel-Knochen-Grenze mit einem Messerschnitt durchtrennte. Dr. Ferdinand eröffnete den Herzbeutel, der mit dunklem Blut gefüllt war, und trennte das Herz von den großen Gefäßen ab. Das Messer hatte die Muskelwand unterhalb der Herzspitze durchstoßen und die vordere Segelklappe in der linken Herzkammer eingeschnitten. Die Innen- und Außenhaut des Herzens waren an der Einstichstelle blutig unterlaufen. Andere Verletzungen am Herzen fanden sich nicht. Der emsige Gehilfe hatte inzwischen das Hals-Thorax-Paket mit den anhängenden Lungenflügeln auf den erhöhten Organtisch gelegt. Dr. Ferdinand trennte Zunge und Speiseröhre vom Kehlkopf und der Hinterwand der Luftröhre ab. Dabei fand er eine Stichverletzung im Unterlappen des linken Lungenflügels, der dem Herzen anlag. Die Schädelhöhle war eröffnet, das Front- und linke Scheitelbein durch den Pangaeinschlag gebrochen, und dunkles Blut hatte sich unter der harten Hirnhaut angesammelt, das sich über die ganze linke Hirnhemisphäre verteilte. Außerdem lag noch eine Hirnschwellung mit Abflachung der Großhirnwindungen vor und hinter der zentralen Hirnfurche zwischen Stirn- und Scheitellappen vor. Dr. Ferdinand schrieb sein Protokoll und erfuhr erst auf Befragen, dass der Tote ein Koevoetmann gewesen war, der angeblich von drei Männern angefallen wurde, von denen er einen erschoss, worauf die beiden anderen ihn mit dem Messer in den Brustkorb stachen und mit dem Panga auf den Schädel schlugen. Dr. Ferdinand fügte diese Angaben ins Protokoll ein und behielt die Fragen, die da unweigerlich auftauchten, für sich, denn er rechnete nicht mit der Wahrheit vonseiten der Koevoet, was den Tod eines Koevoetmannes betraf. Der Gehilfe hatte inzwischen die Organe in die Brusthöhle zurückgelegt und die Haut mit einem kräftigen Faden von oben bis unten in fortlaufender Naht verschlossen. Der Körper wurde vom Tisch genommen und ins Kühlfach geschoben. Die zweite Leiche, die zur selben Zeit wie die erste aus einem anderen Kühlfach gezogen wurde und auf dem Boden lag, kam nun auf den Tisch. Dieser Körper gehörte einem schwarzen Mann von etwa vierzig Jahren, dem der Gehilfe die Kleidung im Nu herunterholte und mit erstaunlicher Fertigkeit die Körperhöhlen öffnete. Hier war es ein Geschoss, das aus kurzer Entfernung aus einer Pistole abgeschossen wurde, welches ihm durch den Kopf jagte und große Teile des Gehirns zertrümmerte. Dr. Ferdinand verfasste auch hier sein Protokoll und unterstrich die Worte „onnatuurlike dood“ (unnatürlicher Tod). Er fragte den Sektionsgehilfen, der wieder seinen Gehilfen fragte, ob dieser Körper jenem Mann gehörte, der einer der drei Männer des Überfalls war, welcher von dem Koevoetmann, dem der erste Körper gehörte, erschossen wurde. Der zweite Gehilfe bestätigte es dem ersten, und beide Gehilfen sagten dem noch protokollierenden Obduzenten, dass es in der Tat so war, was Dr. Ferdinand so hinnahm und doch nicht glauben konnte. Er sagte jedenfalls nichts dazu, las beide Protokolle noch einmal durch, setzte einige Worte dazu und Kommas dazwischen, bis er das Protokollierte schließlich mit seinem Namen unterschrieb. Es war doch über eine Stunde vergangen, als er den Obduktionsraum verließ und die Luft draußen ohne den Todesgeschmack atmete. Die Koevoetleute standen, saßen, rauchten und tranken Coca-Cola aus Büchsen im kleinen Seitenhof, wie sie es vor einer Stunde schon taten. Sie schauten den Doktor argwöhnisch an und bliesen ihm beim Vorübergehen den Zigarettenrauch ins Gesicht, aber direkt sprechen wollten sie mit ihm nicht. Dr. Ferdinand erkannte einige Gesichter von den nächtlichen Razzien im Hospital wieder, was sie überhaupt nicht störte, denn sie waren sich dessen gut bewusst, dass sie auf der Seite der Macht standen, wogegen auch der Doktor nicht ankommen konnte. Die Gelegenheit bot sich, als ein weißer Koevoetoffizier mit tief gebräuntem Gesicht, dunklen Haaren und unrasiert auf Dr. Ferdinand zuging, um ihn zu fragen, was er bei den Obduktionen gefunden hatte. Er sagte es dem Offizier, der gut zuhörte und ihn mit keiner Silbe unterbrach. Am Schluss sagte er noch, dass die Verstorbenen Cousins waren. Er sagte es ganz sachlich, ohne eine Gemütsfaser zu bewegen, und bot Dr. Ferdinand eine Zigarette an. Auf halber Zigarettenlänge sagte der Offizier ebenso sachlich und fast beiläufig, dass der Krieg an Schärfe zugenommen habe. Dr. Ferdinand nahm den Faden auf und kam auf die nächtlichen Razzien zu sprechen. Er schilderte seine Beobachtungen, wie einer der Koevoetmänner einem älteren Mann die Prothese regelrecht vom Bein schlug, dieser sich einbeinig mit den Händen am hinteren „Casspir“-Einstieg festhielt, um nicht zu fallen, wie er von zwei Männern gepackt und wie ein Stück totes Vieh in den „Casspir“ geworfen wurde und ein dritter Mann ihm dann noch die Prothese hinterherschmiss. Das andere Beispiel, das Dr. Ferdinand erwähnte, war der Patient mit der eingerenkten Hüfte, dem ein Koevoetmann den etwas herausstehenden Fuß infolge der gespreizten Beinlagerung mit solcher Gewalt nach innen schlug, dass der Patient vor Schmerzen aufschrie und die Nacht nicht mehr schlief, obwohl er eine Spritze gegen die Schmerzen bekommen hatte. Der unrasierte Koevoetoffizier verzog keine Miene, als er sich die Beschwerden anhörte und eine „Camel“ ohne Filter mit dem braunen Feuerzeug anzündete, das zur militärischen Grundausrüstung zu gehören schien. „Was Sie da sagen, mag schon stimmen“, meinte er, „aber dagegen machen können Sie nichts. Es sind grobe Burschen, die vom Benehmen keine Ahnung haben. Ich habe sie ermahnt, verwarnt, sogar verprügelt. Doch ändern tun sie sich nicht. Sie benehmen sich wie Tiere, als kämen sie gerade von den Bäumen runter.“ Dr. Ferdinand wollte es so nicht hinnehmen: „Dann müssen sie im Umgang mit Menschen eben unterrichtet und nicht nur ermahnt und verprügelt werden. Sie sollten von Leuten geführt werden, die vom Menschen etwas verstehen, besonders dann, wenn sie ihre Razzia im Hospital durchführen.“ Hier interessierte ihn, was der Koevoetoffizier von diesen Razzien hielt, und er fragte ihn nach seiner Meinung. „Offen gesagt, nichts“, antwortete er und begründete es damit, dass bislang noch kein SWAPO-Kämpfer dort gefunden wurde, und er persönlich an diesen Spuk nicht glaube, da die SWAPO-Leute längst wüssten, dass sie sich gerade im Hospital nicht verstecken können. „So blöd sind die auch nicht. Die Razzien finden statt, auch wenn da nichts rauskommt, weil ihr Direktor dem Brigadier täglich in den Ohren liegt und sie ihm voll klagt, der es dann an uns auslässt.“ Er versprach, mit seinen Leuten über das unmögliche Verhalten zu sprechen, hatte jedoch seine Zweifel, dass diesen Burschen überhaupt ein zivilisiertes Benehmen beizubringen war. Dr. Ferdinand sprach ihn auch bezüglich des gestohlenen Wasserschlauches an, der zum Abspritzen des Vorplatzes gebraucht wurde, um die Penetranz des Uringeruchs durch die Verdünnung mit Wasser erträglicher zu machen. Der Offizier bot dem Doktor eine Zigarette an, gab ihm Feuer und steckte sich auch eine an. Er war eigentlich gar nicht so unsympathisch, und Dr. Ferdinand verstand nicht, dass so ein Mann, hinter dem er sogar etwas Bildung vermutete, der das unrasierte Gesicht keinen Abbruch tat, bei so einem groben Haufen gelandet war. Sicherlich gab es dafür viele Gründe, vor allem aus dem privaten Bereich, weshalb ihn diese Sache nichts weiter anging. Als der Offizier dem Doktor bestätigte, dass er diesen Schlauch in einem Camp gesehen hatte, wo die Männer ihre Fahrzeuge abspritzten, hatte Dr. Ferdinand wieder Hoffnung. Der Offizier sicherte ihm seine Unterstützung zu und sagte, dass er diejenigen bestrafen werde, die den Schlauch gestohlen hatten. „Diese Kerle haben nicht nur kein Benehmen, sie stehlen wie die Raben und kennen dabei nichts.“ Dann kam die Rede auf die zusammengefahrene Hospitaleinfahrt mit den verknickten Pfosten und dem herausgerissenen Einfahrtstor. „Mit hat keiner eine Meldung davon gemacht“, sagte der Offizier. Dr. Ferdinand berichtete ihm über die frischen Reifenspuren der „Casspirs“, die er am nächsten Morgen auf dem Vorplatz gefunden hatte, von denen eine direkt auf den abgeknickten Torpfosten zuging. „Warum hat mich nicht gleich der Direktor oder ein anderer aus dem Hospital angerufen?“, fragte er erstaunt. „Das wäre doch das Mindeste gewesen.“ Dr. Ferdinand zuckte mit den Schultern und sagte: „Weil die sich damit nicht persönlich belasten wollen.“ „Was heißt persönlich belasten, wenn es ums Hospital geht?“, meinte er ärgerlich. „Da gibt es doch Verantwortung, die nicht dadurch aufgehoben wird, dass man dem Kommandeur in den Arsch kriecht, der sich da vor Würmern nicht mehr retten kann.“ Der Koevoetoffizier wollte sich die Sache selbst ansehen und gegebenenfalls dafür sorgen, dass die Einfahrt wieder in Ordnung gebracht wird. Er brachte Dr. Ferdinand persönlich zum Hospital zurück und schaute sich die verknickten Pfosten und verbeulten Tore der Einfahrt gleich mit an. Er brauchte keine zwei Minuten und versprach, dass die Sache in einer Woche erledigt sei. Dr. Ferdinand dankte ihm für seinen Verstand, worauf der Offizier meinte, dass die Koevoet so schlecht auch nicht sei, und die Zeit nicht besser werde.
Der junge Kollege war allein im Untersuchungsraum 4 und gerade dabei, eine luxierte Schulter bei einem jungen Patienten einzurenken, was diesmal nicht so einfach ging, weil die rechte Entspannung fehlte. Die Kocher’schen Drehbewegungen des Armesbrachten den Kopf des Oberarmknochens nicht über die Lippeder Gelenkpfanne. Dr. Ferdinand streifte sich die rechte Sandale ab, setzte den Fuß in die rechte Achselhöhle des Patienten und zog den Arm am Handgelenk kräftig nach unten, wobei der Kopf mit einem Ruck die Pfannenlippe übersprang und in die Pfanne glitt. Diese Methode, die der geniale griechische Arzt Hippokrates vor über zweitausend Jahren in die Medizin eingeführt hatte, war erfolgreich, da der eingedrückte Fuß als Hebel (Hypomochlion) diente, über den der Kopf von der Pfanne weggestreckt wurde und so das Hindernis der Pfannenlippe überwand. An diesem Mittwoch kamen auch wieder einige Patienten von Schwester Maria Gottfried vom katholischen Missionshospital in Oshikuku. So setzte sich eine ältere Frau mit einem Erguss im linken Kniegelenk auf den Schemel. Sie übergab die Tüte mit den Röntgenbildern, auf denen das verschlissene Kniegelenk zu sehen war. Dr. Ferdinand punktierte den Erguss aus dem Gelenk ab und erklärte der Patientin, dass sie mit diesem Knie und erneuten Gelenkpunktionen leben müsse, da sonst nur eine Versteifung des Kniegelenks in Betracht käme. Die Patientin hatte es verstanden und nahm die düstere, schmerzhafte Prognose hin in einer Zeit des Fortschritts, wo das künstliche Hüft- und Kniegelenk in der Ersten Welt längst zur Routine gehörten. Er informierte Schwester Maria Gottfried durch einige Zeilen, die er auf die Rückseite ihres Briefes schrieb und der Patientin mit den Röntgenbildern in die Hand drückte. Der nächste Patient war ein Mann zwischen vierzig und fünfzig, bei dem die acht Wochen alte Unterschenkelfraktur nicht abgeheilt war. Auf dem mitgebrachten Röntgenbild war die Bildung des Falschgelenks nicht zu übersehen, so dass der Patient zur operativen Bruchbehandlung stationär aufgenommen wurde. Ein kleines Mädchen wurde von der Mutter hereingetragen, dessen Zeige-, Mittel- und Ringfinger an beiden Händen einen gemeinsamen Hautmantel hatten, an dessen Ende die Fingernägel hervortraten, wobei sich der zweite und dritte Finger einen breiten Fingernagel teilten. Die Frage war, ob die zusammengewachsenen Finger (Syndaktylie) voneinander getrennt werden können. Dr. Ferdinand sagte der Mutter, dass die Finger getrennt werden könnten und erklärte ihr die Operation in groben Zügen, was ihr die Schwester übersetzte. In den Gesundheitspass trug er den Termin zur Operation mit einer Wartezeit von sechs Monaten ein, weil dann der Zeitpunkt zur Fingertrennung an der etwas größeren Hand ein besserer war. Die Mutter war zufrieden, packte sich das Töchterchen auf den Rücken, bedankte sich für die gute Nachricht und verließ den Raum. Der junge Kollege hatte indessen bei einem zehnjährigen Jungen einen Rucksackverband wegen einer linksseitigen Schlüsselbeinfraktur und zwei Unterarmgipse bei älteren Menschen mit gebrochenen Handgelenken angelegt. Er ging in der Arbeit am Patienten auf, was Dr. Ferdinand gefiel und ihn an den guten Dr. van der Merwe erinnerte, der so stark in der Arbeit aufging, dass er oft seine Uniform mit Gips völlig bekleckert hatte, weil ihm die Uniform nicht so wichtig war wie der Patient. Dieser Bauernsohn und Arzt aus dem Freistaat war eine rühmliche Ausnahme unter den jungen Leutnants, die im Allgemeinen darauf achteten, dass ihre Uniformen nicht durch die Arbeit beschmutzt wurden. Er freute sich, dass der junge Kollege in die guten Fußstapfen des Vorgängers trat.
Dr. Ferdinand wurde zum „theatre 1“ gerufen, wo Dr. Ruth dabei war, einen erschossenen, acht Monate alten Föten durch Kaiserschnitt zu entbinden. Eine traurige Geschichte, die hier kein Einzelfall war, wo Männer die werdenden Mütter belästigten, sie schlugen oder ihnen in den Bauch schossen. Der neunzehnjährigen Patientin, die auf dem Wege zur ihrer ersten Mutterschaft war, war die Gebärmutter völlig zerrissen, so dass sie entfernt werden musste. Die Blutung musste zum Stehen gebracht, ihr Leben gerettet werden. Sie hing am Bluttropf. Dr. Ferdinand assistierte den geburtshilflichen und gynäkologischen Teil der Operation, besah mit traurigen Augen den zerschossenen, fast ausgereiften Föten, der ein Junge werden wollte, und trug zum zügigen Verlauf der Hysterektomie bei, was für die Patientin einen geringeren Blutverlust bedeutete. Dann assistierte Dr. Ruth dem Kollegen bei der Darmresektion und Anastomose sowie der Wiederherstellung der Harnblase. Das Geschoss hatte die großen Beckengefäße nur knapp verfehlt, das hieß, dass die junge, werdende Mutter, der die menschliche Frucht schon im Bauch erschossen wurde, und die nun keine Mutter mehr werden konnte, nur knapp dem Tode entronnen war. Die Operation dauerte einige Stunden und ging bis tief in den Abend hinein. Dr. Ferdinand und Dr. Ruth dachten dem Leben etwas voraus, dem in so frühen Jahren das Glück für immer genommen war. Noch lag die Patientin auf dem Tisch, und die beiden Ärzte sprachen die möglichen Komplikationen durch, die eintreten konnten. Es bedrückte sie, dass dieser jungen Frau, wenn sie die Operation überstand, die Lichtseiten des Lebens genommen waren und nur die Schattenseiten blieben. Welcher Mann würde sie jemals wieder lieben oder zur Frau nehmen, wenn sie keine Kinder kriegen, mit ihm keine Familie gründen konnte? Es war ein so trostloses Bild, was sich da auftat, dass sie das Thema nicht weiter verfolgten, um der Frage aus dem Wege zu gehen, ob so ein Leben noch lebenswert war. Es sollte nicht weiter vorausgedacht werden, um nicht mit dem klassischen Verständnis des ärztlichen Ethos in Konflikt zu geraten, denn das nackte Leben der geschändeten Mutter stand auf dem Spiel. Die Achtlosigkeit vor dem Menschen und die frühe Verwerfung der menschlichen Frucht durch den gezielten Pistolenschuss zeigten auf die fürchterlichste Weise die Verheerung in den Köpfen und Herzen, deren Ursache nicht allein in der schwarzen Diskriminierung zu suchen war. Das Zusammenleben in gegenseitiger Achtung war auf das Schmerzhafteste bloßgestellt und gefährdet, zur äußeren Unsicherheit kam die innere dazu. Die Menschen wussten weder ein noch aus, sie suchten Rat und Hilfe im Gebet und in der Kirche. Sie trauten der eigenen Tradition nicht mehr viel zu, wozu die Verwüstungen der Felder und Krale und die täglichen Verletzungen durch Minen, die meist tödlich waren, erheblich beitrugen. „Man kann nur Gott danken“, sagte Dr. Ruth am Ende der Operation, „dass man in all den Jahren der Zerstörung noch unverletzt davongekommen ist.“ Dr. Ferdinand verstand sie und setzte dem Wort „unverletzt“ das Wort „körperlich“ voran, denn nach seinem Verständnis waren die seelischen Verletzungen, die das weiße Apartheidsystem den Schwarzen zufügte, enorm, so dass es Generationen dauern würde, bis diese Wunden heilten. Dr. Ruth war mit diesem Zusatz einverstanden. Es war kurz vor neun, als sie die Patientin gemeinsam vom OP-Tisch auf die Trage hoben und sie mit der offenen Frage in den Aufwachraum fuhren, was das Leben nun für sie bereithalten würde. Die beiden Doktoren setzten sich noch zu einer Tasse Tee in den Teeraum und sprachen ihre Gedanken aus, was aus einer Gesellschaft wird, die vor dem Leben keinen Respekt mehr hat. Dr. Ferdinand meinte, dass dort, wo Mord und Totschlag zum Alltag gehören, die Gesellschaft krank ist, den Anspruch auf Zivilisation verwirkt und im Abgrund der Selbstauflösung versinkt. Dr. Ruth, die hier aufgewachsen war und durch Spenden der Mission in Südafrika studiert hatte, sagte, dass es zu ihrer Kindheit noch Achtung vor dem Leben gab. Dr. Ferdinand wollte es nicht bestreiten und gab dem weißen Herrschaftssystem in seinem Anachronismus mit den militärisch überzogenen Auswüchsen und der allgemeinen Verarmung der schwarzen Bevölkerung den Großteil der Schuld. „Die menschliche Situation wird sich nicht bessern, solange der Krieg hier alles durcheinander schlägt.“ Dr. Ruth meinte dazu, dass es noch eine Weile dauern werde, bis der Krieg vorüber sei und fügte an: „Aber ewig kann der nicht mehr dauern, denn das südafrikanische Militär zieht sich bereits aus Angola zurück.“
Es war eine Vollmondnacht, und Dr. Ferdinand machte seinen nächtlichen Spaziergang, als ihn der Wachhabende an der Sperrschranke fragte, ob er denn bis jetzt gearbeitet hätte. Dr. Ferdinand sagte ihm, dass die Arbeit am Hospital einfach kein Ende nehme und die Kräfte eines Menschen überfordere. Der Wachhabende meinte, dass es doch eine Frage der Organisation sei, die Arbeit gleichmäßig zu verteilen. Als er dann hörte, dass die Zahl der Ärzte viel zu klein war, sah er offenbar ein, dass das Verteilungsprinzip da auch nicht zur Arbeitserleichterung beitragen konnte. Er brach das Gespräch ab, da ihn der Vorgesetzte über das Walkie-Talkie ansprach, während ein anderer die Sperrschranke senkrecht aufrichtete, um eine zurückkehrende „Eland-90“-Dreierkolonne durchzulassen. Hunde bellten ihn aus den Vorgärten an, die den vorausgehenden Schatten eines kriechenden Wanderriesen nicht so einfach passieren ließen. Zu Hause machte er einen Kaffee, steckte sich eine Zigarette an und setzte sich auf die Treppenstufe. Die Luft hatte sich etwas abgekühlt, was Dr. Ferdinand als angenehm empfand. Unter einem Baum vor dem „International Guesthouse“ stand ein Toyota Cressida mit heruntergedrehter Scheibe und abgestelltem Licht, in dem sich eine Frau bumsen ließ, die ihre rhythmischen Stoßlaute über den Platz schickte. Dr. Ferdinand ging in die Küche und kochte sich zwei Eier, schnitt vom geschmacklosen Brot drei Scheiben ab und bestrich sie dünn mit Pflanzenfett, setzte das Essen auf den niedrigen Tisch vor dem Sessel und aß es mit Appetit, denn er hatte aufgrund der Obduktionen das Mittagessen nicht gesehen. Er trank eine zweite Tasse Kaffee, als es in dem parkenden Auto eine Auseinandersetzung gab, die an Lautstärke zunahm, weil der Bumser nicht so viel Geld für die Gebumste locker machen wollte, die ihn deshalb als Geizhals bezeichnete, während der „Stielicke“ sie trockene Schachtel schimpfte, die ihn nicht befriedigt hätte. Um der lauten Argumentation zu entgehen, schloss Dr. Ferdinand trotz der Hitze im Wohnraum die Tür und holte sich die „Großen Philosophen“, als ob sie dazu etwas zu sagen hätten. Er las über den ionischen Philosophen Anaximander, der als Erster die Erdkarte gezeichnet und einen Himmelsglobus konstruiert hatte. Er lehrte als Erster, dass die Erde frei im Weltenraum schwebt, wo Sonne und Sterne sich auf der jeweils anderen Seite bewegen, wenn sie von ihrem Untergang am Horizont bis zu ihrem Wiederaufgang gelangen. Es war Anaximander, der als erster Grieche seine Einsichten und Erkenntnisse in Prosa schrieb. Aus seinem Denken kommt der Satz, dass der Ursprung (arche) der Dinge im Unendlichen (apeiron) ist, woher die Dinge des Seins kommen, die, wie im Kreis, dorthin wieder zurückkehren. Alles, was aus dem Unendlichen kommt, geht im Unendlichen wieder unter. Die Unendlichkeit war der Stoff, aus dem die Welten gemacht wurden, kamen und vergingen. Für den alten Thales, der wie Anaximander in Milet, der größten Handelsstadt Ioniens lebte, war es das Wasser, aus dem alles entstand, dem dann Heraklit von Ephesus (Kleinasien) fünfzig Jahre später das Prinzip des permanenten Fließens hinzufügte, das große Bild vom ständigen Kommen und Gehen der Dinge im Leben, ja des Lebens selbst. Diese griechischen Denker waren die frühen Vorläufer der Einstein’schen Relativitätstheorie. Dr. Ferdinand mochte das Bild vom ewigen Fließen, er wünschte sich, dass der große Strom die anachronistischen Unbilden des weißen Unrechtssystems möglichst bald wegreißt, damit etwas Neues mit einem menschlichen Gesicht entstehen kann. Die Evolution als der ständige Werdeprozess sollte hier nicht spurlos vorübergehen. Er sollte wie ein Vesuv die erstarrten Schichten der Unmenschlichkeit und der Toten nun endlich mit der glühenden Lava der hoffenden Herzen nach einem neuen Leben überziehen. Wie sagte doch der große Augustinus: „Desideravi, intellectu videre, quod credidi.“ (Ich verlangte mit der Vernunft zu schauen, was ich glaubte). Die Menschen schwiegen nicht in ihren Gedanken, wenn sie auch mit dem Munde schwiegen. Sie hatten gelernt, dass mit den Mächtigen, die ihnen Recht und Würde genommen hatten, nicht zu reden war.
Es war ein längeres Telefonat, das Dr. Ferdinand mit Deutschland führte, in dem über die Schießereien an der deutsch-deutschen Mauer berichtet wurde, wo der automatische Schießbefehl Menschen, die sich nach der Freiheit sehnten, aus dem Zwangskorsett der politischen Knebelung wie aus einer psychiatrischen Anstalt ausbrachen und sich meist nachts mit letzter Kraft über die Mauer warfen, zerlöchert in den Tod schickte, wenn sie nicht vorher von abgerichteten Schäferhunden, die an Leinen unter lang gezogenen Drahtseilen hin und her liefen, zerfleischt oder im vorgelagerten Todesgürtel durch Minen in der Luft zerrissen wurden. Die Menschen drüben in der DDR schwiegen beim Anblick der Mauer nicht länger. Sie schickten sich an, den Willen nach Freiheit mit Kerzen in der Hand auf die Straße zu tragen, war es in Berlin, Halle oder Leipzig. Die Allgegenwart der totalen Überwachung hatte sie in den Käfig gesperrt, was sie nicht länger ertragen wollten. Einer, der in vorderster Reihe mit den Menschen für die Freiheit auf die Straße ging, war Kurt Masur, Chefdirigent am Leipziger Gewandhaus, dem Haus, dem der junge Felix Mendelssohn Bartholdy, der Wiederentdecker von Johann Sebastian Bach, durch sein musikalisches Genie zu Weltruf verhalf. Die Betonmauer werde nicht mehr lange halten, das sagten die Menschen von drüben, auch wenn jener Anachronismus mit dem Käfigleben nicht in die Betonköpfe gehen wollte. Diese Politköpfe seien verkalkt und stünden moralisch im Abseits, was ihnen Bert Brecht nach dem Arbeiteraufstand im Juni 1953 bereits zugeschrieben hatte. Sie wären noch wackliger auf den Füßen als damals, weil Altersschwäche und Starrsinn hinzukämen, die sie für die notwendigen Dinge blind und die folgerichtigen Entscheidungen unfähig gemacht hätte. Der Beton säße fest in ihren Köpfen, der an der Mauer schon bröckelte, wo das Fundament so sicher nicht mehr war. Es sei nur eine Frage der Zeit, dass das Beben den betonierten Wahnsinn zu Fall brächte. Der Anrufer merkte an, dass es Schüler, Studenten und die arbeitende Jugend seien, die das Monster mit dem symbolträchtigen Werkzeug, wie es auf der Flagge des Arbeiter- und Bauernstaates zu sehen ist, zerschlagen und seine Erfinder zum Teufel jagen werden, vorausgesetzt, dass die russischen Panzer sich diesmal aus der deutschen Angelegenheit heraushielten. Der Anrufer traute dem Michail Gorbatschow die nötige Intelligenz zu. Die zweite und dritte Generation werde damit aufräumen, was ihre Väter und Großväter nicht konnten, die nach dem Krieg aus sibirischen Arbeitslagern zurückkehrten und an ein demokratisches Nachkriegsdeutschland glaubten, das sozial gerecht wäre in der Güterverteilung, die es nicht verhinderten, dass sich das System zwar sozialistisch nannte, es aber nicht war, weil es mit der gerechten Güterverteilung hinten und vorne nicht stimmte. Der Staat mit der Bruderpolitik und rigorosen Maulkorbpraxis machte keine Freude mehr, wo sich der Reichtum mit dem westlichen Luxus nur bei der Nomenklatura häufte, sei es durch Verscherbelung von Kunstgegenständen oder Verkäufe politisch Inhaftierter, während die Butter fürs Volk immer teurer wurde und der kleine Zweitakttrabant mit seinen stinkenden Abgasen über vier Jahre im Voraus bestellt werden musste. Dr. Ferdinand legte den Hörer auf und dachte bei einer Zigarette über die Parallelen der Ereignisse an der deutschen Qualitätsmauer und den verminten Feldern vor und hinter der angolanischen Grenze nach. Richtig parallel waren die Ereignisse nicht, da die Menschen hier zwar nicht in ihren Gedanken, aber mit den Zungen schwiegen, während die da drüben bereits die Hand vom Munde nahmen, wenn sie über den Staatsterror sprachen, den sie nicht weiter hinnehmen wollten und mit Kerzen in der Hand auf den Straßen für Frieden und Freiheit kämpften. Der Stoff, aus dem die Welten sind, liegt in der Unendlichkeit, der so einfach nicht zu begreifen ist, wo die Welten mit den menschlich-unmenschlichen Zusätzen wieder versinken, wenn sie erst einmal erstarrt sind, wie es das „panta rhei“ des Philosophen Heraklit von Ephesus vorausgesagt hatte. Die Evolution verlangt eben nach ständig Neuem, wo der Mensch seine Chance zur Verbesserung wahrnehmen und sich darin wahr machen kann, wenn er dazu noch fähig ist. Woran kann und soll sich der Mensch ausrichten, wenn das Alte, was erstarrt ist, vergeht, und das Neue, was weich und noch formbar ist, kommt? Kann und will der Mensch aus der Geschichte lernen? Sicherlich ist alles im Fließen und physikalisch in relativen Bezügen. Doch wie ist es mit der Moral und Ethik? Welche Bezüge sind da zu begreifen und fürs Leben zu nehmen? Er holte sich sein Büchlein, das er vor Jahren geschrieben hatte, und las das Gedicht „Vaterland“, das er während seiner Vertretungszeit am Lauenburger Krankenhaus während der kalten Weihnacht 1978 mit dem Blick auf die deutsch-deutsche Grenze mit dem breiten Todesstreifen verfasste, als sich mächtige Eisschollen im Elbknie krachend ineinander schoben, verschichteten und türmten.
Mein Vaterland
I
Ein geteiltes Land – mein Vaterland treibt wie ein gespaltenes Floß auf dem reißenden Strom einer von Sehnsucht durchdrungenen gemeinsamen Sprache gespeist aus zahlreichen Flüssen und Quellen aus Keltischem und Slawischem, aus gewachsenen Dialekten. Vaterland ist das Land der Dichter und Lieder bis denkend hin zu den Kriegen, zu Gewalt und Tod. Begonnen mit den Idealen einer unbelasteten Jugend mit der Selbstverständlichkeit der Selbstopferung mit unermüdlicher Tüchtigkeit im Lernen der Tugend verabscheute sie von Anfang an Milde und Schonung. Und wieder hat die Geschichte eine andere Sprache gesprochen. Denn wieder wurde die Grenze nicht beachtet. Blut floss vor allem Unschuldiger zur entsetzlichen Lache, hinterher, immer dann erst, wird das geronnene Übel betrachtet. Gebrochen wird die Jugend, ihr Herz, zerbrochen die Scholle, verrosteter Stacheldraht wurde durch neuen ersetzt. O Vaterland der Särge und Kreuze, du geliebtes Land.
II
Trüb ist das Wasser geworden. Schwermut und Trauer fließen wieder durch Generationen, in der Weite des Stromes geht die Suche verloren. Zwischendurch gab es einen ersten flüchtigen Frühling, doch fehlten die Menschen, die ihn verstanden, und die Alten waren schon blind. Von der Sprache brachen manche Ecken zu Boden, Kinder spielten Fußball damit oder warfen sie fort. Schnörkel vergangener Zeiten werden geräumt, Väter liegen schlaflos und rätseln vor dem Morgen. Gewaltig hat sich verändert der einst vertraute Ort, die Idylle wurde mit dem Roden, den modernen Maschinen platt gemacht. Alte Lieder und Märchen wurden verlacht, Geachtetes wurde mit den Eisschollen fortgetragen. Das Neue, es ist nicht mehr als die unverstandene Fremde der einstigen Heimat. Es ist die Blindheit vor der Nacht, die den alten Baum verkennt mit dem Wort „Liebe“ in der Rinde. Einer schwamm bei Nacht in der Elbe, es war eine kalte Novembernacht, als er von Ufer zu Ufer schwamm. Geschossgarben gaben ihm das Geleit von Deutschland nach Deutschland.
III
Ein Kuckuck ruft mal hier mal dort, die Sprache ist dieselbe. Er ruft, dass etwas nicht in Ordnung ist und sich bewegt im Schutz der Nacht. Lichtsignale eilen über stumme Flächen, sie kreuzen sich und bleiben stehn, ein System will sich am anderen rächen, vom Wachturm haben Augen was gesehn. Schon rattern wieder die Gewehre, zwei Hasen springen hoch und sind zerrissen. Abgetrennt von jener scharfen Schere türmen Grenzkadaver sich vor den Gewissen.
IV
Fremde Sprachen sind in der zerstörten Stadt, tuscheln vor dem Geburtshaus meines Vaters, das längst in Trümmern liegt. Sicherheitsgründe sind’s, dass das Haus zertrümmert bleibt, wenige Meter weiter liegen schon die Minen. Es ist eine neue Zeit, das Geschichtsbuch ist veraltet, und der große Strom ist gar nicht weit, getrennt wird er verwaltet.
V
Das Sprachempfinden ist gewachsen, unaussprechlich ist der Schmerz. Mein Land – du geteiltes Vaterland, ganz behalt ich dich im Herz. Jenseits der Worte weinen die Gedanken von der Sonne des Tages harsch geblendet überschattet vom gähnenden Abgrund der Nacht. Wo ist nur der Pfad der eigenen Geschichte, verschmutzt fließt der Strom der großen Sprache, wenngleich die Quellen sauber sind. Es funktionieren die Gerichte, Minister haben ihre Wache, draußen fegt ein frischer Wind.
VI
Was Freiheit ist, man muss es lernen, die einen sagen es so, die andern sagen es anders. Eingebettet ruht sie in den Sternen, konkret zu fassen ist sie nirgendwo. So geh ich meiner Arbeit nach, der Worte sind genug gesprochen. Das ist mein Weg zum Vaterland.
Dr. Ferdinand fasste zusammen, was eigentlich nicht zu fassen war. Hier wie dort waren es die Menschen, die sich nach Freiheit sehnten. Hier waren es die Minenfelder mit und ohne Stacheldraht, dort war es die durchgezogene Mauer aus Beton plus meterhohem Stacheldraht mit dem breiten Todesgürtel. Ob Burenoder Betonköpfe, die Quadratschädeligkeit der Macht hatte die rigiden Systeme mit Blut verkrustet und leblos, steinhart gemacht. Der Anachronismus war Ausdruck der Blindheit und wütenden Unmenschlichkeit, die mit dem Blindenstock nicht zu korrigieren war. Das hart Vertrocknete musste zerschlagen werden, weil es von allein nicht vergehen wollte. Die da drüben gingen bereits auf die Straße und hielten brennende Kerzen in der Hand, die hier liefen ohne Schuhe über den aufgewühlten Sand und hatten nichts in den Händen, weil sie sich solche Kerzen nicht leisten konnten. Wie dem auch war, das alt Erstarrte musste weg, es durfte sich nicht länger halten, denn die Güter des Lebens waren zu lange ungerecht verteilt, weil das Soziale ins Sozialistische verpresst oder durch das Hautfarbendenken weiß überstrichen war. Keine dieser Verpressungen hatte ein Anrecht aufs Überleben, denn beide Systeme, ob politisch oder hautfarblich motiviert, waren moralisch, ethisch und menschlich vollkommen entgleist.
Die Nacht war ruhig, und Dr. Ferdinand fühlte sich ausgeschlafen, als er dem Wachhabenden an der Sperrschranke lächelnd sein „Permit“ genau dann vorhielt, als die Hähne sechs Uhr krähten. Der Wachhabende war mit einer solchen Erscheinung zufrieden und wünschte dem Doktor ein „lekker werk“ (gute Arbeit), was der Passierende sich zu Herzen nahm. Der Koevoetoffizier hatte sein Wort gehalten, zu dem er nur zwei Minuten Bedenkzeit brauchte. Das Einfahrtstor zum Hospital war nicht nur repariert, sondern durch stärkere Seitenpfosten und neue Torflügel ersetzt worden. Der Pförtner hatte sich bereits von seinem Schlafstuhl erhoben und öffnete den rechten Flügel mühelos und nicht ohne Stolz. Dr. Ferdinand vermisste beim Überqueren des Vorplatzes die urinöse Geruchspenetranz und wollte es nicht glauben, dass auch der Wasserschlauch zurückgekommen war, den die Koevoetleute vor Wochen zum Abspritzen ihrer Fahrzeuge mitgenommen hatten. Der Morgen war noch zu früh, als dass er begreifen konnte, dass es noch Menschen gab, die ihr Wort hielten. Dennoch freute er sich, weil es den Menschen mit den leeren Händen und mageren Gesichtern zugute kam. Aus diesem Grunde war seine Stimmung gehoben, als er die „Intensiv“-Station betrat und mit den Schwestern, die ihre letzte Stunde der Nachtschicht machten, nach den Patienten schaute. Es gab keine Besonderheiten, und Dr. Ferdinand notierte es zufrieden in den Krankenblättern. Die Schwestern machten am Ende seiner ersten Saalrunde ein besorgtes Gesicht und sagten ihm, dass sie gehört hatten, dass die Wehrmachtsärzte am Ende des Monats abgezogen würden. Er traute es dem Militär zu, obwohl er selbst vom Zeitpunkt des Rückzugs überrascht war. „Wie soll es mit dem Hospital weitergehen?“, fragten sie ihn. Er konnte eine Antwort nicht gleich geben, weil ihm bewusst war, dass mit einer Hand voll Ärzten ein so großes Hospital nur schwer zu betreiben war. „Wir werden auch das durchstehen.“ Mit diesem Mutmacher wünschte er den Schwestern einen guten Schlaf und ging zu den anderen Sälen, um seine Runde fortzusetzen. Die Säle waren völlig überbelegt, viele Patienten lagen auf dem Boden. Zwei und drei Kinder teilten sich ein Bett. Er entließ Patienten, die eigentlich noch nicht entlassungsreif waren und gab ihnen die weiteren Verhaltensregeln mit auf den Weg, die ihnen von den Saalschwestern in ihre Sprache über setzt wurden. Ein neuer Gesichtspunkt durchzog das Denken, denn das Denken vom Vortag reichte nicht aus. Es musste gestrafft werden, was in einem heruntergekommenen Hospital noch zu straffen war, wenn es für das Notwendigste gehalten werden sollte. Eine Strategie der Verteidigung war vonnöten, jetzt musste mit größter Hingabe gehandelt werden, um den Menschen in schwerster Zeit noch helfen zu können. Dr. Ferdinand machte sich selbst Mut, um anderen den Mut zum Durchhalten zusprechen zu können. Auf dem Weg zum Besprechungsraum sprach ihn der schwarze Kinderarzt an, um ihm zu sagen, dass ein schwarzer Chirurg zur Zeit im Windhoeker Zentralhospital arbeite, der dann die Chirurgie hier übernehmen wolle. Er fragte, ob Dr. Ferdinand etwas dagegen habe. Der hatte grundsätzlich nichts dagegen, schlug aber aufgrund seines chirurgischen Schwerpunkts vor, dass beide Spezialisten sich jährlich in der Chirurgie und Orthopädie abwechseln sollten. Der Kinderarzt nahm es zur Kenntnis und wollte den Vorschlag seinem schwarzen Kollegenfreund unterbreiten. Das Problem war eben, dass er selbst kein Orthopäde, sondern auch Chirurg war, und das orthopädische Krankengut große Anforderungen stellte. Dr. Ferdinand war durch diese Mitteilung einerseits erleichtert, weil ein erfahrener Kollege dringend gebraucht wurde, andererseits war er sich nicht sicher, ob der anvisierte Kollege dem Vorschlag zustimmte und Kollege genug war, ein solches Übereinkommen zu halten. Die Zukunft würde es zeigen. Sie betraten den Besprechungsraum, der bis auf den letzten Platz gefüllt war, so dass sich die beiden Kollegen, die noch in der Zeit waren, die Stühle aus dem Sekretariat holten und sich neben den Schreibtisch des Superintendenten setzten. Die Überraschung war nicht gering, als der weiße Kollege mit dem blassen Gesicht, der erst vor einigen Monaten mit dem Vorwand, die Augenheilkunde zu betreiben, angefangen hatte und bereits eine gutgehende Privatpraxis im Hospital betrieb, sich mit vollen Jackentaschen hinter den Schreibtisch setzte und mitteilte, dass er nun der Superintendent sei, da der Vorgänger den Schreibtisch des ärztlichen Direktors eingenommen habe. Dr. Eisenstein, der in Colonelsuniform seit einigen Jahren den höchsten Verwaltungsposten im Hospital innehatte und es dabei buchstäblich verkommen ließ, weil er sich mehr um seine Zahnsanierung und andere Dinge, wie die so genannten Sicherheitsprobleme, kümmerte, als selbst einmal von Saal zu Saal zu gehen, um sich von den miserablen Zuständen persönlich zu überzeugen, hatte den Dienst quittiert und ging seinem schlecht verdienten Ruhestand entgegen, den er in Südafrika mit gutem Augenmaß für die verfahrene Lage im Kreise der Familie genießen wollte. Dr. Johan sprach flüssig und stellte sich nicht ungeschickt an. Was er aus den Morgenbesprechungen der vergangenen Monate gelernt hatte, war, als Superintendent dann den Mund zu halten, wenn Fragen zur dringenden Behebung von Missständen gestellt wurden, die kein Missverständnis aufkommen ließen und beantwortet werden sollten. Er fummelte anfänglich noch an Wortversuchen herum, die bei näherer Betrachtung so schnell umkippten und wegrutschten, dass selbst der vielleicht gemeinte Sinn im Gesagten versagt war und sich schon in Luft aufgelöst hatte, als die drei letzten Worte noch im Ohr lagen. Nein, Dr. Johan war kein Dummkopf. Er hatte sein Ziel klar vor Augen und machte deshalb keine falschen Versprechungen, weil er wusste, dass jede Versprechung ein Versprecher war, der dazu führen konnte, dass man ihn der Lügerei bezichtigte. Nein, das wollte er auf keinen Fall. Er hatte sich deshalb etwas einfallen lassen, was für sein analytisches Denkvermögen sprach und ihn gleichzeitig vor den gehäuften Fragen in eine getarnte Stellung brachte, der man die Vernunft deshalb nicht absprechen konnte. Er öffnete einen epischen Raum für die Berichterstattung ärztlicher Tätigkeiten während der Nacht- und Wochenenddienste. Es war ein kluger Zug, den sich der gewitzte neue Superintendent da rasch ausgedacht hatte, bevor das Image der Person Schaden erlitt, weil es von jeher eine Kunst war, zu reden, ohne etwas zu sagen. Und ein Versagen wollte er sich so schnell nicht nachsagen lassen, wenn er da auch auf den Augensinn der Kollegen für die Realitäten des Hospitals vertraute, die einem Nichtblinden und einem, der sich nicht mehr blind stellen wollte, so kräftig auf die Augen schlugen, dass ihnen die Tränen kommen konnten. Es wurde also weiter gelabert, ohne den Boden unter die Füße zu bekommen, der nötig war, um die Probleme zumindest ansatzweise in den Griff zu bekommen. Der Superintendent belegte sein gutes Sehvermögen mit der Feststellung, dass die Einfahrt zum Hospital wieder hergerichtet und mit stärkeren Seitenpfosten versehen sei, und fügte dieser Feststellung, die er schon mit einem unverdienten Stolz versah, den Wasserschlauch hinzu. Dr. Ferdinand unterließ es, die diesbezüglichen Verdienste ins richtige Licht zu rücken, und so blieb es ungesagt, dass es noch Menschen gab, die ihr Wort hielten, wobei er an den Koevoetoffizier dachte, der nach persönlicher Besichtigung des Schadens ihm unrasiert und nach nur zwei Minuten Bedenkzeit versprach, dass diese Sache innerhalb einer Woche behoben sei. Er hatte sein Versprechen gehalten, und das war etwas ganz Außergewöhnliches. Der neue Superintendent sollte es von ihm nicht erfahren, damit er sich keine richtige Vorstellung machen musste, was für sein erwünschtes Image nicht gerade förderlich sein würde. Auch er sollte seinen mildernden Umstand haben. Was hatte diese Morgenbesprechung gebracht? Zunächst zwei neue philippinische Gesichter mit der unverkennbaren, euro-asiatischen Genvermischung und der Kopfform eines Würfels. Diese im Alter schon fortgeschrittenen Kollegen kamen wie ihre Vorgänger mit Frau und Kindern aus der Natalprovinz, wo sie in ländlichen Hospitälern bereits einige Jahre gearbeitet hatten, und wollten hier den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien verdienen. Für sie kam der günstige Umstand hinzu, dass ihre Frauen das Lehrervakuum an den verwahrlosten Schulen sofort auffüllen konnten, was den Brotgewinn von Anfang an erheblich erleichtern würde. So waren ökonomische Gesichtspunkte erkennbar, die diesen Nachzüglern so verlockend erschienen, dass sie die Gefahren, die der Krieg mit sich brachte, dafür in Kauf nahmen. Ein philippinischer Kollege wurde der Orthopädie, der andere der inneren Medizin zugeteilt. Für Dr. Ferdinand konnte es eine Erleichterung in der Bewältigung der operativen Arbeit sein. Die Besprechung frischte außerdem die Gedächtnisse bezüglich der miserablen Zustände in den Sälen auf, wo es weiterhin an ganzen Betten und Schaumgummimatratzen fehlte, wo die Wasserhähne klemmten und tropften, die Toiletten es nicht richtig taten und die verstopften Drainagen Ursache für die Scheißgerüche blieben. Die neuen Kollegen mochten sich darüber gewundert haben, weil sie das von den Toiletten in den Hospitälern der Natalprovinz anders gewohnt waren, doch für die hier länger tätigen Kollegen und die erfahrenen Matronen hatte diese Auflistung den Reiz des Neuen längst verloren. Die Erfahrenen wussten, dass es eine Routineübung war, die rein theoretischen Charakter hatte, der praktisch keine Bedeutung beizumessen war, weil sich an dem kotig verfleckten, zerrissenen und zu Bruch gegangenen Zeug, auf dem die Patienten widerspruchslos lagen und dem erbärmlichen Gestank, der den Nasen seit Jahren zugemutet wurde, nichts geändert hatte. An ein Wunder glaubte hier keiner mehr, dafür waren die Menschen realistisch genug, die wussten, dass dieses Hospital in der Zone der letzten Entscheidungsschlacht, wie sie vom Brigadegeneral genannt wurde, von der weißen Administration seit Langem nach dem Motto aufgegeben war: „Die sollen mit ihrem Dreck gefälligst alleine fertig werden.“ Der neue Superintendent hatte sich beim Wort genommen und keine Versprechungen gemacht. Er sagte kein Wort, und das war klug, wenn seine Augen auch unruhig hin und her fuhren. Ihm war kein Versprecher unterlaufen, dem man eine Lüge hätte anhängen können. Er hielt sich verdeckt und ließ die anderen reden, die doch nichts ausrichten konnten. Wie schon gesagt, es wurde in der Besprechung Platz gemacht für die Tätigkeitsberichte der Kollegen des Nachtdienstes, und der Platz war groß genug, um es ausführlich zu tun. Für die jungen Kollegen war das eine Herausforderung, sich umfassend und folgerichtig zu artikulieren, die Fallbeschreibung mit Hand und Fuß zu versehen und die Fragen präzise zu beantworten. Die Nützlichkeit des Sachvortrags zeigte sich, als ein junger, sympathischer Kollege, der seinen Dienst in Uniform verrichtete, von einem älteren Patienten berichtete, der seit Tagen über Schmerzen im rechten Unterbauch klagte. Er hatte den Patienten untersucht und mit der Diagnose „Appendizitis“ aufgenommen. Der Frage, was die rektale Fingeruntersuchung ergeben hatte, hielt er allerdings nicht stand. Er kippte um, weil er diese Untersuchung nicht durchgeführt hatte, die in den klinischen Semestern als unerlässlich gelehrt wurde. So machte der freundliche Kollege ein zerknirschtes Gesicht, und das zu Recht, denn er hatte sich an diesen klinischen Lehrsatz im entscheidenden Augenblick nicht erinnert. Er steckte die Schlappe ein, bei dieser elementaren Frage umgekippt zu sein. Er durfte die Lehre zur diagnostischen Gründlichkeit ziehen und sich später mit einem Schmunzeln daran erinnern, wenn er selbst diese Frage an einen jungen Kollegen stellte. Die Besprechung hatte nicht bestätigt, was die Schwestern am frühen Morgen Dr. Ferdinand anvertrauten, dass die Militärärzte am Ende des Monats aus dem Hospital abgezogen würden. Darüber verlor der neue Superintendent kein Wort, der es hätte wissen müssen. Er mochte seine Gründe zum Verschweigen dieser schwer wiegenden Botschaft gehabt haben, obwohl ihm keiner einen Vorwurf gemacht hätte, dies bereits jetzt mitgeteilt zu haben, weil die Konsequenzen noch nicht absehbar waren. Mit dieser Maßnahme, die an den Hauptnerv des Hospitals ging, würde die verbleibende Leistungsfähigkeit erneut auf den Prüfstand gestellt. Dr. Ferdinand wollte den Superintendenten nicht zu einer Erklärung dieses Einschnitts herausfordern, weil er ihm noch eine Schonfrist zubilligte und persönlich überzeugt war, dass sich ein so gravierender Umstand nicht lange geheim halten ließe. Die Besprechung war zu Ende. Die neuen Kollegen behielten ihre Plätze ein, um die Einzelheiten ihrer Unterkunft mit dem Superintendenten zu besprechen, bei denen es um Häuser ging, die auch ihre Familien fassten.
Auf dem Weg zum „theatre“ fragte Dr. Ferdinand den schwarzen Kollegen Dr. Nestor, ob er vom Abzug der restlichen Kollegen in Uniform wusste. Er bestätigte die Mitteilung der Schwestern, weil er vor einigen Tagen auch davon gehört hatte. „Wir gehen einer schweren Zeit entgegen, wo das Letzte von uns gefordert wird“, sagte er mit besorgtem Gesicht, wobei er sich eines leichten Stotterns nicht erwehren konnte. Dr. Ferdinand las sein Gesicht und verstand sein Stottern. Er klopfte ihm mit den Worten auf die Schulter: „Aber unterkriegen lassen wir uns nicht! Wir müssen bei der Stange bleiben und beim Fähnlein der Letzten zusammenstehen.“ Dr. Nestor sah ihm in die Augen und traute ihm den Geist der Worte zu. Dr. Ferdinand bog vor dem „Outpatient department“ nach links ab, um die letzten Schritte zum OP-Haus zu nehmen. Er wünschte dem besorgten Kollegen Kraft und Zuversicht, der geradeaus zum internen Männersaal ging. Im Umkleideraum stand der junge Kollege und Schriftsteller, der sich bereits das Grüne übergezogen hatte und seine Verwunderung über den Wechsel auf dem Stuhl des Superintendenten und den Weggang des ärztlichen Direktors in der Colonelsuniform aussprach. Er drückte im Flüsterton aus, dass das Ende nun in Sichtweite sei. Dr. Ferdinand hatte ihn mit dem Wort „Ende“ verstanden, denn er hatte im Zusammenhang mit seiner Geschichte des schwarz-weißen Liebespaares schon vor Wochen gesagt, dass das aufgesetzte Burensystem keine Zukunft habe. Dr. Ferdinand ließ kein falsches Bild aufkommen und sagte ihm, dass die noch zu gehende Straße von Stolpersteinen und Minen voll gespickt sei und noch viele Opfer fordern würde. Der junge Kollege sah es ein und meinte leise, wobei er den Mund noch näher ans rechte Ohr des älteren Kollegen führte, der sich gerade das grüne Hemd überzog, dass den verstockten Buren der Verstand abhanden gekommen sei, um das mit weniger Waffen zu begreifen und in letzter Sekunde doch noch einzulenken, bevor sie das Gesicht ganz verlören. Wortlos gingen sie zum Waschraum neben dem „theatre 2“, um sich für die Operation, die Verschraubung eines Fußinnenknöchels, die Hände zu waschen. Dr. Lizette hatte die Patientin in den Schlaf gelegt, als die beiden mit grünen Kitteln den OP-Raum betraten und sich die Handschuhe noch überzogen. Die OP-Schwester hatte Fuß und Unterschenkel mit der braunen Lösung gesäubert und die Patientin mit grünen Tüchern abgedeckt. Dr. Ferdinand hatte die Fraktur freigelegt, um mit der Ahle das Loch für die Schraube in die Spitze des Innenknöchels zu drücken, als dreimal die Dorfsirenen aufheulten. Es war so still im OP-Raum, dass man eine Nadel hätte fallen hören, den keiner sprach ein Wort, in Erwartung des Riesenknalls und anschließenden Bebens, bei dem das letzte Mal der Instrumententisch durch den OP-Raum rollte und die Instrumente durcheinander klapperten, als wäre es ein Stück zeitgenössischer Musik, das mit Blechlöffeln wild auf einem Metallophon geklöppelt wurde. Dr. Lizette stand die Blässe im Gesicht, weil sie der Ruhe nicht traute. Sie sagte, dass sie nachts schon Alpträume hätte, in denen Granaten um ihr Bett herum einschlügen. „Das kann schon mal passieren“, meinte Dr. Ferdinand beiläufig, weil er sich auf das Eindrehen der Knöchelschraube konzentrierte. Erst hinterher fiel ihm ein, dass diese Bemerkung nicht gerade beruhigend und noch weniger geeignet war, die Angst von einem Menschen zu nehmen, der besonders sensibel war und mit diesen Ereignissen nicht vertraut werden wollte. Im Teeraum, als sie sich eine kurze Pause gönnten, während der nächste Patient zur Unterschenkelnagelung in den OP-Raum gefahren wurde, den Schwester Maria Gottfried vom Missionshospital Oshikuku mit der Falschgelenkbildung (Pseudarthrose) einer nicht abgeheilten Standbeinfraktur geschickt hatte, entschuldigte sich Dr. Ferdinand für seine beiläufig gemachte Bemerkung, die sich Dr. Lizette nicht so zu Herzen nehmen sollte. Er erklärte, dass im Augenblick des Sirenenheulens die Schraube den gebrochenen Innenknöchel nicht richtig festziehen wollte, und er sie durch eine längere ersetzen musste. Sie setzte die Teetasse zurück und meinte, dass sie ihn schon richtig verstanden hatte, und er sich über die Bemerkung keine Sorgen machen sollte. Ihr sei lediglich der Schreck in die Beine gefahren, dass es einen ähnlichen Knall geben würde wie im Fall davor, wo das Hospital zitterte, als hätte es ein Erdbeben gegeben und anschließend auch noch die Lichter ausgingen. Der junge Kollege griff das Bild mit den ausgegangenen Lichtern auf und sagte scherzhaft, dass die Lichter länger ausgehen würden, je näher die Knallerei ans Ende käme. Es war ein Satz mit doppeltem Denkboden, jedenfalls verstand ihn Dr. Ferdinand so, weil alle sich ein Ende der Knallerei wünschten, aber auch das Licht, um nicht im Dunklen zu sitzen, was psychologisch noch nie förderlich war. Dr. Lizette schmunzelte über die Doppelbödigkeit, die sie von dem jungen Kollegen, der doch ein uniformierter war, wenn er nicht die grüne OP-Kleidung anhatte, nicht erwartete. „Wie kommen Sie auf diese Idee, haben Sie denn schon länger ohne Licht gesessen?“, fragte sie ihn. Der junge Kollege war schlagfertig, als er ihr die Frage bejahte und es mit einer Examensarbeit begründete, wo ihm wirklich alle Lichter ausgegangen waren, weil ihm das Richtige zu spät einfiel. Nun lachten alle drei, weil sie sich über den Mut freuten, dass ein Mensch eine Schwäche zugeben konnte. Dieser Mut war meist nur Kindern und alten Menschen gegeben, die mit der persönlichen Eitelkeit noch nicht oder nicht mehr zu kämpfen hatten, und Dr. Ferdinand rechnete ihn dem jungen Kollegen positiv an. Dr. Lizette ging zum OP-Raum, um mit der Narkose zu beginnen, während der junge Kollege über den neuesten Stand an der Palliser Bucht berichtete, wo der junge Ehemann seine schwarze Ehefrau, die sich intervallartig in Wehen krümmte, mit dem Auto ins Hospital nach Wellington zur Entbindung brachte, die vorgeschriebene Geschwindigkeitsgrenze überschritt und fast einen Unfall verursacht hätte, als er ein anderes Fahrzeug nur knapp überholte. Die Schwestern bei der Aufnahme machten große Augen, weil sie eine schwarze Frau anscheinend noch nicht gesehen hatten, was sie erfreulicherweise nicht davon abhielt, sie höflich und mit der gebotenen Dringlichkeit zu behandeln. So entband die dortige Hebamme eine Stunde später einen gesunden Sohn mit je fünf Fingern und fünf Zehen und legte ihn hellhäutig in ihre dunklen Arme. Das Glück wäre perfekt gewesen, wenn nicht die Nachricht vom Tode ihres Vaters gewesen wäre, der einem Schlaganfall erlegen war, nachdem er und seine Familie von dem kleinen Stück Grund, auf dem sie lebten, solange sich die junge Mutter erinnern konnte, grundlos vertrieben wurden. Sie gingen zum Waschraum und wuschen sich die Hände, als Dr. Ferdinand das Bild von Glück und Unglück zu balancieren versuchte, was nicht klappte, weil die Dimensionen mit ihren Höhen und Tiefen zu unterschiedlich waren. Er hätte nur den Schriftsteller im jungen Kollegen fragen sollen, wie das mit der Vertreibung denn kam, dieser hätte ihm da eine ganze, separate Geschichte erzählen können. Doch das wollte er sich für später aufheben. Sie gingen an den OP-Tisch und stellten sich in Höhe des Unterschenkels gegenüber. Der nicht abgeheilte Knochenbruch wurde freigelegt und vom üppig gewucherten Bindegewebe befreit. Es gab wieder ein Problem bei der Auswahl des Marknagels, der entweder zu lang oder zu kurz war. Dr. Ferdinand nahm dieses Problem gelassen hin, denn er war lange genug hier, um endlich begriffen zu haben, dass er in der Dritten Welt war, wo ohne Improvisation nichts ging. Er nahm den zu kurzen Nagel und setzte ihm wegen seiner Kürze noch ein paar kräftige Schläge auf den Kopf nach. Der Bruch war gestellt und bewegte sich beim manuellen Verquerungsversuch nicht, so dass er dem jungen Kollegen Pinzette und Nadelhalter übergab und ihm beim Verschluss des Weichteilmantels assistierte. Ob es vorlaut oder Sorge war, es machte keinen Unterschied, als die schon ältere OP-Schwester den jungen Kollegen, der mit den Hautnähten begann, fragte, wie lange er am Hospital arbeiten werde. Dem jungen Kollegen rutschte vor Schreck die Pinzette aus der Hand. Sie fiel zu Boden, die Schwester drückte ihm eine andere in die linke Hand und wartete geduldig auf seine Antwort. „Genau kann ich es nicht sagen“, sagte er fast schüchtern, „doch ich glaube, es wird nicht mehr lange sein.“ Dr. Ferdinand war hellhörig, doch sagte er nichts, um ihn nicht noch mehr aus der Fassung zu bringen. Er tat ihm Leid, weil ihm die Arbeit gefiel und er in der kurzen Zeit viele Erfahrungen sammeln konnte. Auch dachte er an seine Liebesgeschichte, wo die junge schwarze Frau gerade einen gesunden Sohn entbunden hatte und ihr Vater einem Schlaganfall erlegen war. „Ich würde lieber länger hier bleiben als bald nach Südafrika zurückzugehen, denn ich habe hier viel gelernt, was ich dort so schnell nicht gelernt hätte. Dabei habe ich besonders gelernt, dass ich vieles noch zu lernen habe.“ Dr. Ferdinand war ergriffen, und Dr. Lizette schaute dem jungen Kollegen stehend und sprachlos in sein ausgeformtes Langprofil mit der hohen Stirn, den sensiblen Ohren und dem ansprechend gerundeten Hinterkopf. „Sie werden Ihren guten Weg auch dort unten fortsetzen“, meinte Dr. Ferdinand, „und das, was Sie hier gelernt haben, in guter Erinnerung behalten, weil Sie es dort brauchen werden. Sie sollen wissen, dass Sie hier auf Menschen gestoßen sind, die Ihnen gerne zugehört haben und die Ihnen auch etwas sagen durften.“ Der junge Kollege schien leicht in die Knie zu gehen, als er nach dieser Bemerkung den älteren Kollegen ansah, der ihm das Bein für den Wickelverband hochhielt, und meinte, dass er für eine solche Auszeichnung doch noch zu jung sei. Dr. Ferdinand spürte seinen Blick, ohne deshalb zurückzublicken. Menschliche Dinge von dieser Höhe laufen nur dort ab, wo der Mensch in Not gerät, darin gab es für ihn keine Frage mehr, als er das Bein fast dankbar für ein solches Erlebnis auf den Tisch zurücklegte. Die Atmosphäre blieb auch bei den folgenden Operationen gehoben, weil sich die menschlichen Gedanken und Gefühle auf die natürlichste Weise und sympathisch austauschten, die der Worte nicht mehr bedurften. Dr. Ferdinand stellte diesbezüglich einen Vergleich mit Deutschland an, das dagegen kümmerlich abschnitt, wo er beim Operieren solche Menschlichkeit nicht angetroffen hatte, was beim dortigen Wohlstand und Wohlstandsdenken auch nicht verwunderlich war. Dort hatten sich die Menschen, ob Ärzte, Richter oder Rechtsanwälte, in den Wohlstandskäfig verkrochen und die Augen vor den Mitmenschen spätestens seit dem Wirtschaftswunder verschlossen, wenn nicht schon früher, als die Nachbarn über und unter ihnen aus rassischen und politischen Gründen in Lebensnot gerieten, vertrieben und getötet wurden, oder nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft vor verschlossenen Türen oder fremden Männern standen und ihre Frauen sie nicht mehr wiedererkennen wollten. Kinder können davon erzählen, und man kann es nachlesen in Wolfgang Borcherts „Draußen vor der Tür“, Rolf Hochhuths „Der Stellvertreter“, Elie Wiesels „Die Pforten des Waldes“, Dietrich Bonhoeffers „Widerstand und Ergebung“, Paul Schneiders „Der Prediger von Buchenwald“ oder den Abschiedsbriefen, gesammelt in „Du hast mich heimgesucht bei Nacht“ (Gollwitzer/Kuhn/Schneider). Dr. Ferdinand hatte noch einige Sätze aus dem Abschiedsbrief des jungen Studenten Peronneau an seine Eltern im Gedächtnis, die ihn jedes Mal aufs Neue erschütterten: „Ich werde sogleich erschossen werden – um die Mittagsstunde, und jetzt ist es viertel nach neun. Verzeiht mir allen Schmerz, den ich Euch bereitet habe, jetzt bereite und noch bereiten werde. Verzeiht mir alle wegen des Bösen, das ich getan, wegen des Guten, das ich nicht getan habe. Mein Testament ist kurz: ich beschwöre Euch, Euren Glauben zu bewahren. Vor allem: keinen Hass gegen die, die mich erschießen ...“
Hier war es die allgemeine Verarmung, die den Weg zu den Herzen offen gehalten hatte. Er verließ das „theatre“ gedankenbeladen und machte einen Rundgang durch das Hospitalgelände, an den armseligen Sälen vorbei, in denen sich die Patienten stauten, vor denen die Angehörigen standen und geduldig warteten. Was wird die Zukunft bringen? Es war eine schwierige Frage, doch die Zeichen des Umbruchs waren unverkennbar. Den Menschen war es anzusehen, dass sie das Hospital brauchten und darauf vertrauten. Dr. Ferdinand brach seinen Rundgang ab und ging zum Untersuchungsraum im „Outpatient department“, um vor der Mittagspause noch einige Patienten zu sehen, die sich auf den Bänken angesammelt hatten. Es waren Männer, Frauen und Kinder, die da saßen und sich in Geduld fassten, da auch sie sahen, dass es die wenigen Ärzte schaffen mussten. Was sie nicht wissen konnten, war, dass es bald noch weniger Ärzte sein würden, die an ihnen arbeiten sollten. Der Ernst stand in ihren Gesichtern und der Hunger, vom Wasser, das sie tranken, sprachen sie nicht. Er renkte das Ellenbogengelenk bei einem Patienten in den Fünfzigern ein, als der junge Kollege ein sechsjähriges Mädchen an der Hand führte, dem der rechte Daumen abgetrennt war, welcher in einem Stück Tuch eingewickelt lag. Dr. Ferdinand sah keine Chance der Replantation, dafür lag alles zu tief in der Dritten Welt. Sie gingen in den kleinen OP-Raum, legten das Mädchen auf den OP-Tisch, wo Dr. Ferdinand die örtliche Betäubung setzte, den verbliebenen Daumenstumpf mit einem Hautrotationslappen und den Hautdefekt mit einem freien Transplantat deckte. Der Verlust des Daumens oder eines Teils von ihm war stets ein drastischer Funktionsverlust der Hand, weshalb er den Knochenstumpf nicht kürzte, um den verbliebenen Daumen-Finger-Griff so weit wie möglich zu erhalten. Die folgende Patientin war eine ältere Frau, die sich das rechte Handgelenk gebrochen hatte. Dr. Ferdinand übergab sie dem jungen Kollegen zur weiteren Behandlung, der mit ihr in den Gipsraum ging, die Fraktur in Spaltanästhesie richtete, mit einem Gips ruhig stellte und nach etwa einer halben Stunde mit der Patientin wieder zurückkam. Die Hälfte der Mittagspause war vorüber, als sie zusammen den Speiseraum betraten und sich die Teller füllen ließen. Beim Essen drückte der junge Kollege sein Bedauern aus, dass er und die anderen Kollegen in Uniform vorzeitig abgezogen wurden. Er hatte sich auf ein Jahr eingestellt, in dem er viel lernen und auch mit seinem Buch vorankommen wollte. Dabei meinte er, dass für beides Oshakati der richtige Ort war, weil die Unruhen des Krieges und das Elend der Menschen zum Lernen und Schreiben herausforderten. Dr. Ferdinand meinte dazu, dass mit weniger Krieg und weniger Elend nicht weniger gelernt und geschrieben würde, weil das aus der Stärke der Persönlichkeit selbst kommt. „Aber hier konnte ich mich auf die Menschen besser einstellen, mich auf ihre Probleme besser konzentrieren, weil es nicht die Ablenkungen des städtischen Lebens gab, die es einem in Südafrika schwer machen, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren und dem roten Faden zu folgen.“ Dr. Ferdinand wollte es besser verstehen und fragte ihn, was er unter wesentlich und dem roten Faden verstand. „Wesentlich ist für mich“, setzte der junge Kollege an, „die Not und den Hunger der Menschen im Auge zu behalten, weil daraus das Elend abzulesen ist, wie Menschen mit Menschen verfahren, denen allen doch das Recht gleichermaßen zusteht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Da kann es keine Lücke geben, in die sich der weiße Wohlstand mit seinem Unrecht eindrückt, wenn gleich daneben das schwarze Elend sitzt mit den todgeweihten Kindern des ,Kwashiorkors’. Ich sehe es als ein Unrecht an, die Menschen nach der Hautfarbe zu klassifizieren und zu degradieren, weil ich Menschen der schwarzen Hautfarbe kenne, die um ein Mehrfaches begabter, intelligenter und vor allem menschlicher sind als jene der weißen Hautfarbe, die Schulen und Universitäten besuchen und sich um die medizinische Versorgung auf einer Intensivstation keine überflüssigen Gedanken machen müssen.“ Dr. Ferdinand fand diese Bemerkung interessant und fragte ihn, ob er das Buch „The Unwanted“ von Christiaan Barnard gelesen habe. „Ich habe von dem Buch gehört, gelesen habe ich es nicht. Ich konnte es in keiner Buchhandlung bekommen, weil es ständig vergriffen war. Aber ich habe gehört, dass ein schwarzer Patient länger auf eine Operation warten muss als ein weißer, und dass ein schwarzer Patient nach einer schweren Operation nicht auf die Intensivstation gebracht werden durfte, wenn dort ein weißer Patient nach einer weniger schweren Operation lag. Die Wertigkeit des Lebens nach der Hautfarbe festzulegen, ist doch ein Unrecht, das gegen alle Grundprinzipien der Zivilisation verstößt. Aber in Südafrika ist es möglich, weil da das Weiß oben und das Schwarz unten ist und das nicht zusammengehen darf, was der Ausgangspunkt meines Buches ist.“ Dr. Ferdinand sagte ihm, dass er darüber ein Gespräch mit einem „Senior consultant“ geführt hatte, der am selben Hospital arbeitet, wo Professor Barnard 1968 seine erste Herzverpflanzung vorgenommen hatte, der ihm versicherte, dass die Hautfarbe in der medizinischen Versorgung keine Rolle mehr spielte, was den Zugang zur Intensivstation einschloss. „Die Farbliberalisierung in der ärztlichen Behandlung ist so alt nicht“, meinte der junge Kollege, „und bis auf den Tag muss ein schwarzer Patient länger auf eine dringliche Operation warten als weißer. Und da kommt der rote Faden herein, der sich um die menschliche Würde dreht, der sich von oben bis unten klar durchzieht, wenn die Hautfarbe weiß ist, dagegen zerfasert und zerreißt, wenn die Farbe schwarz ist.“ „Ich hätte so gern noch mehr aus Ihrem Buch erfahren“, fuhr Dr. Ferdinand fort, „nun macht uns die Zeit einen Strich durch die Rechnung. Können Sie schon sagen, wann Sie nach Südafrika zurückkehren?“ Der junge Kollege druckste mit der Sprache herum: „Es kann schon Ende des Monats sein, doch ganz sicher ist es nicht.“ Der Wärter räumte die abgegessenen Teller zusammen. So verließen sie den Speiseraum und machten sich auf den Weg zum „Outpatient department“, um die Patienten zu sehen, die dicht gereiht auf den Bänken warteten. Auf der Liege im Untersuchungsraum lag bereits ein älterer Mann, der erheblich abgemagert war. Die Schwester sagte, dass Dr. Lizette ihn gebracht hatte und bei der Untersuchung dabei sein wollte. „Dann können Sie sie holen“, sagte Dr. Ferdinand und öffnete den alten Ledergürtel und den obersten Hosenknopf, zog die Hose mit dem zu weiten Bund nach unten bis über die Schambeinfuge, schob das angeschwitzt vergraute Hemd nach oben, so dass der Rippenbogenwinkel stark hervortrat, und legte seine rechte Hand auf den Bauch des Patienten, als Dr. Lizette sich neben ihn stellte und ihm die Krankengeschichte vortrug. Sie ging einige Monate zurück mit Bauchschmerzen, unregelmäßiger Stuhlentleerung und Blutbeimengung in den letzten Wochen. Das Vorliegen einer Tumorerkrankung lag auf der Hand, und Dr. Ferdinand tastete ihn im linken Mittelbauch, was er dem Dickdarm zuordnete. Bei der vergrößerten Leber äußerte er den Verdacht auf Metastasen und schlug deshalb eine Probelaparotomie vor, um die Diagnose eines bösartigen Wachstums zu sichern. Dr. Lizette nahm den Patienten mit in ihren Untersuchungsraum, nahm ihn stationär auf und setzte seinen Namen zu jenen Namen hinzu, die noch zu operieren waren. Eine Mutter setzte ihren kleinen Sohn auf den Schemel, der vom Baum gefallen war und sich den linken Unterarm gebrochen hatte. Dr. Ferdinand ging mit beiden zum Gipsraum, legte den Jungen auf die Liege, gab ihm eine Spritze für die Kurznarkose, stellte die Frakturen von Elle und Speiche in die richtige Achse und legte einen gepolsterten Gipsverband an, der vom Handgelenk bis zum Oberarm reichte. Der junge Kollege, der im kleinen OP-Raum mit zwei Wundversorgungen zugange war, ließ ihn rufen, weil er bei einer verletzten Hand zwei durchtrennte Sehnen am Handrücken fand und wissen wollte, wie er sie zusammennähen sollte. Dr. Ferdinand führte es ihm an einer Sehne vor, die zweite nähte er selber zusammen. Der Untersuchungsraum war von Menschen gefüllt, als ein Mädchen auf einer Trage hereingeschoben wurde, dem eine Mine den rechten Fuß und den linken Unterschenkel abgerissen und Verletzungen im Gesicht und an beiden Händen und Armen gesetzt hatte. Es wurde Kreuzblut abgenommen, da das Mädchen erheblich an Blut verloren hatte, das aufgefüllt werden musste. Die Notoperation war dringlich, so informierte Dr. Ferdinand die Schwestern vom OP-Raum, die Verletzte zu holen, und Dr. Lizette, die Narkose zu geben. Er beeilte sich mit den Patienten, die neben dem Tisch standen und ihm die Tüten mit den Röntgenkontrollen entgegenhielten, und überließ die restlichen Patienten dem jungen Kollegen, dem er es zutraute, damit fertig zu werden. Er legte noch einen Schritt zu, um keine Zeit zu verlieren, warf seine Sachen im Umkleideraum über den Haken und hatte sich das grüne Hemd verkehrt herum übergezogen, als er das Mädchen im OP-Raum auf den Tisch legte, wo Dr. Lizette die Spritze zur Einleitung schon aufgezogen und die weiteren Vorbereitungen zur Narkose getroffen hatte. Die Schwester im grünen Kittel packte das Sieb aus und legte die Instrumente auf ihrem Tisch zurecht. Dr. Ferdinand wusch sich die Hände und war in Gedanken bei dem Mädchen, dem die Mine zwar nicht das Leben, aber das Glück auf Lebenszeit genommen hatte. Er trennte den unteren Teil des rechten Unterschenkels und den linken Oberschenkel oberhalb des Kniegelenks vom Körper ab, schliff die Knochenenden mit einer Feile glatt und vernähte die Schichten des Weichteilmantels über den Stümpfen. Die Wunden im Gesicht und an Armen und Händen wurden chirurgisch versorgt, wobei eine plastische Wiederherstellung der Augenoberlider, des rechten Ohres und Nasenflügels und der Ober- und Unterlippe erforderlich war. Am Ende der Operation war das verlorene Blut durch eine Konserve weitgehend aufgefüllt, doch war der Anblick des verstümmelten Mädchens, dem ein erbärmliches Leben zu prophezeien war, ein überaus trauriger. Dr. Ferdinand hatte schon vielen Kindern, die auf eine Mine getreten waren, Beine und Arme abgeschnitten, und jedes Mal stellte sich ihm beim traurigen Anblick des Restkörpers die Frage nach dem Sinn des Lebens, weil er sich oft der Meinung nicht erwehren konnte, dass der Tod eine Gnade gewesen wäre und vielleicht besser, als so entstellt und verstümmelt das Leben fortzusetzen, wo es mit der menschlichen Würde ja auch nicht mehr stimmen konnte, zu der doch die Unversehrtheit des Körpers gehörte. Er ging in den Teeraum, wo der junge Kollege schon saß und ihm über die Besonderheiten berichtete, mit denen er bei der Durchsicht der restlichen Patienten befasst war. Er überzeugte ihn durch seine Darstellung, dass er die Probleme mit Kopf und Geschick gelöst hatte, wofür ihm Dr. Ferdinand dankte. Es war zwischen sechs und sieben und die reguläre Arbeitszeit war längst vorüber, so dass sie sich etwas mehr Zeit beim Teetrinken ließen. Dr. Lizette war vom Anblick des Mädchens nachhaltig mitgenommen, denn sie drückte ihre Trauer mit den Worten aus, dass ihr das Mädchen sehr Leid täte, weil sie nichts Gutes mehr vom Leben zu erwarten hätte. Das Glück, geboren zu sein, wäre schlagartig ein Unglück geworden, das nicht mehr von ihr wiche, mit dem sie zu Lebzeiten nicht fertig werden würde. Mit dieser Bemerkung hatte sie sich gedanklich Dr. Ferdinands Bedenken genähert, für den die körperliche Verstümmelung ein kräftiger Einschlag in die menschliche Würde bedeutete, wonach das mit dem Leben auch nicht mehr gut gehen konnte. Er machte ihr die traurige Mitteilung, dass es schon über hundert Kinder waren, die er, weil sie die Explosion überlebt hatten, auf chirurgische Weise verstümmelt hatte. „Das ist ja entsetzlich!“, fuhr es ihr ohne größeres Nachdenken heraus, und sie hatte Recht dabei. Das Gesicht des jungen Kollegen war erblasst, als würde er mit den Kindern mitleiden, weil er das Ausmaß des Unglücks begriffen hatte. Er machte eine interessante Bemerkung, als er sagte, dass die ethische Verantwortung sicherlich ihre Grenze im Leben habe, deren Entscheidung allerdings außerhalb der ärztlichen Befugnisse liege. Es war eine existenzialphilosophische Bemerkung von beachtlicher Höhe, die der junge Kollege da von sich gab, aus der sein weit reichendes Denken herauszuhören war. Dr. Ferdinand gab ihm Recht, als er erwiderte, dass der Arzt wie der Schuster bei seinem Leisten bleiben müsse und das tun sollte, von dem er etwas versteht. Da auch der Arzt sich irren konnte, weil er ein Mensch war, dürfte er sich eine solche Entscheidung nicht zutrauen, bei der er sich überheben würde und Fehler machen könnte, da ihm dieses Territorium nicht gehörte.
Dennoch gab er zu bedenken, dass er sich bei einer solchen Operation jedes Mal der statistischen Unterlegenheit bewusst war, die ihm sagte, dass im selben Augenblick, während er einem Kind Arme und Beine abschnitt, eine Vielzahl von Kindern durch Minen in der Luft tödlich zerrissen wurde. Und da einen Sinn hereinzubringen, das komme ihm der Quadratur des Kreises gleich. „Oder einem Differential, wo die Vernunft auf der Zeitachse des Lebens gegen null gesetzt wird“, ergänzte der junge Kollege, weil er es verstanden hatte, was Dr. Ferdinand für einen Moment die gedankliche Fassung verlieren ließ, weil er ein Genie vor sich zu sehen glaubte, das trotz seiner Jugendlichkeit das Leben mit seinen gestuften Sinnfälligkeiten rauf und runter differenzieren konnte, was bei ihm an die Grenze des Fassungsvermögens ging. „Das ist ja unglaublich, was Sie da sagen. Wie kommen Sie darauf, dass man die Vernunft gegen null setzen kann?“, fragte er fast gedankenentrückt. „Weil dieses Nullsetzen etwas zu tun hat mit der Überwindung eines Machtvakuums, das nur kurzzeitig andauert, weil sich die Machtstrukturen wie sichtbare Fäden in einem gläsernen Würfel durch die Gesellschaft ziehen und Arme und Beine zusammenhalten, was beim Verlust zu einem Torso führen würde, der weder greifen noch gehen kann, weil ihm Arme und Beine abgeschlagen sind. Für ein zusammengesetztes Gebilde, wie es der Staat ist, würde das einem allgemeinen Chaos gleichkommen. Und da sich der Staat auf die Macht versteht und ein solches Vakuum von Staatswegen nicht zulassen kann, kommt es den Menschen an den Hebeln der Macht auf die Vernunft nicht mehr an, sonst käme nicht so viel Unsinn auf den diversen Wegen des Staates heraus, die vom Perversen, das der Macht ohne Vernunft tief innewohnt, nicht zu trennen sind. Von daher ergibt sich der Differential schritt mit dem Nullsetzen der Vernunft visuell, fühlbar und logisch aus der unmittelbaren Beobachtung, die direkter nicht sein kann und die jeder täglich bis zum Überdruss machen kann.“ Dr. Ferdinand gab sich geschlagen und gratulierte dem jungen Kollegen für seine Beobachtungsgabe mit der einleuchtenden, weitergedachten Ableitung. Für ihn war es ein interessanter Auszug aus der angewandten Infinitesimalrechnung, die auch dem theoretischen Begründer, Gottfried Wilhelm Leibniz, ein Schmunzeln abgerungen hätte.
Sie verließen den Teeraum und traten in die Abenddämmerung hinaus, überquerten den weniger urinös riechenden Vorplatz und gingen auf das neu errichtete Ausfahrtstor zu, wo an diesem Abend zwei Pförtner standen, um dem Tor eine vieräugige Aufmerksamkeit zu schenken, die miteinander sprachen und sich von den Vorübergehenden nicht stören ließen. Dr. Ferdinand blickte, wie er es jeden Abend tat, zu den Menschen zurück, die sich ihr Nachtlager auf dem Betonboden vor der Rezeption herrichteten. Ihnen allen, es war eine stattliche Zahl, wünschte er eine ruhige Nacht. Dr. Lizette wurde von ihrem Mann mit dem Auto abgeholt, der Dr. Ferdinand und dem jungen Kollegen die Mitfahrgelegenheit, auch „Lift“ genannt, anbot, was beide dankend ausschlugen, weil sie den Rückweg als Spaziergang durch den frühen Abend verstanden und dabei miteinander reden wollten. So gingen sie den abgekürzten Weg zwischen Lattenzaun und Stacheldraht entlang und an den fünf Caravan-Häusern vorbei, von denen zwei schon unbewohnt waren. Der Horizont, an dem die Sonne vor wenigen Minuten untergegangen war, glühte noch feuerrot und zog rote Himmelsstreifen, die ins Violett wechselten, bedeutungsvoll nach. Der junge Kollege erzählte ihm beim Anblick dieses Lichtspektakels, dass er solche himmlischen Erleuchtungen auch der jungen Familie an der Palliser Bucht zuschreiben möchte, wo sich über den Wellen des Stillen Ozeans die Sonne in allen Farben spiegelt, bevor sie in den Meeresweiten untertaucht. In diesem Zusammenhang fragte ihn Dr. Ferdinand, ob er denn auch die Landschaft um die Bucht beschreiben würde, die weiter landeinwärts ging. „Das ist schon ein Problem, weil ich das hügelige Hinterland nur in einigen ,Geographic’-Fernsehstreifen gesehen habe. Aus dem Gedächtnis versuche ich das Beste daraus zu machen und nehme dabei die Hügel vom Westkap, die bis zum Atlantik reichen, und die Weinhügel vom Ostkap zu Hilfe, wo ich mich besser auskenne und diese paradiesische Landschaft auch den Bewohnern hinter der Palliser Bucht zukommen lasse, damit sich die junge Familie vertrauter fühlt.“ Sie passierten den Kontrollpunkt, wo die Wachhabenden das Gesicht des zivilen Doktors kannten und auf das Vorzeigen des „Permits“ verzichteten, weil sie ihn mit dem jungen Kollegen in Uniform in guter Begleitung fanden. Ihre Wege trennten sich, und sie wünschten sich gegenseitig eine ruhige und erholsame Nacht. An der Tür zur Veranda steckte ein Zettel, auf dem Herr C. um einen Anruf bat. Er teilte Dr. Ferdinand am Telefon mit, was dieser schon wusste, dass nämlich die Ärzte, die hier ihren Wehrdienst ableisteten, in Kürze vom Hospital abgezogen würden. Er konnte den genauen Termin des Abzugs nicht sagen, so wie ihn der junge Kollege im „theatre“ am Morgen auch nicht kannte. Herr C. drückte seine Sorge um die sich verschlechternde Lage aus, wobei er jedoch weniger ans Hospital als an die weißen Menschen im Dorf dachte, weil er nur von ihnen und ihren Familien sprach und seine Familie dabei wörtlich einbezog. Er sagte, dass einige Familien aus Gründen der Sicherheit bereits ihre Sachen in Kartons verstaut hätten und nach Südafrika zurückkehren wollten, weil sie die Granateneinschläge sich und ihren Kindern nicht länger zumuten könnten. „Haben Sie Ihre Sachen auch schon gepackt?“, fragte Dr. Ferdinand. „Noch nicht, aber ich denke ernsthaft darüber nach, denn die Kinder können schlecht einschlafen und sitzen nachts mit Angstträumen in ihren Betten“, sagte er väterlich besorgt. Herr C. nannte Gott bei seinem Namen, dessen Obhut er seine Familie anvertrauen und sich auf ihn verlassen würde. Von den schwarzen Familien mit ihren Kindern und den Patienten im Hospital sprach er in diesem Zusammenhang nicht. Vielleicht waren seine Gedanken zu sehr auf die eigenen Ängste ausgerichtet, so dass von diesem Gedankenbündel kein Strohhalm für die anderen übrig blieb. MG-Salven waren zu hören, als Dr. Ferdinand sein Abendbrot im Wohnzimmer zu sich nahm, die von den Wassertürmen herab den sandigen Boden bestrichen, weil sich da offensichtlich etwas bewegte, wo sich nichts bewegen sollte und von daher verdächtig war. Er ließ sich dadurch nicht stören, weil er mit derlei Salven vertraut gemacht wurde, als er noch nicht zehn war. Da Hunde zu bellen begannen, kamen ihm unwillkürlich Erlebnisse in den Sinn, die der Krieg, die Flucht vor der Roten Armee und die deutsch-deutsche Grenze ihm mitgegeben hatten. Ein Leben ohne Schießen war für ihn nicht vorstellbar, weil den Menschen die Vernunft fehlte, zu begreifen, dass es ohne Schießen besser ginge. Er dachte über den Satz des jungen Kollegen nach, der beim DenkDifferential die Vernunft auf der Zeitachse des Lebens gegen null setzte, weil es dem Menschen um die Macht ging, die mit der Vernunft nichts gemeinsam hatte, solange die Verelendung fortschritt. Diesen Differential schritt begründete er mit Beobachtungen, die jeder auf direktem Wege machen könne. Der Schritt hatte unmittelbaren Realitätsbezug, dem man sich denkerisch nicht entziehen konnte, weil es praktisch aus dieser Realität kein Entkommen gab. Dr. Ferdinand machte sich die folgende Notiz:
Weil es zur Vernunft nicht reicht, müssen Menschen hungern. Wenn es um die Macht geht, ist es ums Brot schlecht bestellt. Reichtum kann die Armut nicht aufwiegen, was er auch nicht will. So mehrt sich das eine bei den wenigen, das andere bei den vielen. Was sich da herauswächst, ist die ekelhafte Ungestalt des Monsters, dem die Geier der Habgier auf der Schulter sitzen.