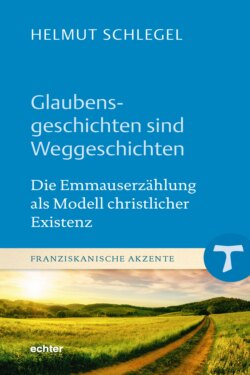Читать книгу Glaubensgeschichten sind Weggeschichten - Helmut Schlegel - Страница 7
Оглавление1. Bewegt und beweglich – eine Art Vorwort
Nicht nur Menschen bauen Wege. Auch Tiere tun es. Ameisen legen Straßen fest, auf denen sie die Baustoffe für ihre Behausungen transportieren. Maulwürfe graben unterirdische Gänge, in denen sie sich bewegen, Zugvögel kennen ihre Wege in den Süden und zurück. Alle Geschöpfe, die beweglich sind, kennen Wege – auf der Erde, im Wasser und in der Luft.
Dennoch sind die Wege der Menschen einzigartig. Wir werden bewegt und sind beweglich, weil Bewegung zu unserem Wesen gehört. Der aufrechte Gang ermöglicht uns eine besondere Form der Bewegung. Zu Fuß erwanderte sich der Mensch die ganze Erde. Die Erfindung des Rades ermöglichte ihm später ganz neue Formen der Fortbewegung. Die Fußwege genügten nicht mehr. Straßen wurden gebaut für die Handkarren, Pferdewagen, Kutschen, Automobile. Und auch durch die Flüsse und Meere, selbst durch die Luft schufen Menschen Wasserstraßen und Flugrouten.
Wir brauchen Wege, weil wir beweglich sind. Wir brauchen sie auch im übertragenen Sinn. Denn Wege sind im Grunde Kommunikationsmittel. Der Weg „von mir zu dir“, die Aufnahme von Beziehung setzt voraus, dass ich nicht bei mir bleibe, sondern mich aufmache, „zum anderen gehe“ oder auch „mit dem anderen gehe“. Das bedeutet, einen inneren Weg zu beschreiten, den Weg des Zuhörens, des Vertrauens, der Liebe. Es bedeutet im ge-
sellschaftlichen Sinn, gemeinsam Wege zu suchen und zu gehen: in Familien, Freundeskreisen, Kommunen, Religionen, Kulturen. Es bedarf des Mutes aufzubrechen, Standorte und Standpunkte zu verlassen, sich in Bewegung zu setzen. Nur in Bewegung kann die Menschheit fortschreiten auf dem Weg der Freiheit, der Verständigung, der Versöhnung, des Friedens.
Im übertragenen Sinn sprechen wir auch von Wegen des Glaubens. Die Religionen sind Wege zu Gott. Die Offenbarungsreligionen betonen, dass diese Wege keine Einbahnstraßen sind. Sie gehen davon aus, dass Gott gefunden werden will und dass er dem Menschen die entscheidende Wegstrecke entgegengeht.
Nicht genug damit: In Jesus Christus wird Gott selbst zum Weg. Er lässt sich ein auf die Welt, auf das Geschöpf, auf den Menschen, nimmt die Gestalt der Vergänglichkeit an, lebt und leidet mit uns, teilt mit uns Freude, Hoffnung und Schmerz und macht sich gemeinsam mit uns auf die Suche nach dem „abba“, dem Mutter-Vater-Gott, die/der uns so geheimnisvoll und doch so nahe ist.
Das Neue Testament lädt ein, den Weg Jesu mitzugehen. Nachfolge ist das entscheidende Wort christlicher Glaubenspraxis. Vor allem das Lukasevangelium entfaltet eine „Theologie des Weges“. Es ist aufs Ganze gesehen ein Reisebericht, der Jesus auf dem Weg nach Jerusalem zeigt. Dieser wird ausgestaltet durch eine Vielzahl von Begegnungen, Belehrungen, Gleichnissen und Heilungsberichten. So wundert es nicht, dass Lukas sein Evangelium auch mit einer Weggeschichte beschließt. In der Emmauserzählung fasst er noch einmal die wesentlichen Grundaussagen des ganzen Evangeliums zusammen. Dabei komponiert er dieses „Finale“ zu einer Art „geistlichem Navigator“, um die Leserinnen und Leser sicher auf ihrem Glaubensweg zu geleiten. Er hilft ihnen bei Entscheidungen an Wegkreuzungen, gibt das richtige Tempo vor und weist auch deutlich auf die Hindernisse und Gefahren des Weges hin. Lukas hat aber nicht nur den einzelnen Menschen im Blick, seine Emmauserzählung stellt zugleich auch eine Charta für das geistliche Leben in Gemeinschaft und Gemeinde dar.
Der Weg ist ohne Zweifel ein konstitutives Merkmal der franziskanischen Bewegung – und dies nicht nur als Metapher, sondern auch im wörtlichen, physischen Sinn. Das Neue an Franziskus ist, dass er die Welt als sein Kloster betrachtet und den Weg zu seinem Aufenthalts- und Bewegungsraum erklärt. Dies kommt in allen seinen Gebeten, Regeln und Schreiben zum Ausdruck. Seine Biographen werden nicht müde, zu betonen, dass Franziskus und seine Bruderschaft Menschen des Weges sind. Eine geistig-geistliche Nähe zur lukanischen Wegthematik ist unverkennbar. Da wundert es nicht, dass der Bericht des Thomas von Celano im 14. Kapitel seiner „Ersten Lebensbeschreibung des heiligen Franziskus“ mit der Überschrift „Seine Rückkehr aus der Stadt Rom ins Spoletotal und sein Verweilen auf dem Weg“ (1 C 14, FQ 219) deutliche Parallelen zur Emmauserzählung aufzeigt.
Dieser Band der „Franziskanischen Akzente“ will nicht nur dieser „Verwandtschaft“ nachgehen, sondern darüber hinaus eine spirituelle Hilfe für die Praxis bieten: die Emmauserzählung und ihre franziskanische Variante als Grundlage für einen persönlichen Exerzitienweg sowie als Modell geistlicher Gemeinde- und Gemeinschaftskultur.