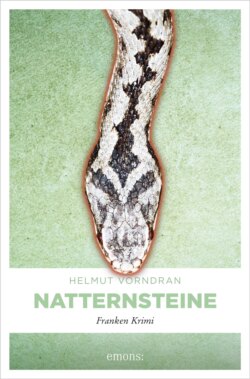Читать книгу Natternsteine - Helmut Vorndran - Страница 10
Sündenfall
ОглавлениеEs war noch nicht ganz hell gewesen, als Otmar Schober in der Frühe aufgebrochen war. Aber schließlich begannen am heutigen Freitag die Pfingstferien, und da musste man früh raus, wenn man am Kemnitzenstein als Erster seine Füße auf den Felsen setzen wollte. Wer zu spät kam, den bestraften die Touristen – eine alte und besser zu beherzigende Kletterregel. Lange vorbereitet, hatte sich Schober für sein Kletterevent zielgenau den kühlsten Tag des Monats ausgesucht. Letzte Nacht hatten die Temperaturen dank der Schafskälte noch einmal nahe am Gefrierpunkt gelegen, was zu einem reichlich nebelverhangenen Morgen geführt hatte. Dafür sollte es laut Wetterbericht später recht sonnig und auch leidlich warm werden.
Davon war während der Fahrt allerdings nicht viel zu sehen. Die dichte Nebelsuppe bremste sein Tempo nachhaltig, und Schober baute innerlich die erste Ungeduld auf, noch bevor er sein Ziel erreicht hatte.
Auch als Otmar Schober in Kümmersreuth ankam, war er aufgrund des dichten Nebels gezwungen, die kleine Ortschaft im gemächlichen Schritttempo zu durchfahren, um dann den Weg an einem Steinbruch vorbei zur zweithöchsten Erhebung des Lichtenfelser Landkreises zurückzulegen.
Als er ziemlich genervt den Kemnitzenstein erreichte, drang zwar schon ein diffuses Sonnenlicht durch den zähen Nebel, allerdings war es mehr zu erahnen als zu sehen.
Eigentlich bot die geschlossene Nebelschicht, die einer Decke aus weißer Watte glich, einen wunderschönen Anblick, wie sie da so knapp zwei Meter über dem Boden schwebte. Zumindest für die, die ein Auge für derartige Schönheiten besaßen.
Otmar Schober jedoch hatte nichts übrig für die Ästhetik der Natur, er war vom sportlichen Ehrgeiz zerfressen und wollte heute unbedingt die lange geplante Klettertour absolvieren. Klettern war sein Ein und Alles, und er war inzwischen auch richtig gut darin. Einen Siebener ohne Sicherung zu erklimmen, das konnte nun wirklich nicht jeder. Er aber schon, und da bildete er sich auch gewaltig was drauf ein. Wenn allerdings nicht bald die Sonne auf dem Gelände die Herrschaft übernahm, würde es nichts werden mit seinem ehrgeizigen Unterfangen.
Schober fuhr mit seinem Wagen vor bis zur Schutzhütte. Hier durfte man eigentlich nicht parken, aber wen sollte das bei dem dichten Nebel schon stören? Außerdem sparte er sich so ein gutes Stück Strecke, sprich: Zeit, die er ja auf das Klettern verwenden wollte. Am Felsen begann sich der Nebel allmählich zu heben, sodass Otmar Schober, als er sich mit seinem Kletterrucksack auf den Weg zum Fuße der Felswand machte, mit seinem schütteren Haupthaar nicht einmal mehr die Unterseite des feuchten Dunstes berührte, der sich um den Berg gelegt hatte. Aber oben war alles noch dicht.
Na super, dachte Schober frustriert. Ausgerechnet heute, bei so einer schlechten Sicht, hatte er sich den »Rammelhasen« vorgenommen, die anspruchsvollste Tour am Kemnitzenstein.
Wer auch immer sich den schlüpfrigen Namen ausgedacht hatte, musste klettertechnisch schon etwas draufgehabt haben. Die Tour war nichts für Anfänger, leicht überhängend, eine glatte Sieben plus. Aber auch nur, wenn es trocken war und die Sicht einigermaßen klar. Weder das eine noch das andere traf im Moment zu. Gut, der Kemnitzenstein trocknete schnell, wenn die Sonne herauskam, aber in so eine Suppe hineinzuklettern, das war mindestens gewagt. Schober wollte dennoch nicht zu lange warten, sonst kamen nämlich die anderen üblichen Verdächtigen der Kletterszene angekrochen, und dann war es vorbei mit der Beschaulichkeit am Fels. Das wäre überhaupt nicht in seinem Sinn, wohnte ihm doch ein gewisses Streben nach Erfolg inne, sowohl beruflich als auch privat.
Otmar Schober musste nicht als Letzter irgendwo ankommen. Er war ein Gewinner, quasi der Donald Trump der Felskletterei. Aus diesem Grund kletterte er auch am liebsten allein, als Erster in der Früh und natürlich Free Solo, das hieß ohne Sicherung durch einen anderen. Denn Free Solo kletterten nur die wirklichen Könner, die, die sich auf ihre Kletterei tatsächlich etwas einbilden durften.
Schober schaute nach oben und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass sich der Nebel immer mehr nach oben bewegte, während das schräg einfallende Sonnenlicht allmählich seine Kraft in der Atmosphäre entfaltete. Eindeutige Zeichen einer Verbesserung der allgemeinen äußeren Bedingungen, die Otmar Schober dazu veranlassten, seine Klettertour noch vor der endgültigen Klärung der Sicht zu starten. Bis er hier alles ausgepackt und gerichtet hatte, war der watteartige Nebel bestimmt über den Felsen des Kemnitzensteins hinweggewandert, und er, Otmar Schober, konnte sich als Erster des heutigen Tages in der Vertikalen mit dem »Rammelhasen« beschäftigen.
Er setzte den rechten Fuß auf einen kleinen Felsvorsprung und fasste mit beiden Händen über seinem Kopf in die dortigen Ausbuchtungen im porösen Felsen des Kemnitzensteins. Dann verlagerte er sein Gewicht und begann Zug um Zug seinen Aufstieg am »Rammelhasen«. Langsam, aber konsequent arbeitete er sich am Fels entlang nach oben, während die Nebelschicht über ihm immer näher rückte. Schobers Hoffnung, dass der Nebel sich während seiner Kletterei auflösen oder wenigstens in höhere Etagen verabschieden würde, erfüllte sich leider nicht. Lediglich das Sonnenlicht drang inzwischen um einiges leichter hindurch, was ihm aber auch nur bedingt weiterhalf.
So kam es, dass Otmar Schober bis zur circa fünf Meter über dem Boden befindlichen Nebelgrenze hinaufkraxelte, dort angelangt aber schließlich überlegen musste, ob er in den Nebel hineinklettern oder, was weit vernünftiger war, einfach wieder umkehren sollte. Ohne Sicht zu klettern stellte ein hochriskantes Abenteuer dar, auch wenn es bis zur Oberkante des Felsens nicht mehr allzu weit sein konnte.
Da hing er nun wie eine Spinne im Felsen, starrte mit unentschlossenem Blick auf die watteartige Sperre über ihm und hoffte auf eine Eingebung. Zurück nach unten wollte er nicht, dafür war er schon zu weit gekommen. Aber nahezu blind weiterzuklettern, noch dazu völlig ungesichert, das war ein Ritt auf der Rasierklinge.
Nun, wie der Römer Ovid schon sagte: »Ich sehe das Bessere und billige es, folge aber dem Schlechteren.« Gemäß diesem Motto traf Otmar Schober die unvernünftige Entscheidung. Frustriert nahm er seine rechte Hand vom Gestein und hob sie in den Nebel, um nach der nächsten Griffmöglichkeit zu tasten. Sehen konnte er zwar nichts, aber zumindest mit den Fingern fühlen.
Zuerst war da nichts als glatter Fels, der noch dazu ziemlich feucht, ja regelrecht von einer zähflüssigen Schmiere bedeckt zu sein schien. Dann stießen seine Finger auf ein Hindernis. Dieses Hindernis war allerdings kein Fels, und es war auch nicht mit dem Kemnitzenstein verbunden. Es fühlte sich für Otmar Schober eher so an, als ob da direkt über seinem Kopf etwas baumelte, an dem er sich klettertechnisch vorbeiarbeiten musste. Vielleicht eine Baumwurzel oder etwas Ähnliches, aber dafür war es eigentlich zu weich.
Als er das seltsame Teil weiter befingerte, stellte Schober fest, dass es sich bei dem herabhängenden Ding mit Sicherheit um keinen Ableger eines wie auch immer gewachsenen Baumes handelte. Seine Finger fühlten jetzt ganz eindeutig Stoff. Menschlich angefertigten Stoff mit Knöpfen, um genau zu sein, ergo die Bestandteile eines Kleidungsstückes. Auch daran haftete diese seltsame Schmiere, was in dem Kletterer die ersten unguten Gefühle aufkommen ließ.
Dann landete ein Tropfen auf Otmar Schobers Schulter. Als er den Kopf zur Seite drehte, erkannte er, dass sich auf seinem Klettershirt ein kleiner roter Fleck befand, der haargenau aussah wie Blut.
Otmar Schober erstarrte, und es lief ihm auf einmal eiskalt den Rücken hinunter. Ruckartig zog er seine Hand aus dem Nebel und erblickte eine dicke, schmierige Schicht geronnenen Blutes auf seinen Fingern. Sein erster Impuls war es, schleunigst den Rückzug anzutreten. Doch statt mit dem Abstieg zu beginnen, starrte er nur hilflos auf seine blutverschmierte Extremität, und seine Gefühle schlugen im Stakkato Purzelbäume. Dann, nach einigen Sekunden der Besinnung, gewann die ihm angeborene Coolness die Oberhand, und es siegte die Neugier. Wagemutig schob er seine rechte Hand erneut nach oben, hinein in das neblige Nirgendwo, und packte entschlossen zu.
Wieder war da dieser Stoff zu spüren, an dem Otmar Schober jetzt ein wenig zog, um vielleicht Genaueres über die Beschaffenheit und den Zustand des über ihm Befindlichen zu erfahren. Sein Plan ging allerdings nicht wirklich auf, denn die Umstände machten nicht mit. Zuerst, kaum dass er mehr an dem Stoff gezupft als gezogen hatte, geriet das Etwas im Nebel über ihm in Bewegung, dann rutschte es aus diesem heraus auf ihn zu. Schober konnte mit dem Oberkörper gerade noch ein paar Zentimeter zur Seite ausweichen, sonst hätte es ihn mitten ins Gesicht getroffen. Aber es verfehlte ihn gerade so und baumelte nun genau vor seiner Nase.
In etwa fünf Metern Höhe in den Felsen des Kemnitzensteins gekrallt, starrte Otmar Schober auf die blutverschmierte Hand eines Menschen, welche allerdings einen eher unvollständigen Eindruck machte. Irgendwer hatte den Ringfinger entfernt, und zwar auf sehr unsanfte Art und Weise, wie die ausgefransten Ränder der blutigen Wunde nahelegten. Egal, was das auch zu bedeuten hatte, es konnte nichts Gutes sein. Otmar Schober war geschockt und ob des Anblickes ein weiteres Mal unfähig, sich zu rühren. Sein Körper verkrampfte, was in seinen Oberschenkeln zu einem heftigen, schnellen Zittern führte, der bei Kletterern allgemein bekannten »Nähmaschine«.
Dies war endgültig das Signal für Schober, den geordneten Rückzug nach unten anzutreten. Ein Ansinnen, bei dem ihm sein ungebetener Fund behilflich war und die Angelegenheit auf unerwartete Weise beschleunigte. Baumelte der Arm mit der ringfingerlosen Hand gerade noch wie das taktgebende Gewicht einer Standuhr vor seinem Antlitz, so musste Schober nun mit vor Angst geweiteten Augen feststellen, dass seine Zieh- und Zerr-Aktion das natürliche Gleichgewicht von Arm und Anhang in Unordnung gebracht hatte. Durch die Gesetze der Schwerkraft bedingt, begann das, was sich weiter oben im Nebel befand, nun ebenfalls den Weg nach unten anzutreten.
Hektisch suchten Schobers Finger nach einem seitlichen Ausweg aus der Katastrophe. Aber das Schicksal war unerbittlich, der Kletterer völlig chancenlos.
Der leblose Körper eines Menschen rutschte aus dem diffusen Nebel und traf Schober genau zwischen Kopf und rechter Schulter. Seine blutverschmierten Hände, obwohl absolut austrainiert, konnten der Masse mal Beschleunigung des herabfallenden Gewichtes nicht standhalten und wurden aus ihren Griffpunkten regelrecht herausgerissen. Mit einem kurzen, erschrockenen Schrei löste sich Otmar Schober aus der Felswand des Kemnitzensteins und stürzte, zusammen mit seinem blutigen Passagier, nach unten, wo er Sekundenbruchteile später im steinigen Gelände aufschlug.
Das Adrenalin in seinem Blutkreislauf betäubte den Schmerz, der wie ein glühendes Eisen in seinen Rücken fuhr, sodass er den eintretenden Schockzustand nahezu schmerzfrei erlebte. Allerdings war er unfähig, auch nur eine einzige Gliedmaße zu rühren. Ob das psychisch bedingt war oder ob er sich die Wirbelsäule gebrochen hatte, entzog sich seiner Urteilskraft, dazu war er zu geschockt und zu hilflos. Nicht allein wegen des brutalen Sturzes, sondern ebenso aufgrund des Umstands, dass das, was ihn mit in die Tiefe gerissen hatte, jetzt tot und leblos auf ihm lag.
Wie lange er so ausharrte, wusste er nicht, er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Schwer atmend versuchte er, mit der Situation irgendwie klarzukommen, als ein Schatten auf sein Gesicht fiel. Der sich langsam auflösende Nebel gewährte der Morgensonne Zutritt, und eine dunkle Silhouette erschien über dem regungslos am Boden liegenden Kletterer. Schobers Augen wurden groß, als er plötzlich eine Hand über seinem Gesicht schweben sah, der ein Schatten folgte. Jemand beugte sich über ihn.
Todesangst überkam den Kletterer. Was sollte das werden? Ein mühsam gekrächztes »Nicht!« entrang sich seinen blutenden Lippen, und das Letzte, was er in diesem Leben zu sehen bekam, war der dunkle Schatten, der sich seinem Gesicht näherte. Er blickte in ein ihm völlig fremdes, mit Blut verkrustetes Antlitz, bevor ihn das Bewusstsein und schließlich auch das Leben verließen.
***
In der Dienststelle der Bamberger Kriminalpolizei herrschte ausnahmsweise einmal so etwas wie Ruhe. Vor nicht allzu langer Zeit hatten die Kommissare in einer spektakulären Aktion einen Ring albanischer Tierhändler hochgenommen, was zu einigen Toten und einer verletzten Kollegin geführt hatte. Außerdem waren im Zuge dieses Polizeieinsatzes zwei kleine Kinder »übrig geblieben«, Zwillinge, um die sich die nun krankgeschriebene Andrea Onello und ihr Lebensretter und neuer Schwarm, der Würzburger Ermittler Thomas Callenberg, zu kümmern versuchten.
Callenberg war von seiner Abteilung ebenfalls erst einmal freigestellt worden, hatte ihm das Leben doch jüngst ziemlich übel mitgespielt. Bevor er sich wieder dienstfähig melden und nach Würzburg zu seiner Einheit zurückkehren konnte, sollte er sich gründlich regenerieren. Den beiden kam ihre unfreiwillige Auszeit ganz gut zupass, da sie sie nutzen konnten, um die Zukunft von Mira und Svea Dragusha, den beiden Zwillingen, zu klären, die bis auf Weiteres bei einer Pflegemutter in Daschendorf lebten.
Das war der Grund, warum in der Bamberger Dienststelle im Moment nur eine Rumpfmannschaft Dienst schob, dies aber ohne wirkliche Überzeugung. Ihr Chef hatte sie dazu verdonnert, sich in solch unbelebten Zeiten über Aktenberge, Karteileichen und sonstige unerledigte Angelegenheiten herzumachen. Eine Arbeit, die keine kriminalistischen Heldentaten, dafür aber Monotonie und grauen Polizeialltag versprach.
So saßen die Kriminalkommissare Franz Haderlein und César Huppendorfer vor Akten, die die Welt ihrer Meinung nach nicht brauchte, und stocherten lustlos in deren Sortierung beziehungsweise Ausmistung herum. Etwas entfernt, in einer anderen Ecke des Büros, war die Dienststellensekretärin Marina Hoffmann alias »Honeypenny« damit beschäftigt, einem kleinen, dicken Schweinchen eine Mahlzeit aus gekochten Kartoffeln in einen Fressnapf zu schnippeln. Das schweinische Neumitglied der Abteilung, Presssack genannt, war wahrscheinlich der einzige Warmblüter im Raum, dem seine aktuelle Tätigkeit wirklich Spaß machte. Eine weitere Person, welche sich gerade nicht mit intensiven Tätigkeiten der Büroarbeit beschäftigte, war der Kollege Bernd »Lagerfeld« Schmitt. Er stand mit hochrotem Kopf und verschränkten Armen vor seinem Chef und versuchte, das drohende Unheil abzuwenden.
»Wieso ich, Chef, wieso ausgerechnet ich? Jetzt bin ich schon so lange in diesem Laden hier dabei, und ausgerechnet ich soll eine Fortbildung machen? Noch dazu bei Siebenstädter in seinem gruseligen Institut? Das soll wohl ein Witz sein. Kann ich nicht Akten wälzen wie alle anderen hier? Und außerdem, wenn hier jemand eine Fortbildung braucht, dann doch wohl Presssack, und zwar dringend. Der kleine Satansbraten steht erst am Anfang seiner Karriere, der hat noch von nichts eine Ahnung, und seine Ausbildung könnte ich doch anstelle einer Fortbildung super übernehmen«, erklärte Lagerfeld hoffnungsfroh und blickte seinen Chef mit flehentlichem Gesichtsausdruck an. Bevor Fidibus antworten konnte, mischte sich allerdings Honeypenny von der anderen Büroseite her ein.
»Bloß nicht, Chef. Dieser kleine Kerl hier soll sich zu einer moralisch einwandfreien Persönlichkeit entwickeln. Wenn Bernd das in die Hand nimmt, endet das wahrscheinlich ähnlich promiskuitiv wie mit Presssacks Mutter. Er wird dem armen Ferkelchen lauter Blödsinn beibringen und ihm ganz bestimmt irgendwelche pornografischen Sachen zeigen. Und dann können wir aus unserer Dienststelle hier gleich einen landwirtschaftlichen Betrieb machen!«
Robert Suckfüll nahm diesen Einwurf seiner Sekretärin mit erkennbarem Entsetzen zur Kenntnis. Eine zum Schweinestall umgebaute Ausnüchterungszelle hatte ihm gereicht, mehr schweinischen Nachwuchs würde es in dieser Dienststelle nicht geben, dafür musste unbedingt gesorgt werden, da hatte Frau Hoffmann schon recht.
»Nein, nein, nein. Vergessen Sie das, mein lieber Schmitt, Frau Hoffmann wird das erst einmal übernehmen mit dieser internen Schweinausbildung, da traue ich Ihnen auch nicht über den Pfad, mein lieber junger Kommissar. Nichts da, der kurzen Rede langer Sinn, mein lieber Schmitt, Sie werden sich umgehend in die Erlanger Rechtsmedizin begeben und dort die Fortbildung bei Herrn Siebenstädter absolvieren. Frau Onello ist krankgeschrieben, Herr Huppendorfer war gerade mit Herrn Siebenstädter, wie soll ich sagen, ähem, in einem Kühlraum intim, das geht also nicht. Wen soll ich sonst schicken? Sie werden also dorthin gehen, sich gefälligst auf Ihren Hinterboden setzen und zuhören, was dieser fähige Mediziner Ihnen zu sagen hat, mein lieber Schmitt.«
Nach dieser Erörterung seiner für ihn maßgeblichen Beweggründe klopfte Fidibus dem finster dreinblickenden Lagerfeld aufmunternd auf die Schulter und meinte mit tröstlichem Augenaufschlag: »Bildung ist immer gut, mein lieber junger Kommissar. Bildung besitzt so eine gewisse, wie soll ich sagen …« Während er unentwegt des Kommissars Schulterpartie tätschelte, suchte er hingebungsvoll nach dem richtigen Begriff, um dann doch zielsicher den falschen hervorzukramen: »… eine gewisse Hervorragigkeit.«
Lagerfelds Gesichtsausdruck spiegelte die gesamte Breite seiner gerade empfundenen Emotionen wider. Von Wut und Verzweiflung über Selbstmitleid und Frustration bis hin zu einer gewissen Todessehnsucht war alles dabei. Er wusste schließlich zu genau, was Siebenstädter vorhatte. Von wegen Fortbildung. Der arrogante Sack hatte endlich kapiert, dass sich seine einseitig erklärte Verlobung mit Andrea Onello erledigt hatte. Zudem hatten ihm ein paar Ganoven ein paar auf die Nuss gegeben und ihn auf Tuchfühlung mit Huppendorfer in den Kühlraum der Rechtsmedizin gesperrt. Für das Ego des Professors eine ziemlich ausgedehnte Talfahrt ins Reich der Vernichtung. Und derlei Talfahrten verkraftete dieser Mann nicht, das war hinlänglich bekannt.
Da Siebenstädter diese ganzen unerfreulichen Begebenheiten natürlich zu einhundert Prozent auf die Bamberger Kripo zurückführte, wollte der Mann sich jetzt schlicht und einfach an einem von ihnen rächen. Nur so ließ sich seine Offerte, einen der Bamberger Kommissare in seinem Fachgebiet zu unterweisen, erklären. Er brauchte jemanden, den er zur eigenen Ego-Heilung einfach mal verbal rundlaufen lassen konnte. Deswegen wusste auch niemand hier, wozu diese angebliche Fortbildung überhaupt gut sein sollte. Keiner konnte ihm sagen, worum es ging oder was das bringen sollte. Das war alles nur ein billiger Vorwand, um den armen Auserwählten, also in diesem Fall ihn, in die Pfanne hauen zu können. Lagerfeld graute schon beim Gedanken daran, wie ihn der Professor mit seinem haifischartigen Gebiss begrüßte und die Zähne bleckte, weil er sich wie ein Henker auf seinen hilflosen, gefesselten Delinquenten freute. Früher hätte Bernd Schmitt eine solche Herausforderung vielleicht sogar gemeistert, in jüngeren Jahren, als er sich noch in einer stabilen privaten Situation befunden hatte. Aber jetzt kam in seinem Leben gerade so einiges zusammen: Trennung von der Familie, Umzug und nun auch noch Siebenstädter. Nein danke!
Diese äußerst unbefriedigende Gesamtsituation führte zu einem Überschwang von zerstörerisch auf Lagerfeld einwirkenden Emotionen. Sein Überlebensinstinkt schaltete auf Notbetrieb, was er in letzter Zeit schon des Öfteren hatte tun müssen, und programmierte Lagerfeld auf Flucht. Bloß weg hier, raus aus jeglicher stressbeladenen Situation, und zwar schnell. Hilflos versuchte er, die immer noch tätschelnde Hand seines Chefs abzuwehren, und versuchte es dann mit einem Notwitz. Das war in Bernd Schmitts Verteidigungsarsenal eine furchtbare Waffe, eine bombastische Nebelkerze, die er aber immer nur dann einsetzte, wenn wirklich nichts anderes mehr weiterhalf.
»Chef, was ist gelb und schwimmt auf dem Ententeich?«, fragte er Fidibus mit strengem Blick.
Der war so dermaßen perplex, dass er das Tätscheln einstellte und sekundenlang keinen Ton hervorbrachte. Dann versuchte er sich an einer Antwort, von der er allerdings jetzt schon wusste, dass es ziemlich sicher nicht die richtige sein konnte.
»Eine … Ente?«, entgegnete er verdattert und bedachte seinen Kommissar mit einem wissbegierigen Blick.
Der hob bereits zu einer Antwort an, als sein Handy klingelte, und griff stattdessen zum Mobiltelefon. »Was, Tumulte? Gefahr im Verzug? Verdacht auf Leichen, vermutlich tot, ermordet? Also quasi ermordete Leichen! Gott sei Dank. Ich muss sofort dahin!«, rief Lagerfeld euphorisch und steckte das Handy mit leuchtenden Augen zurück in seine Tasche.
Mit seiner Jacke in der Hand stürmte er zur Tür, blieb dann aber unversehens stehen. Sein Blick fiel auf die Jutetasche, mit der er die gekochten Kartoffeln für Presssack hierhergeschleppt hatte. Kurz entschlossen schnappte er sich den Beutel und eilte damit zu Honeypennys Schreibtisch. Noch bevor die Dienststellensekretärin irgendetwas sagen konnte, bückte er sich und hob mit einer Hand das kleine, dicke Ferkel vom Boden.
»He, halt, was schwimmt denn jetzt auf diesem Entensee?«, verlangte Robert Suckfüll, der ob der sich überstürzenden Ereignisse nicht mehr ganz folgen konnte, zu wissen.
»Eine Schwanane, Chef, eine Schwanane«, meinte Lagerfeld mit einem breiten Grinsen. »Auf geht’s, Kleiner, jetzt wird fortgebildet«, erklärte er sodann etwas übertrieben und beförderte den heftig strampelnden Presssack unter den entsetzten Blicken der Dienststellensekretärin in die Tiefen der Jutetasche, gab noch zwei unzerschnippelte Kochkartoffeln als Wegzehrung für seinen Auszubildenden dazu und eilte, so schnell es ging, aus dem Büro. Noch ehe irgendwer weswegen auch immer protestieren konnte, waren der Kommissar und seine schweinische Hilfskraft verschwunden.
»Was war das denn?«, fragte Franz Haderlein, der dienstälteste Kommissar im Bamberger Kommissariat, seine verbliebenen Kollegen.
César Huppendorfer zuckte nur mit den Schultern, während Marina Hoffmann mit puterrotem Kopf und offenem Mund sprachlos dasaß. In der rechten Hand hielt sie eine zur Hälfte aufgeschnittene Kartoffel, in der linken ein kleines Messer. Der Einzige, der dazu Worte fand, war ihrer aller Dienststellenleiter Fidibus, der sich auch gleich einmal heftig erregte.
»Also, das schlägt doch dem Krug den Boden aus. Das ist eine derartige Unverfrorenheit von diesem Schmitt, das werde ich dem Kerl diesmal nicht durchgehen lassen! Erst mich mit solch gehirnschädlichen Fragestellungen verwirren und dann unerlaubt den Arbeitsauftrag vertauschwechseln. Das grenzt an Befehlsverweigerung, an Fahnenflucht!«, fauchte er entrüstet und brach in seiner Aufregung die nicht angezündete Zigarre entzwei, die er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte. »Frau Hoffmann, sagen Sie diesem Schmitt, wenn er wieder hier auftaucht, dass ich ihn umgehend zu sprechen wünsche. Und dann werde ich eine … einen … einen Stempel salutieren, damit auch wirklich alle Mitarbeiter dieser Abteilung vor der Nachahmung eines solch fahnenflüchtigen Verhaltens gewarnt sein mögen.« Mit wildem Blick schoss Suckfüll warnende Blitze durch den Raum, um jedwede Gegenrede schon im Vorfeld zu unterbinden.
Aber ohnehin wagte es niemand hier, auch nur im Geringsten zu widersprechen. Weniger aus Angst vor dienstrechtlichen Konsequenzen denn aus Furcht vor weiteren ungelenken Ausflügen ihres Chefs in die Untiefen der deutschen Sprache. So etwas mitanhören zu müssen tat manchmal mehr weh als ein albernes Disziplinarverfahren.
»Ja, was mache ich denn jetzt wegen des Fortbildungstermins in der Erlanger Rechtsmedizin? Ich habe doch dem Professor das Erscheinen eines meiner Untergebenen angekündigt. Diesen Termin kann ich doch jetzt nicht so einfach sausen lassen, Herrgott.«
Hektisch schaute er auf seine Uhr, dann mit wachsender Verzweiflung auf seine sich angelegentlich anderen Dingen widmenden Mitarbeiter, bis er sich schlussendlich zu einer epochalen Entscheidung durchrang.
»Also gut, bitte, alea iacta est, die Würfel sind, äh, also, die liegen jetzt da … rum. Dann mache ich diese Fortbildung eben selbst, meinetwegen. Frau Hoffmann, wenn Sie so freundlich wären, das Navigationssystem meines Fahrzeuges auf die Erlanger Rechtsmedizin zu programmieren, ich muss mich noch umkleiden.«
Sprach’s, wandte sich um und verschwand, ohne zu zögern, in seinem gläsernen Büro. Er hatte die gläserne Bürotür gerade hinter sich geschlossen, als das Telefon auf Haderleins Schreibtisch zu klingeln begann. Am anderen Ende der Leitung war ein Beamter der Bereitschaftspolizei, der ihm mitteilte, dass man an der Brückenbaustelle bei Breitengüßbach eine Leiche gefunden habe. Wahrscheinlich ein Unfall, jedoch mit ein paar seltsamen Ungereimtheiten. Und es solle doch bitte jemand herkommen, um den im wahrsten Sinne des Wortes mysteriösen Fall zu übernehmen.
»Marina, ich muss auch weg«, informierte Haderlein die Dienststellensekretärin. »Anscheinend ist die besinnliche Phase der Verbrechensbekämpfung beendet.« Er rollte bedient mit den Augen. »Da ist ewig lange nichts los, und dann kommt alles auf einmal. Ist doch wirklich zu blöd.«
Aber auch Franz Haderlein war im Grunde froh, die stupide Aktenstöberei los zu sein, nur wollte er das in aller Öffentlichkeit nicht so deutlich sagen. Er sandte César Huppendorfer einen letzten solidarischen Blick und war wenig später ähnlich schnell verschwunden wie sein jüngerer Kollege Schmitt.
***
Die Geschichte von Amelie und Florian begann an einem warmen, sonnigen Junitag. Schon am Morgen hatte Florian Kauper das Gefühl, dass etwas Seltsames, Verheißungsvolles in der Luft lag, so als gäbe es heute noch etwas Besonderes zu erleben. Vielleicht hatte es aber auch mit seiner misslichen privaten Situation zu tun, steckte er doch gerade mitten in den Wirren einer On-off-Beziehungskiste, mit der er nicht so richtig umzugehen wusste. Es gab also durchaus Argumente, die seinen rastlosen Zustand hätten erklären können, er zog es allerdings vor, sie nicht zu bemühen. So tigerte er an diesem Vormittag schicksalsergeben durchs Haus, machte dies und das, Hauptsache, er schaffte es irgendwie, die Zeit totzuschlagen.
Seit 1990 war er stolzer Besitzer eines alten Fachwerkhauses in Dörrnwasserlos. Arbeiten, die sowieso schon lange gemacht werden sollten, gab es also genug, die Stunden konnte er mit handwerklicher Tätigkeit langsam und qualvoll ermorden. Das rastlose Gefühl aber, die Aufbruchstimmung in ihm, blieb hartnäckig am Leben.
Die ganze unerquickliche Situation dauerte an, bis schließlich am Nachmittag der Postbote klingelte. Er übergab ihm mit verschwitztem Gesicht und kaum verborgener Eile ein kleines, aber gewichtiges Päckchen, auf dessen Zustellung Florian Kauper schon seit geraumer Zeit wartete. Er hatte nämlich auf eBay ein schönes altes, vor allem aber rares Objektiv der Firma Pentax ersteigert, das nun wohl endlich bei ihm gelandet war.
Aha, dachte er sogleich hocherfreut, deswegen also die Unruhe den ganzen Tag über. Da hatte sein Innerstes doch tatsächlich geahnt, dass dieser Edelstein der Fotografie im Anmarsch gewesen war.
Vergessen waren sämtliche noch zu erledigenden Arbeiten. Jetzt galt es zuerst einmal, den Inhalt dieser Postsendung zu prüfen und gegebenenfalls zu bewundern.
Gesagt, getan. Mit seinem Päckchen eilte er zurück ins Haus, um dann schleunigst den Inhalt der Postalie zu entblättern. Die Vorfreude war riesig, das Ergebnis sogar noch beeindruckender als erhofft. Ein 135er Objektiv der Pentax-F-Serie aus den Neunzigern, ein Meisterstück der Ingenieurskunst aus Japan. Damals wurden die ersten Autofokusobjektive noch komplett aus Metall gefertigt. Er war hin und weg.
Die nächsten zwei Stunden verbrachte Florian Kauper damit, das Objektiv an seine Kamera zu schrauben und dann so ziemlich alles auf seinem Grundstück zu fotografieren, was nicht schnell genug den Baum hinaufkam. Irgendwann war die Auswahl an Motiven allerdings erschöpft, auch die Bäume wurden rar. Er beschloss, auf dem Computer zu überprüfen, ob die eingefangenen Bilder seinen hohen Erwartungen denn auch standhalten konnten.
Sie konnten. Er betrachtete eines nach dem anderen und war hellauf begeistert. Was für Farben, was für ein Bokeh. Sein Fotografenherz ging auf bei all der Pracht, und er entschied spontan, zur Feier des Tages und des erfolgreichen Einkaufs draußen auf seiner Holzterrasse einen Whisky zu heben.
Das tat er dann auch genüsslich, jedoch mit fataler Folge: Schon bald verflüchtigten sich die schönen Fotografien in seinem Kopf, und stattdessen kam ihm sein unglückliches Beziehungsverhältnis wieder in den Sinn. Eine fast dreijährige Wochenendbeziehung, die er bereits zweimal beendet hatte und die zu reanimieren er doch gerade wieder im Begriff war. Und das, obwohl er oft kreuzunglücklich war mit dieser Frau. Trotzdem hielt er an ihr fest, warum auch immer. Seine besten Freunde hatten ihn wiederholt vor diesem Unterfangen gewarnt, doch er musste ja gegen alle guten Ratschläge genau die andere Richtung einschlagen.
So war er eben. Sternzeichen Steinbock, mit dem Kopf durch die Wand. Aufgeben ist nicht, das darf es nicht geben. Beruflich hatte ihn dieser Starrsinn sehr oft weitergebracht, privat war es ein absolut desaströser Charakterzug, wie er sich leidvoll eingestehen musste.
So saß er also auf seiner Terrasse, beschwingt vom halben Probierglas Auchentoshan aus den schottischen Lowlands, und zermarterte sich das Hirn über die Sinnhaftigkeit seiner derzeitigen Beziehungskiste. Auch die morgendliche Rastlosigkeit war urplötzlich wieder da, und zwar stärker als zuvor. Das gab schon wenige Sekunden später den Ausschlag, denn weiter hier zu Hause herumhocken und grübeln wollte er nun wirklich nicht. Dort draußen lag eine richtig geile Stimmung in der Luft, und er hatte ein neues, lang ersehntes Objektiv für seine Kamera. Es war an der Zeit, in die Welt hinauszugehen und zu fotografieren, und zwar auf der Stelle.
Also nahm er, beseelt von seiner erlösenden Eingebung, die Kamera mit dem neuen 135er, schwang sich auf seinen Roller und fuhr einfach los. Es war einer dieser Momente im Leben, in denen man ohne Ziel und Plan handelt, nur von einem Bauchgefühl getrieben. Florians erster Impuls war es, hinauf auf den Staffelberg zu fahren, aber dann sah er den Veitsberg bei Ebensfeld in wunderschönem, einmaligem Licht in der Sonne liegen, weshalb er spontan die Route änderte und fröhlich und beschwingt zum Veitsberg hinauffuhr, voll spürbarer Vorfreude auf das besondere Licht und den vertrauten Berg.
***
Lagerfeld war ehrlich erleichtert, nicht diese angedachte Fortbildung in der Erlanger Rechtsmedizin absolvieren zu müssen. Sein Abgang war zwar mehr als fadenscheinig gewesen und würde auch ganz sicher noch Konsequenzen nach sich ziehen, das war ihm aber gerade egal. Er und Siebenstädter bei einer Fortbildung in der Rechtsmedizin, das konnte nur schiefgehen. Vielleicht käme es nicht sofort zur handgreiflichen Auseinandersetzung, wie Andrea sie ihrerzeit initiiert hatte, aber auf irgendeine brutale Art und Weise würde das ganz sicher enden, in einem Desaster allenthalben, das hatte er förmlich im Urin. Er schaute nach hinten auf die Rückbank, wo sein Nachwuchsermittler den kleinen schwarz-rosa gefleckten Kopf aus der Jutetasche streckte. Presssacks vorwurfsvoller Blick sprach Bände. Noch niemals in seinem kurzen Leben hatte man ihn, Prinz Presssack, in einen Stoffbeutel gesteckt, um ihn dann wer weiß wohin zu transportieren. Einzig die zwei großen gekochten Kartoffeln in der Jutetasche hielten ihn davon ab, als Zeichen seiner Verletztheit, Unzufriedenheit und abgrundtiefen Verachtung der Allgemeinsituation seinen Darminhalt in Gaußscher Normalverteilung auf das Leder der Rückbank zu entleeren.
Lagerfeld nahm den bissigen Gesichtsausdruck zwar zur Kenntnis, betrachtete sein ungewohnt rüdes Vorgehen aber als Teil des ab sofort einsetzenden Trainingsprogramms. Bisher waren Presssacks Einsätze in der Polizeiarbeit eher spontan gewesen und als regelrecht vogelwild einzustufen, von planvoller Ausbildung konnte man jedenfalls nicht reden. Das würde sich mit dem heutigen Tag definitiv ändern. Das kleine, dickliche Miniferkel war im harten Polizeialltag angekommen und würde nun, wie seinerzeit seine Mutter, lernen müssen, wie es in der Verbrecherwelt da draußen zuging. Dazu waren zahlreiche Lektionen notwendig, die Lagerfelds neuer Lehrling aber sicher mit Bravour meistern würde.
Inzwischen waren sie an ihrem Ziel angelangt, der Firma »AEDES«. Ein ziemlich erfolgreiches Start-up, das sich in einem kleinen Laborkomplex gegenüber dem Bamberger Bahnhof eingemietet hatte. Früher waren die Räumlichkeiten im ersten Stock für so eine Tanzveranstaltung für Singles mit übersteigertem Jagdtrieb reserviert gewesen. Wer sich in dieses Etablissement, »Agostea« genannt, begab, war als Lover entweder gerade wieder frisch auf der Weide oder beziehungstechnisch übrig geblieben. Im »Agostea« hatte Mann oder Frau finden können, was er oder sie suchte, und wenn nicht, ließ man sich einfach finden. Man musste nur lang genug auf der Tanzfläche herumhüpfen, dann kam schon jemand, der einen aufsammelte. Bis Corona um sich griff und das Aus für Tanzveranstaltungen jeglicher Art brachte. Der altgediente Kupplungsschuppen für notorische Dauersingles hatte ausgetanzt, und eine weitere bekannte Bamberger Institution musste ihre Pforten schließen.
Der Leerstand währte jedoch nicht allzu lange, das preisgekrönte Start-up der fränkischen Gründerszene mietete sich ein. So ganz genau wusste niemand, wonach die in ihrem Labor eigentlich forschten, nur dass es mit absolutem Hightech in der Molekularbiologie zu tun hatte. Aber irgendetwas schien bei der Firma AEDES im Gange zu sein, denn eine Gruppe demonstrierender Menschen hatte sich auf dem kleinen Vorplatz versammelt und skandierte lautstark ihre Parolen, sodass Lagerfeld seinen Honda lieber etwas weiter entfernt in Richtung Stadtmitte parkte. Er strich dem beleidigten Presssack durchaus mitfühlend über den Kopf, dann schloss er seinen Wagen ab und ging hinüber zu dem ehemaligen Tanzschuppen.
Als er sich so überhastet bei seinem Chef abmeldete, hatte Lagerfeld nicht die ganze Wahrheit gesagt, nein, eigentlich sogar knallhart gelogen. Niemand hatte telefonisch eine Leiche gemeldet, sondern nur jemanden, der drohte, sich oder womöglich andere umzubringen. Aber egal, der Anruf war für Lagerfeld Grund genug gewesen, sich dienstlich auf den Weg zu machen, schließlich war ja gewissermaßen Gefahr im Verzug.
Er wühlte sich durch die aufgebrachten Demonstranten, die wild durcheinanderriefen und selbst gemalte Transparente und Schilder schwenkten. Es schien wohl irgendwie ums Impfen zu gehen, zumindest ließen die Parolen darauf schließen.
Glaubt nicht der Impflüge!
Eine tödliche Krankheit muss man durchmachen oder …
Wacht endlich auf!
Keine Zwangsimpfung für niemanden!
Gib Gates keine Chance!
Gunnar for Kanzler!
Lagerfeld schloss spontan die Augen, hatte er sich doch bereits lange genug mit solchen Theorien herumschlagen müssen. Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch privat. Der und die eine oder andere aus seinem Bekanntenkreis hatten sich fatalerweise mit solchen oder ähnlichen Verschwörungsideen aus der Realität verabschiedet. Einen Aluhut, der seinen Träger ja bekanntlich vor der Strahlung schützen soll, mit der dunkle Mächte angeblich unsere Gehirne manipulieren und fernsteuern, hatte Gott sei Dank noch keiner von ihnen aufgesetzt, aber einige ehemals als recht vernünftig eingestufte Persönlichkeiten seines persönlichen Umfeldes kamen jetzt doch ein bisschen durchgedreht daher. Eigentlich hatte er geglaubt, der Nutzen einer Impfung sei spätestens seit dem Ende der Covid-19-Pandemie hinlänglich belegt, aber weit gefehlt. Dass es noch eindeutigerer Beweise bedurfte, machte der Zwergenaufstand hier vor dem AEDES-Labor deutlich.
Bernd Schmitt verstand noch nicht ganz, wieso an diesem Ort Gefahr für Leib und Leben eines Einzelnen bestehen sollte. Diese Demo war zwar vollgestopft mit Durchgeknallten, allerdings konnte er nicht erkennen, dass sich irgendwer besonders brutal oder gar mordlüstern betätigte. Bei dem Anruf war von potenziellem Selbstmord und Ähnlichem die Rede gewesen. Leichen gab’s natürlich keine, die hatte er zum Zwecke seines Abganges aus der Dienststelle hinzugedichtet. Trotzdem fragte er sich ratlos, was denn hier so gefährlich war, die demonstrierten doch bloß.
Der passenden Antwort wurde er gewahr, als er den Kopf hob, um die Fassade des belagerten Gebäudes zu betrachten. Ein Stockwerk höher war nämlich ein Mann zu sehen, der mit einem Megafon in der Hand auf einem offensichtlich gerade erst neu angebauten Balkon stand. Wie er dort hinaufgekommen war, blieb Lagerfeld erst einmal ein Rätsel – ziemlich sicher nicht durch die mit Sicherheitspersonal besetzte Eingangstür, und nirgendwo war eine Leiter zu sehen. Was man aber sehr wohl erkennen konnte, waren der selbst gebastelte Aluhut auf dem Kopf des Mannes und, etwas tiefer, die Schlinge des roten Seiles, welches er sich selbst um den Hals gelegt hatte. Das andere Ende hatte er um den Griff der hinter ihm befindlichen Balkontür gewickelt, wie es schien. In der Tür steckte irgendeine Art Stange, wodurch die innen stehenden Mitarbeiter der Firma AEDES nicht zu ihm auf den Balkon treten konnten. Da konnten sie an der verglasten Balkontür rütteln, so viel sie wollten.
Aha, ein Selbstmörder, war Lagerfelds erster Gedanke, als sich des Mannes vor Erregung gerötetes Gesicht farblich dem um den Hals gelegten Strick anzugleichen begann. Doch dann hob der Mann mit einer dramatischen Geste sein Megafon vor den Mund und begann, die Menge auf dem Platz lautstark mit seinen Botschaften zu beschallen.
»Wir, die Aufgeklärten, wissen, dass das sogenannte Coronavirus in einem geheimen chinesischen Labor entwickelt und bei uns durch Sendemasten übertragen wurde. Die Menschen in Wuhan und auch hier bei uns sind demzufolge nicht am Coronavirus, sondern an der viel gefährlicheren 5G-Strahlung gestorben. Jeder, der sich informiert hat, der endlich aufgewacht ist, weiß doch, all das wurde inszeniert, um uns endlich alle zwangsimpfen zu können. Und wenn der Letzte von uns eingeknickt ist, wenn die gesamte Weltbevölkerung gegen ein eigentlich harmloses Grippevirus zwangsgeimpft ist, dann wird die 5G-Strahlung der Sendemasten den Impfstoff aktivieren, die geheimen gespritzten Gene entfalten ihre unheilvolle Wirkung, und der Mensch ist fortan ein willenloser, ferngesteuerter Sklave unserer Regierung plus des Satans Bill Gates und seiner Schergen. Wollt ihr das?«, rief der Mann, und unter ihm brach die versammelte Menge in ein wildes, zustimmendes, auf jeden Fall jedoch ohrenbetäubendes Protestgeschrei aus.
Lagerfeld für seinen Teil hatte sich zum Eingang des Gebäudes durchgekämpft und bekam von der flammenden Rede dort draußen auf dem Vorplatz nicht wirklich viel mit. Nachdem er an der gesicherten Pforte seinen Dienstausweis vorgezeigt hatte und eingelassen worden war, stürmte er nach oben, um zu dem Balkon und dem darauf herumturnenden Aluhutträger zu gelangen. Die Sicht war durch zahlreiche Firmenbedienstete versperrt, die sich im Raum versammelt hatten und durch die dicke Glasscheibe hindurch verunsichert das Geschehen beobachteten. Der Kommissar wühlte sich durch die Schaulustigen, bis er schwer atmend vor der Balkontür stand, auf deren anderer Seite der heftig fuchtelnde Megafonist zu seiner Anhängerschar sprach. An der Tür prangte ein langer, breiter Aufkleber mit der Aufschrift: »Achtung, Baustelle. Betreten verboten. Lebensgefahr.« Direkt daneben lag ein großer Bohrhammer samt allerlei anderen Gerätschaften, die mutmaßlich von Handwerkern benutzt wurden, wenn sie neue Balkone an alten Baubestand bastelten. Zu hören gab es fast nichts, die Verglasung, die eine weite Sicht bis hinüber zum Bahnhofsvorplatz ermöglichte, war ohrenscheinlich qualitativ hochwertig und schalldämmend, sodass von dem Tumult vor dem Haus nicht viel zu vernehmen war.
»Wer ist denn dieser Spinner eigentlich?«, fragte Lagerfeld die Umstehenden, was zu einem betretenen Schweigen führte. Erst als er seinen Ausweis demonstrativ in die Höhe hielt, erkannte das umstehende Mitarbeitervolk sein berechtigtes Interesse, und ein etwas älterer Herr mit moderner Nickelbrille meldete sich zu Wort.
»Das ist Gunnar Schildmann, dieser Irre, der, seit wir hier eingezogen sind, behauptet, wir würden mit unserer Forschung den Untergang der menschlichen Rasse einläuten. Bis jetzt gab es ja nur Drohbriefe und ein paar kleine Demonstrationen. Aber heute hat er sich als Bauarbeiter verkleidet hier reingeschlichen und die Tür zum Balkon von draußen mit einem Besenstiel verrammelt. Dabei ist das hochgefährlich, denn das Geländer ist nur provisorisch befestigt, das hält noch nicht richtig. Der riesige Aufkleber hängt ja nicht grundlos an der Tür, aber das schien diesen Schildmann nicht zu interessieren. Immerhin trägt er ein schönes Seil um den Hals«, ergänzte der Mann mit sarkastischem Ton, »wenn wir Glück haben, benutzt er es auch«, und nicht wenige der Umstehenden nickten.
Lagerfeld hatte sich so etwas schon gedacht und steckte kurz entschlossen seinen Dienstausweis wieder weg. Er wandte sich zwecks näherer Prüfung der Balkontür zu, rüttelte am Griff, aber der durchgesteckte Besenstiel verrichtete die ihm zugedachte Aufgabe einwandfrei und ließ kein Öffnen der Tür zu. Lediglich ein leises Klappern war zu hören, als der Besen wieder und wieder gegen das Glas polterte.
Gunnar Schildmann bekam davon entweder nichts mit, oder es interessierte ihn nicht, was wohl die wahrscheinlichere Variante war. Unbeirrt von dem, was sich hinter ihm abspielte, verkündete er mit seinem Megafon in der Hand und der Schlinge um seinen Hals weiter voller Inbrunst seine kruden Theorien.
Der Kommissar beendete seine kurze, knappe Bestandsaufnahme der turbulenten Gesamtsituation mit einem eindeutigen Fazit: Gefahr im Verzug. Der Trottel dort draußen befand sich unerlaubterweise auf einem ungesicherten Balkon, also musste man diesen Kerl schleunigst vor sich selbst retten. Unter dem kollektiven Aufstöhnen der AEDES-Belegschaft zog er seine Dienstwaffe, entsicherte sie, zielte und drückte entschlossen zweimal ab. Die Kugeln durchschlugen das nagelneue Glas der Balkontür, die nun ein zersplittertes Spinnwebenmuster zierte, entzweiten das Holz des eingehängten Besens und schlugen in das Gemäuer des Gebäudeseitenflügels ein, wo sie ihre vorläufige Ruhestätte fanden. Doch selbst jetzt, als Lagerfeld mit entschlossenem Blick und gezückter Waffe zu ihm auf den Balkon trat, führte das nicht dazu, dass der selbst ernannte Prediger seine Hasstiraden einstellte, im Gegenteil.
Als Lagerfeld erneut seinen Ausweis hob und dem Aluhutträger lautstark zu verstehen gab, dass er, Gunnar Schildmann, sich auf dem Balkon in Lebensgefahr befand, erreichte dessen Teint endgültig den hochroten Spektralbereich, und seine Stimme klang noch verzerrter, als sie ohnehin schon war.
»Hier seht ihr es, meine Freunde, es ist wieder so weit. Die Staatsmacht will mich an meinem demokratischen Recht auf freie Meinungsäußerung hindern. Aber das wird ihr nicht gelingen, denn wir werden gemeinsam gegen diese Diktatur vorgehen, in der wir hier leben müssen. Wir werden uns endlich wehren, jetzt, da wir erwacht sind!«
Unten auf dem Platz brandete wilder Jubel auf. Schilder wurden geschwenkt, Parolen gerufen oder sonst irgendwie Krach gemacht.
Lagerfeld für seinen Teil bemerkte, dass sich der liebe Gunnar immer mehr gegen das nur provisorisch gesicherte Edelstahlgeländer lehnte, das einzig von vier Backsteinen an seinem Platz gehalten wurde, die man dem Geländer unten auf die Füße gelegt hatte. Auch davon hatte Gunnar Schildmann aber offensichtlich noch nichts mitbekommen, denn er steigerte sich immer mehr in seine Rede hinein und drückte sich dabei an das Geländer.
Lagerfeld steckte als Erstes seine Dienstwaffe wieder weg, dann hob er beschwichtigend beide Hände. »Hören Sie. Ich bin nur hier, um Sie von diesem Balkon zu lotsen. Das ist ein nicht gesicherter Baustellenbereich mit einem unbefestigten Geländer. Also tun Sie sich und mir den Gefallen und verlassen Sie jetzt umgehend diesen Balkon, okay?«
Um seine Ungefährlichkeit zu demonstrieren und dem tobenden Rumpelstilzchen keinen Vorwand für unbedachte Handlungen zu liefern, trat Lagerfeld einen Schritt zurück, sodass er nun fast wieder an der durchschossenen Glastür stand, und beäugte möglichst unauffällig den Knoten des roten Seils. Ihm schwante, dass er eine Weile brauchen würde, um ihn von der Balkontür zu lösen. Es wäre wirklich besser für alle Beteiligten, wenn dieser Irre einfach ein Stück vom Geländer wegtreten würde.
Aber Gunnar Schildmann dachte gar nicht daran, der Obrigkeit Folge zu leisten. Anweisungen der polizeilichen Art waren für ihn nur ein weiterer Beweis für die willkürliche Gängelei mündiger Bürger durch ein diktatorisches Regime.
»So, ich soll also zurücktreten? So, ich darf hier also nicht stehen? Jetzt hör mal zu, du willenloser Handlanger des diktatorischen Staatsapparats, ich werde dir zeigen, was ich alles kann und darf. Und auf deine scheißgefakten Bauvorschriften ist sowieso geschissen, vergiss es. Wir sind nämlich erwacht, wir lassen uns nicht mehr von euch da oben verarschen!«, wetterte Schildmann mit erregter Geste seiner erhobenen Faust und lehnte sich dann demonstrativ und mit seinem ganzen Gewicht gegen das nagelneue Edelstahlkonstrukt.
Ein kurzes Poltern war zu hören, als das Geländer nach außen kippte und die zur provisorischen Beschwerung gedachten Backsteine vom Geländerfuß rollten. Mit einem Ausdruck absoluten Erstaunens im Gesicht, die Hände wie ein Turmspringer weit nach hinten gestreckt, fiel Gunnar Schildmann der gefakten Absperrung der Staatsgewalt hinterher. Ein erschrockenes Raunen ging durch die Menge. Das schwere Geländer krachte auf ein Protestbanner und begrub das grell bemalte Transparent unter sich, während Schildmanns Fall jäh von dem kräftigen roten Seil abgebremst wurde, das sich der Verschwörungsideologe zu Beginn seiner Aktion um den Hals gebunden hatte.
Lagerfeld sah den Mann einfach nur nach unten aus seinem Gesichtsfeld entschwinden, dann straffte sich urplötzlich das Seil, und unterhalb des nun von seinem Geländer befreiten Balkons war ein leises Knacken zu hören.
***
Florian Kauper stellte seinen Roller am Wanderparkplatz oberhalb des kleinen Dörfchens Dittersbrunn ab, hängte sich die Umhängetasche mit der Kameraausrüstung über die Schulter und ging den flach ansteigenden Weg zum Veitsberg hinauf, bis er nach rund einem Kilometer schließlich an der Kapelle stand, die von einem Kreis uralter Lindenbäume umgeben war. Vor Tausenden von Jahren hatten wohl die Druiden in diesem mutmaßlichen keltischen Heiligtum ihre geheimnisvollen Rituale vollzogen. Und so, wie er sich gern auf den Staffelberg begab, um wichtige Entscheidungen zu treffen, so kam er bisweilen an diesen einzigartigen Ort, um Ruhe in seiner momentanen Lebenssituation zu finden.
Aus genau diesem Grund saß er auch heute wieder hier, die Kamera in der Hand. Wenn Florian Kauper unruhig war, verstört, traurig oder einfach durch den Wind, dann setzte er sich auf eine der Bänke unter den alten Linden und schaute hinunter ins Tal. Oder hinüber zu den Eierbergen, den Gleichbergen, dem Staffelberg oder, wenn die Sicht es zuließ, bis zum weit entfernten Kreuzberg in der Rhön. Das half ihm, den Fokus für sein aktuelles Leben wiederzufinden.
Nach und nach kamen noch andere Besucher auf den Veitsberg, ebenfalls angezogen von dem wunderschönen, magischen Licht. Es war inzwischen später Nachmittag geworden, und die Sonne hatte begonnen, sich dem Horizont zuzuneigen. Das Spektrum des Lichtes verschob sich allmählich in den orangefarbenen Bereich, die Stimmung wurde immer intensiver. Florian saß da und betrachtete das hochgewachsene Gras vorne am Hang, in dem zwei etwa zehnjährige Jungs voller Inbrunst damit beschäftigt waren, versonnen und in sich versunken, ebendiese Halme auszuzupfen und zu sammeln. Am Hang und auch an der Kapelle saßen oder lagen vereinzelt Menschen im Gras, um die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen. Über allem lag eine Behaglichkeit, wie man sie vielleicht in den Savannen ferner Kontinente vermutete, nur dass hier keine Löwen zu sehen waren, sondern einfach nur Menschen unterschiedlichster Machart, die vereint diesem einmaligen Tag begegneten.
Florian fing an zu fotografieren. Er fotografierte das Gras, die Knaben, die sich darin tummelten, die Wolken, die umliegenden Berge, die Bäume, die Kapelle und alles mögliche andere, was ihm vor die Linse kam. Das immer rötlicher werdende Licht fiel nun bereits fast waagrecht ins Land, sodass man die Wolken tanzender Fliegen im und über dem hochgewachsenen Gras mit bloßem Auge erkennen konnte. Florian hatte eine solche Atmosphäre bis zum heutigen Tag noch nirgendwo erlebt. Weder hier auf dem Veitsberg noch auf dem Staffelberg oder anderswo. Es war einfach magisch.
So knipste er und schoss begeistert Bild für Bild, bis ihm das Display der Kamera anzeigte, dass nur noch wenig Speicherkapazität vorhanden war. Er war relativ überstürzt aufgebrochen und hatte in der Eile vergessen, eine zweite Speicherkarte einzustecken. Für diese Nachlässigkeit hätte er sich jetzt in den Arsch beißen können, aber bitte, das war eben Fotografenschicksal. Wirklich tragisch, denn der bevorstehende Sonnenuntergang versprach sensationell zu werden. Am Horizont hatte sich während der letzten Minuten ein glühendes Rot breitgemacht, wie er es noch nie gesehen hatte. Und je tiefer die Sonne sank, umso mehr schien sich dieses Glühen zu verstärken. Also hörte Florian schweren Herzens mit dem Fotografieren auf, um sich die restlichen Bilder für den Höhepunkt dieses Tages aufzusparen, wenn die Sonne endgültig hinter den Gleichbergen am Horizont versinken würde.
Mit schussbereiter Kamera lehnte er sich an eine der alten Linden und gab sich dem einmaligen Anblick hin. Allmählich entspannte er sich, wurde ruhig. Eine fast heilige Gelassenheit legte sich über den gesamten Berg, seine Besucher und über Florians aufgewühltes Gemüt. Und dann, just in dieser unbeschreiblichen Gelassenheit, kam der Moment, der sein Leben verändern, es komplett umkrempeln sollte.
Florian Kauper sah sie zum allerersten Mal. Er stand in sich selbst versunken an seine Linde gelehnt, die Kamera halb erhoben, als ihm von links urplötzlich jemand ins Bild lief. Weiße Jeans, eine hellrosa Bluse, durch die dieses phantastische Licht hindurchschien und eine weibliche Figur erahnen ließ. All das eingerahmt von üppigem rotem Haar, das locker zu einem langen Pferdeschwanz zusammengebunden war.
Dieses elfenhafte Wesen schwebte an ihm vorüber, ihr zu Füßen zwei kleine, weißfellige Hunde, die ihr in engem Abstand folgten. Dazu konnte er ein leises, feines Juchzen über das unglaubliche Licht und die schöne Stimmung vernehmen sowie freudige Selbstgespräche darüber, wie wunderbar doch überhaupt alles hier auf ihrem Berg gerade sei. Die Elfe benahm sich so unbedarft, als wäre außer ihr niemand sonst zugegen, so als sei sie völlig allein auf dem Berg.
Selbstvergessen und ohne ihn zu registrieren, tänzelte sie an ihm vorbei – und Florian stand mit offenem Mund da und staunte. Er staunte und fragte sich, wie es so etwas Schönes überhaupt geben konnte. Mehrere Sekunden lang war er sprachlos und, was noch viel schlimmer war, absolut handlungsunfähig. Irgendwann kriegten sich seine Synapsen wieder ein, und er riss die Kamera so heftig ans Auge, dass sie gegen seine Augenbraue schlug, was richtig wehtat. Sich den Schmerz verbeißend, schoss er ein Bild nach dem anderen von dieser wundervollen Frau, bis sie rechter Hand hinter den Bäumen verschwand und der Speicher seiner Kamera endgültig die weiße Fahne schwenkte.
Hektisch begann er damit, Bilder vom Anfang des Tages zu löschen, die ihm vom Bildeindruck weit weniger wichtig erschienen als das, was er gerade vor seiner Linse hatte. Als er sich auf diese Art und Weise etwas Freiraum auf der Speicherkarte geschaffen hatte und hochblickte, sah er sie erneut. Sie war wieder da. Nur wenige Meter von ihm entfernt saß sie im Gras und betrachtete unbewegt den Horizont.
Noch während Florian die Kamera hob, ging ihm alles Mögliche durch den Kopf. Wer war sie? Wo kam sie her? Wieso war sie allein hier oben, und vor allem wann drehte sie sich endlich um? Denn bis jetzt hatte er nur diese unglaubliche Rückenansicht bewundern und fotografieren dürfen. Nur eine dieser Fragen sollte an diesem Tag beantwortet werden, und zwar die, wie dieses Wesen denn von vorne aussah. Denn irgendwann, nach einer unendlich langen Zeit, drehte sie sich tatsächlich um und sah ihm genau in die Augen.
Sie hatte ein wunderschönes Gesicht, aus dem eine abgrundtiefe Traurigkeit sprach. Ein Gesicht, dem etwas Dunkles innewohnte, auch wenn diesem Eindruck durch die Schönheit des Abends die Schärfe genommen worden war. Das war kurz und knapp das Erste, was Florian in den Sinn kam. Aber er hatte keine Zeit für komplizierte Gedankengänge, denn er musste sich ja erklären, dem fragenden Blick der rothaarigen Elfe irgendwie begegnen.
»Äh, ja, also«, stotterte er verlegen. »Entschuldigung, ich bin Fotograf, und ich habe Fotos von dir gemacht. Es sind sehr schöne Fotos geworden, aber anstandshalber wollte ich fragen, ob es okay ist, wenn ich die für meine Website verwende.«
Aus dem misstrauischen Blick der Schönheit wurde ein breites Lächeln. Sie zeigte auf seine Kamera und meinte: »Kann ich mal sehen?«
»Ja, gern«, erklärte er diensteifrig und hielt ihr das Display der Kamera vors Gesicht. Dann blätterte er einige der zuletzt geschossenen Fotos durch, was sie zu beruhigen schien.
»Ach Gott, die sind ja alle zu dunkel, da erkennt man ja gar nichts«, sagte sie weiterhin lächelnd. »Ist schon okay.« Sie wandte sich wieder ihren beiden Hunden zu und hatte Florian mutmaßlich bereits wieder vergessen.
Ganz und gar nicht vergessen konnte dieser derweil das Gefühl, das ihn in dem kurzen Moment der Begegnung überkommen hatte. Es war, als hätte ihm jemand eine warme Decke über seine Schultern gelegt. Dann hatte sie sich abgewandt, und der Moment war vorbei gewesen. Aber das warme Gefühl der Geborgenheit würde ihm noch lange in Erinnerung bleiben, das wusste er.
Die Fotos waren natürlich keineswegs fehlerhaft oder zu dunkel. Leicht unterzubelichten gehörte bei anspruchsvollen Fotografen zum täglichen Handwerk. Ein dunkles Bild konnte man am Computer korrigieren, ein überbelichtetes nicht, das war dann futsch. Das wusste die rothaarige Schönheit anscheinend nicht, also war Florian erst einmal nur extrem erleichtert, dass er die Fotos behalten durfte. Sonst müsste er ja denken, er hätte das alles nur geträumt.
Die Elfe rief ihre beiden kleinen Hunde und machte sich auf den Heimweg. Auch die Sonne war endgültig untergegangen. Er schaute der rothaarigen Erscheinung hinterher, bis sie im diffusen Dämmerlicht in Richtung Parkplatz verschwunden war. Sofort machten sich Trauer und Frustration in ihm breit. Sie war gegangen. Womöglich würde er sie niemals wiedersehen. Sie wäre nur noch ein allmählich verblassendes Bild in seiner Erinnerung, das er wohl bald vergessen hätte. Allein die Fotografien von ihr, die würden ihm bleiben.
Florian Kauper packte seine Siebensachen ein und machte sich auf den Rückweg zu seinem Roller. Unterwegs ertappte er sich immer wieder dabei, wie er hoffnungsvoll nach rechts und links in den Wald schielte. Vielleicht war sie ja mit ihren Hunden einen kleinen Umweg gelaufen, vielleicht wartete sie sogar auf ihn, und sie trafen unvermutet wieder aufeinander.
Aber es blieb dunkel auf seinem Weg und menschenleer. Die rothaarige Elfe war und blieb verschwunden. Auch als er mit seinem Roller den Veitsberg verließ und durch den kleinen Ort Dittersbrunn fuhr, den man zwangsläufig durchquerte, wenn man zurück in die Zivilisation wollte, ließ er seine Blicke schweifen. Allein, es blieb dabei, eine unverhoffte, schöne Episode in seinem gerade so unerfreulich turbulenten Leben hatte ihr Ende gefunden.
So fuhr Florian Kauper zurück nach Dörrnwasserlos in sein altes Häuschen und sah sich auf seinem Computer die Fotos an, die er oben auf dem Veitsberg eingefangen hatte. Noch einmal durchlebte er den stimmungsvollen Abend und die Momente mit der schönen Unbekannten. Nach langem Abwägen und Betrachten wählte Florian eine besonders schöne Aufnahme von ihr aus und stellte sie auf seiner Homepage ein, auf der seine bis dato liebsten Bilder zu sehen waren. Fotografien, die er als etwas Besonderes empfand und die dort bis in alle Ewigkeit zu sehen sein sollten, zumindest solange er lebte, so weit war er sich sicher. Die rothaarige Frau war nun auch darunter. Ein wunderschönes Foto von hinten, wie sie in ihrer ganzen roten Pracht hinab ins Maintal blickte und den Sonnenuntergang bewunderte.
Die Bilder des Fotoshootings am Veitsberg kopierte er auch auf sein Handy, vielleicht weil sie so ein besonderes Gefühl in ihm auslösten. Jedenfalls würde er sie fortan immer auf dem iPhone dabeihaben, was ihm fürs Erste ein durchaus beruhigendes Gefühl bescherte. Schließlich ging er total kaputt ins Bett – was für ein turbulenter Tag war das doch gewesen.
So lag er da, allein in seinen Kissen. Eine Weile ging ihm die Unbekannte noch durch den Kopf, bis die Müdigkeit gnädig seine Augen schloss.
***
Kriminalhauptkommissar Franz Haderlein parkte seinen Land Rover so nah wie möglich an der Polizeiabsperrung und ging vor bis zu dem rot-weißen Absperrband, das sich direkt unterhalb der halb fertigen Autobahnbrücke befand. Einer der anwesenden Streifenpolizisten hob das Band in die Höhe, damit Haderlein leicht gebückt darunter hindurchgehen konnte. Schon nach wenigen Metern stand er dann vor der traurigen Bescherung.
Direkt vor ihm lag ein völlig zertrümmerter Pkw, der irgendwie den Eindruck machte, als hätten die Insassen mit aller Gewalt versucht, mit dem Auto bis zum Erdmittelpunkt vorzustoßen. Das Heck des dunkelblauen Audis ragte kerzengerade und unversehrt nach oben, während der vordere Teil des Fahrzeuges wie eine Ziehharmonika zusammengefaltet war. Vom Fahrgastraum war nur noch der Fond einigermaßen erkennbar; dort, wo sich das Lenkrad befinden musste, war nichts mehr zu erkennen, zu gewaltig waren die Kräfte gewesen, die das Fahrzeug auf weniger als die Hälfte seiner ursprünglichen Größe zusammengefaltet hatten.
Der Notarzt, der bis jetzt darum bemüht gewesen war, mit seinem Arm bis zu den eingeklemmten Insassen vorzudringen, stand auf und schüttelte niedergeschlagen den Kopf. Ein untrügliches Zeichen, dass es keine Hoffnung mehr gab, die verunfallten Personen noch lebend bergen zu können. Haderlein sah nach oben zur halb fertigen Autobahnbrücke. Die letzten Jahre hatte man damit zugebracht, eine Hälfte der Breitengüßbacher Brücke, die zur Autobahn Bamberg/Suhl gehörte, abzureißen und durch eine völlig neue, stählerne Brückenkonstruktion zu ersetzen. Bis 2022 sollte auch die andere Hälfte der Brücke, die einer riesigen Welle nachempfunden war, fertiggestellt sein. Die alte Autobahnbrücke hätte den Erschütterungen, welche die neue ICE-Strecke darunter verursachen würde, auf Dauer nicht standgehalten.
Haderlein musterte die Brückenbaustelle genau, aber er konnte beim besten Willen keine Schäden an der Absperrung erkennen. Alles schien völlig intakt zu sein, das Autowrack musste aber doch von irgendwo hergekommen sein.
Irritiert wandte er sich an den nächstbesten Polizeibeamten. »Okay, ich blicke nicht so ganz durch. Dieses Fahrzeug sieht aus, als wäre es von der Brücke dort oben heruntergestürzt. Ich sehe aber keinerlei Anzeichen dafür. Können Sie mir das vielleicht einmal erklären?«
Der Polizeibeamte nickte flüchtig und deutete auf eines der Einsatzfahrzeuge, die mit rotierenden Blaulichtern etwas abseits der Unfallstelle standen. »Ja, das ist in der Tat seltsam. Kommen Sie mit, ich fahre Sie rauf, dann können Sie es sich persönlich ansehen.«
Er ging dem Kommissar voraus zu seinem Streifenwagen. Nahe der Absperrung sah Haderlein schon die Männer von der Spurensicherung anrücken. Er hatte aber keine Zeit mehr, Heribert Ruckdeschl und seine Mannen zu begrüßen, denn sie waren bereits am Polizeifahrzeug angelangt. Mit Blaulicht und Sirene fuhren sie der abgesperrten Autobahnauffahrt entgegen, die zu der neuen Autobahnbrücke hinaufführte.
***
Die Nebelschwaden am Kemnitzenstein wurden der immer stärker werdenden Kraft der Sonne allmählich überdrüssig und gaben schließlich auf. Als hätte sie jemand in höhere Gefilde abberufen, lösten sie sich in immer feiner werdende Dunststreifen auf und verschwanden schließlich für den Rest des Tages im Nirgendwo des Äthers. Der Kemnitzenstein mit seinen markanten Dolomit-Formationen lag nun wieder frei und konnte, von störenden nebligen Einflüssen unbehelligt, von der morgendlichen Sonne beleckt werden.
Die friedliche Ruhe, die sich über das Gelände legte, währte jedoch nur eine knappe halbe Stunde, dann war das klappernde Geräusch eines herannahenden Vehikels zu hören, das entfernt an die charakteristische Tonalität eines Automobils erinnerte. Die seltsame Geräuschkulisse gehörte tatsächlich zu einem Auto, das seine besten Tage jedoch schon lange hinter sich hatte. Der orangefarbene Renault Kangoo war von Roststellen übersät, und auch der Auspuff hörte sich nicht so an, als ob er den nächsten TÜV-Termin noch überstehen würde. Als der Motor erstarb, entstieg dem orangefarbenen Vehikel aber immerhin eine fünfköpfige Familie, die von der altersschwachen Kiste bis hinauf auf den Kemnitzenstein transportiert worden war.
Der Familienvater, mit seinen langen, zerzausten Haaren und dem Vollbart eine Art Aushilfsjesus für Arme, blickte entspannt und höchst zufrieden in den blauen, wolkenlosen Himmel, während hinter ihm seine Lebensgefährtin halb in den Wagen gebeugt die drei gemeinsamen Kinder für den freiluftigen Aufenthalt vorbereitete.
»Hab ich nicht gesagt, der Nebel verpisst sich, hab ich’s nicht gesagt?«, frohlockte Klaus Bernhard laut, was seine Freundin nur mit einem stillen Grinsen quittierte.
Ihr Mann hatte wieder einmal recht gehabt mit dem Wetter, das musste man ihm lassen. Wenn er auch sonst nicht viel im Leben auf die Reihe brachte, mit seinen Wetterprognosen lag der angehende Geologe meistens richtig. Trotzdem wäre es ihr lieb, wenn ihr begeisterungsfähiger Lebensgefährte nicht länger versuchen würde, die Weltrekordzeit für ein Universitätsstudium in neue, ungeahnte Höhen zu treiben. Irgendwann musste er auch mal mit dem Arbeiten anfangen und richtiges Geld verdienen, ob er es nun wahrhaben wollte oder nicht. Aber jetzt war nicht die Zeit dafür, dieses Thema zu diskutieren, dem Familiennachmittag mit Klettern und Picknick auf dem wunderschönen Areal stand nun nichts mehr im Wege.
»Ach du Scheiße«, hörte sie da ihren Mann in halb frustriertem, halb entrüstetem Tonfall rufen und richtete sich auf, um zu sehen, was Klaus so Empörendes entdeckt hatte. Der zeigte nur kurz mit dem Arm in Richtung Felsformation, und sofort wusste auch sie, was los war.
Dort stand, im eigentlich für motorisierte Fahrzeuge gesperrten Bereich, ein Wagen, und zwar direkt neben der kleinen Hütte am Kemnitzenstein. Wahrscheinlich sollte man die Protzkiste nicht sehen, deswegen war sie hinter der Hütte abgestellt worden. Aber das Heck war trotzdem klar und deutlich zu erkennen. Ein dunkelblauer Porsche Panamera mit fetten, breiten Reifen und Bamberger Nummernschild.
»Der Schober ist schon wieder da. War ja klar, dass dieser neureiche Idiot sich mitten ins Gelände stellt, um bloß keinen Meter zu viel laufen zu müssen. Scheiß auf Schilder, scheiß auf Naturschutz! Hauptsache, er ist der Erste an der Wand!«, wetterte Klaus Bernhard und verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Missmutig hielt er nach dem verhassten Kletterkollegen Ausschau.
»Na, wieder ein Neidanfall auf den erfolgreichen Schulkollegen?«, stichelte Eva Schmauser ernüchtert, während sie den Panamera musterte. Da hatte sie sich so auf den Tag mit ihrer Familie gefreut, und ausgerechnet heute musste Schober hier auftauchen, der Lieblingsfeind ihres Lebensgefährten. Sie selbst konnte gar nicht so viel gegen den Mann sagen, sie fand ihn privat sogar ganz nett, aber bei Klaus sah das etwas anders aus. Ihn und Schober verband wohl noch immer so was wie eine alte Kindergartenfeindschaft. Das würde garantiert wieder in sinnlosen Streitgesprächen zwischen den beiden enden. Wortlos zog sie sich ins Auto zurück, um den Kindern die Schuhe anzuziehen; aus dem sich anbahnenden Zoff wollte sie sich mal lieber heraushalten.
Klaus Bernhard scannte unterdessen Stück für Stück den Felsen, um irgendwo eine Spur seines verhassten Schulkollegen zu finden, aber von Otmar Schober war nichts zu sehen. Vielleicht hatte der Kerl seine Tour ja schon beendet und war in den Wald gegangen, um sich zu erleichtern, wäre doch möglich. Da Eva immer noch intensiv damit beschäftigt war, die Kinder zu betüddeln, entfernte er sich ein Stück vom Wagen, um etwas näher an die Felsen heranzukommen. Vielleicht saß Otmar ja gerade hinter einem der herabgestürzten Felsbrocken und verzehrte gemütlich sein Frühstück.
Und tatsächlich, Klaus Bernhard hatte auf dem leicht ansteigenden Gelände noch keine zwanzig Meter zurückgelegt, als er bereits einen großen schwarzen Rucksack hinter einem der Felsbrocken hervorschauen sah.
»Na also, hab ich es mir doch gedacht«, brummte er selbstzufrieden in seinen Bart und steuerte schnurstracks auf Fels und Rucksack zu. Jetzt würde er dem Typen erst einmal einen Vortrag über Naturschutzgebiete und deren Regeln halten. Dieser überhebliche Porschefahrer dachte wohl, er könne sich neuerdings alles erlauben.
»Hi, Otmar, du musst dich nicht verstecken, ich weiß genau, dass du da bist!«, rief er laut und stellte sich auf einen ertappt aufspringenden Otmar Schober ein, der ihn bestimmt halb freudig, halb genervt begrüßen würde. Aber nichts dergleichen geschah. Kein erschrockener Schober, kein genervter Blick – nichts. Das blieb auch so, bis Klaus Bernhard den Felsblock entschlossenen Schrittes umrundet hatte und am Fuße der Felswand zum Stehen kam. Dann war es unverhofft an ihm, überrascht zu sein, und zwar auf eine Art und Weise, mit der er auf gar keinen Fall gerechnet hatte.
Als Eva Schmauser zur Schiebetür hinauskletterte, sah sie erstaunt, wie ihr Lebensgefährte im Dauerlauf und mit wehenden Haaren zum Auto zurückgerannt kam, wo er sie schwer atmend mit beiden Händen an der Schulter packte.
»Mein Handy! Wo ist mein Handy?«, rief Klaus Bernhard erregt, während sich seine Finger in die Oberarme seiner Lebensgefährtin krallten.
Eva Schmauser reagierte konsterniert ob der panischen Attacke ihres Freundes, war sie doch so etwas von ihm überhaupt nicht gewohnt. Normalerweise war er sogar die Ruhe in Person, eine Eigenschaft, die man für ein so ausgedehntes Dauerstudium auch zwingend benötigte. Aber jetzt führte Klaus sich ja auf, als hätte er den Leibhaftigen persönlich gesehen. Sie starrte ihn nur ungläubig an und spürte überhaupt nicht den schmerzenden Griff um ihren Oberarm.
»Das Handy!«, schrie Bernhard erneut mit weit aufgerissenen Augen. »Jetzt versteh doch, Eva, ich muss die Polizei anrufen! Da oben liegen zwei Tote! Hörst du? Also, wo ist das Handy?«
»Auf dem Rücksitz, unter der Jacke«, antwortete Eva Schmauser tonlos und blickte zu den Kletterfelsen des Kemnitzensteins, von denen soeben jeglicher Frühlingszauber gewichen war.
***
Die folgenden Wochen waren für Florian Kauper so turbulent und anstrengend wie immer. Die On-off-Beziehung wurde wieder aufgenommen, mit dem Ergebnis, dass er in dasselbe Beziehungsdesaster rutschte wie zuvor. Die schönen Momente waren da, die Katastrophen aber auch. Wirklich glücklich war er damit nicht, eher das Gegenteil davon. Aber noch war der Steinbock in ihm der festen Überzeugung, nicht aufgeben zu dürfen. Als hätte er ein festgelegtes Programm der inneren Durchhalteparolen abzuspulen, lief er weiter in der ständigen Beziehungstretmühle. Die Erinnerung an die rothaarige Frau auf dem Berg hatte er zwischenzeitlich verdrängt, die Begegnung als schönen, aber singulären Event in seinem Leben abgeheftet.
So vergingen die Tage, die Wochen. Florian Kaupers Leben schleppte sich zwischen Frohsinn und Qual dahin, das altbekannte Muster seines Lebens. Bis er sich eines Tages wieder an die einmalige Stimmung auf dem Veitsberg erinnerte, die er vor vielen Wochen erleben durfte. Wieder einmal packte ihn die Unruhe, und so nahm er seine Kamera und machte sich auf den Weg zu seiner Pilgerstätte. Seit jenem Tag war er nicht mehr auf dem Veitsberg gewesen. An die rothaarige Frau hatte er schon länger nicht mehr gedacht, aber als er jetzt wieder auf seiner Bank saß, diesmal ganz allein und mit einer weit weniger romantischen Stimmung um ihn herum, da fiel sie ihm wieder ein.
Mit einem wehmütigen Lächeln dachte er an den schönen Abend im Juni zurück, dann konzentrierte er sich auf seine Kamera, auch wenn er wusste, dass er heute keine sensationellen Fotos würde schießen können. Der Veitsberg war immer schön, das Licht aber zu normal. Und die Lichtverhältnisse würden sich auf ewig an denen vom 15. Juni messen lassen müssen.
Florian Kauper saß noch keine Viertelstunde an seinem Platz auf der Bank, als er von links auf einmal Schritte hörte und ein kleiner weißer Hund in sein Sichtfeld lief. Er starrte ihn zuerst nur verblüfft an, dann kam auch sie. Wieder mit Pferdeschwanz, etwas wärmer angezogen, vor allem aber in einem gänzlich anderen Allgemeinzustand als damals im Juni, nämlich mit eindeutig verheultem Gesicht. Sie war so traurig und in sich versunken, dass sie Florian Kauper gar nicht bemerkte, der spontan beschloss, diesmal sofort die Initiative zu ergreifen. Tatsächlich ohne weiterreichende Absichten, die Unbekannte tat ihm gerade einfach nur leid.
»Wieso nur noch ein Hund? Das waren doch mal zwei?«, fragte er aus dem Bauch heraus, bereits ahnend, dass wohl etwas Schlimmeres mit dem fehlenden kleinen Weißen passiert sein musste.
Und wieder geschah etwas, was er nicht mehr vergessen würde. Sie schaute ihn kurz und prüfend an, dann sah er das Erkennen in ihren blauen Augen. Sie wusste offenbar sofort, wer er war, kam einfach auf ihn zu und setzte sich zu ihm, direkt neben Florian auf die Bank. Ohne Umschweife begann sie mit mühsam unterdrückten Tränen, ihm ihre jüngere Lebensgeschichte zu erzählen. Dass der andere kleine Hund tatsächlich vor Kurzem gestorben war, dass sie heute zum ersten Mal wieder die Kraft aufgebracht hatte, auf den Berg hinaufzusteigen, und dass sie allein in einem kleinen Häuschen unten in Dittersbrunn wohnte, um eine katastrophale Trennung zu verkraften. Eine Trennung, die wohl von der schlimmeren Art gewesen war.
Das alles brach einfach so aus ihr heraus und noch vieles andere mehr. Die Tränen flossen irgendwann unaufhörlich, und Florian kam mit dem Anreichen der Papiertaschentücher gar nicht mehr nach. Diese Frau vertraute sich ihm, einem eigentlich wildfremden Mann, uneingeschränkt an, kehrte ihr Innerstes nach außen. Das war einerseits ein begrüßenswerter Schritt in seine Richtung, aber auch ein verzweifelter Schrei nach Hilfe, wie ihm schien.
Und während das zarte Geschöpf neben ihm schluchzte und erzählte und er damit beschäftigt war, im Akkord Tempos zur Verfügung zu stellen, war es auf einmal wieder da, das unbeschreibliche Gefühl, als würde ihm jemand eine große, warme Decke über die Schultern legen und ihm zuflüstern: »Du bist zu Hause, bleib hier, hier bei ihr.«
Das klang für Florian Kauper im Nachhinein ziemlich esoterisch, war aber so, besser konnte er es nicht beschreiben. Im Moment, als es passierte, war er aus vielerlei Gründen überfordert und konnte mit dieser merkwürdigen Empfindung, die sich da gerade über ihn hermachte, eher wenig anfangen. Aber es war schön, irgendwie war es total schön, obwohl es dem Häufchen Elend da neben ihm überhaupt nicht gut ging.
Allerdings waren die Tränen irgendwann ausgeweint, und sie hatte sich wieder einigermaßen im Griff. Zumindest so weit, dass sie sich für ihren desolaten Gemütszustand entschuldigte und wissen wollte, wer ihr Gesprächspartner denn eigentlich genau sei. Außer dem Umstand, dass er sie fotografiert hatte, wusste sie ja nichts über ihn.
Also erzählte er ihr, dass er selbstständiger Schreiner in Dörrnwasserlos war und dort seit Jahren ein altes Häuschen restaurierte. Eigentlich war dieses Häuschen eine einzige Werkstatt mit Schlafgelegenheit, mehr nicht. Und dann fragte er sie auch gleich, ob sie eigentlich wisse, dass sie sich gerade auf heiligem Boden befänden. Nicht wegen der Kapelle, sondern aus historischer Sicht. Einer verbreiteten Theorie zufolge sei das früher ein heiliger Ort der Kelten gewesen, ein sogenanntes »Nemeton«. Bewiesen war das freilich nicht, aber Florian Kauper fand diese kürzlich aufgekommene Erkenntnis erstens logisch und zweitens absolut nachvollziehbar. Er war schon immer spirituell angehaucht gewesen und beschäftigte sich ausgiebig mit heiligen Orten und Kraftplätzen. Und das hier war seiner Meinung nach ein ganz gewaltiger. Aus diesem Grund erzählte er ihr auch, warum er seit so vielen Jahren so gerne den Veitsberg besuchte. Nämlich um Ruhe und Frieden zu finden, wenn sich sein Leben gerade wieder einmal überschlug.
Die unbekannte Schöne hörte sich alles aufmerksam an, nickte wissend, und am Ende schaffte die rothaarige Elfe es sogar zu lächeln. Florian Kauper wurde es ein weiteres Mal warm ums Herz. Ihm war, als gewährte ihm diese gequälte Seele für einen kurzen Moment Einblick in ihr tiefstes Inneres. Es schien absolut hell, fröhlich und optimistisch zu sein, war aber vergraben unter den Tonnen von Schutt eines zerstörerischen Trennungsprozesses. Dann ging das kleine Fenster auch schon wieder zu, und sie zog sich hinter sichere Mauern zurück.
Der kurze, helle Augenblick war vorüber, nicht aber das warme Gefühl, das sich bei ihm eingestellt hatte. Die große, wärmende Decke ruhte immer noch auf seinen Schultern.
Eine Weile saßen sie noch da und plauderten, dann wollte sie mit ihrem verbliebenen Hündchen wieder zurück nach Dittersbrunn, wo sich irgendwo ihr Zuhause befand. Ihm schien, sie war von ihrer eigenen Offenheit und Courage überrascht und vielleicht auch ein wenig erschrocken, so viel von ihrer Lebensgeschichte preisgegeben zu haben.
Florian bot ihr an, sie bis zu ihrer Abzweigung zu begleiten, was sie auch dankend annahm. So spazierten sie zusammen den geschotterten Weg entlang, bis sie an dem steilen Pfad anlangten, der hinunter ins Dorf führte. Dort verabschiedeten sie sich. Sie gab Florian die Hand und sagte, dass es doch schön wäre, wenn sie sich vielleicht irgendwann wieder einmal hier oben treffen könnten. Und endlich erfuhr er auch ihren Namen: Amelie.
Noch einmal lächelte sie ihm zu, dann ging sie auf dem Pfad nach unten, und er machte sich auf seinen altbekannten Weg zurück zu seinem Parkplatz.