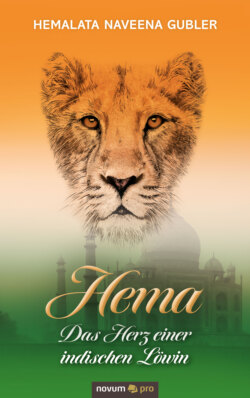Читать книгу Hema - Das Herz einer indischen Löwin - Hemalata Naveena Gubler - Страница 7
Оглавление3
Die Wochen danach
Zwei Tage später musste ich nochmals ins Spital. Ich hatte so starke Bauchschmerzen und Angst, dass etwas mit meinem Magen oder Bauch nicht in Ordnung war. Mein Mann fuhr mich abends in die Notfallaufnahme, obwohl ich wusste, dass ich dort wieder lange warten würde, alleine in einem Wartezimmer, aktuell mit Schutzmaske, unter dieser ich wieder weniger Luft bekäme. Aber ich brauchte Gewissheit. Leon schlief bereits, als Dave mich mit Lilly ins Spital fuhr. Eigentlich wollte ich selber fahren, aber kaum war ich aus der Garage, ging nichts mehr. Ich hatte Angst, dass ich den Weg nicht schaffe, dass ich ohnmächtig werden könnte, dass ich zu erschöpft und müde war, um mich auf die Straße zu konzentrieren. Früher hätte ich nie weggehen können, wenn eines der Kinder geschlafen hatte, weil es ja jederzeit hätte aufwachen können und dann niemand da war. An diesem Tag musste es sein.
Im Spital wurden diverse Untersuchungen gemacht. Ein Ultraschall vom Bauch wurde durchgeführt, die Leber- und Nierenwerte geprüft, Bakterienstatus analysiert, Herztöne abgehört und noch vieles mehr. Alles war gut. Ich sei eine gesunde junge Frau, hieß es. Aber nach der Meinung der Ärzte litt ich an einer enormen Überbelastung und ich müsste dringend eine intensive Psychotherapie in Anspruch nehmen. Ich bräuchte wirklich Hilfe. Das war nicht sehr ermutigend und ich wusste nicht, was ich denken sollte.
Zu Hause versuchte ich, mich irgendwie abzulenken, doch in meinem Kopf rotierte es weiter. Ich war traurig und enttäuscht. Enttäuscht über mich selber.
Was, wenn es wirklich wahr war? Was, wenn ich wirklich plötzlich unter Panikattacken und Angstzuständen litt? War ich wirklich überfordert und überlastet mit meinem Leben? Wäre es besser gewesen, wenn ich nicht Mutter geworden wäre? Meine Kinder verdienten eine Mama, die alles schaffte und die Kraft hatte, und keine, die plötzlich Angst vor den normalsten Dingen dieser Welt hatte. Ich war nicht gut genug für sie. Sie hatten etwas Besseres verdient. Dieses Gefühl schmerzte so sehr in meiner Brust, dass ich zwei Stunden am Stück weinte und so dann irgendwann voller Erschöpfung einschlief.
Wie die nächsten drei Wochen verliefen, ist kaum zu beschreiben. Ich war nicht mehr ich selber. Ich lebte jeden Tag mit der Furcht, dass sich dieser 4. Juli wiederholen könnte. Ich hatte täglich schlimme Magenschmerzen und verspürte eine innere Unruhe und Nervosität in mir, die ich bis vor diesem Tag beim Kinderarzt nicht gekannt hatte.
Zwei Mal kam May vorbei und hatte für mich eingekauft und bei uns zu Hause Lasagne gekocht. May hatte ich vor über zehn Jahren in Australien kennengelernt. Ich pflegte gerne zu sagen, dass sie das beste Souvenir war, das ich aus Australien mit nach Hause genommen hatte. Einige Jahre waren wir sehr eng befreundet, hatten uns jede Woche mindesten einmal gesehen, machten die Zürcher Tanzclubs und Bars unsicher und verbrachten Nächte damit, die Staffeln von Sex and the City zu schauen und Wein zu trinken. Zusammen hatten wir in Australien wie auch hier, zurück in der Schweiz, die verrücktesten Geschichten erlebt. Ja, May kannte viele meiner Sünden und während ich an das eine oder andere Abenteuer dachte, prustete ich lautstark heraus. May war wunderschön und ich kannte niemanden sonst in meinem Umkreis, der so viele Tätowierungen hatte wie sie. Blumen, Ornamente, Früchte, da gab es Allerlei, was ihren Körper schmückte. Sie arbeitete auch einmal in einem Tattoogeschäft als Piercerin und konnte später sogar die Funktion als Filialleiterin dort übernehmen. Ich war stolz auf sie. Was unter anderem einer der Gründe war, wie ich selbst auf den Geschmack von Piercings und Tattoos kam. In den letzten Jahren hatten wir uns zwar ein bisschen auseinandergelebt, aber das war auch absolut verständlich. Schließlich lebten wir zwei völlig verschiedene Leben und mit Arbeit und Familie war es für mich nicht immer so einfach, alle Freundschaften noch gleich intensiv zu pflegen. May hatte seit ein paar Jahren auch wieder einen Freund und zog mit ihm in eine gemeinsame Wohnung. May und ihr Freund hatten aber noch Zeit zu Reisen, Ferien zu buchen, auswärts essen zu gehen und das ganze Wochenende auch einmal faul auf dem Sofa zu gammeln. Das war der Unterschied zu meinem Familienleben mit zwei Kindern.
Ich liebte Mays Lasagne und war ihr sehr dankbar dafür, dass sie Zeit hatte, mit Lilly herumzualbern und uns etwas Feines zu kochen. Leon war wie immer zufrieden in seiner Wippe und noch glücklicher, wenn er seiner Schwester zuschauen konnte. Sobald Lilly nämlich aus seinem Blickfeld verschwand, begann er zu weinen. Zuckersüß und eine Verbindung, die es so von Anfang an und mit dieser Verbundenheit wohl nur bei Geschwistern geben konnte. Wie es später einmal zwischen ihnen sein würde, wusste ja noch keiner.
Meine Kreislaufprobleme waren beinahe den ganzen Tag vorhanden. Ich hatte auch keinen Appetit mehr, ich kochte zwar für meine Tochter und meinen Mann, aber ich selber brachte keinen Bissen hinunter. Ab und zu versuchte ich sogar einen Löffel von Leons Babybrei, und das auch nur, damit ich überhaupt irgendetwas für meinen Magen unternahm. Ich hatte nämlich sehr wohl Hunger, ich hatte Lust auf meine geliebte Pasta, ich wollte Pizza bestellen und Gemüse kochen. Doch sobald ich ein bisschen davon auf der Gabel hatte, brachte ich die Gabel letztlich nicht mehr in den Mund. Ich wusste nicht, was mich blockierte. Es kam mir vor, als wäre ich zu müde, zu erschöpft, um zu kauen und zu schlucken. So kam es, dass ich zuerst einen Tag lang nichts aß, dann zwei Tage, dann drei Tage, bis schließlich mehr als eine Woche so verging. Dann schaffte ich es wieder einmal, ein paar Löffel Joghurt zu schlucken, mehr nicht. Auch das machte mich nervös, ich musste doch endlich wieder essen. Wie lange konnte ein Mensch ohne Nahrung überleben? Ich wusste, dass diese Frage natürlich etwas übertrieben war. Aber ich machte mir dennoch langsam Sorgen beziehungsweise wusste, dass ich endlich wieder einmal richtig essen sollte. Ich trank dafür sehr viel Wasser und erhoffte mir davon, dass es gegen meine Kreislaufprobleme half. Drei bis vier Liter an einem Tag waren es. Es gab Tage, da ging es mir etwas besser und ich funktionierte einfach. Aber im Hinterkopf war immer die schlimme Vorstellung: Was, wenn ich wirklich ohnmächtig würde und ich alleine mit den Kindern wäre? Mein Mann arbeitete die ganze Woche und ich war noch im Mutterschaftsurlaub.
Gleichzeitig war noch die Eingewöhnung in der neuen Krippe mit beiden Kindern in meinem Kopf. Das stresste mich schon im Voraus. Was, wenn es Lilly in der neuen Krippe nicht gefiel? Was, wenn sie die anderen Betreuerinnen vermisste und sich nicht auf die neuen und unbekannten Kinder einlassen wollte? Leon war auch noch einen Monat jünger, als es Lilly damals war, als sie in der Krippe startete, weil mein Mutterschaftsurlaub dieses Mal einen Monat kürzer war als der letzte. Die Eingewöhnung in der Krippe gestaltete sich so, dass man die Kinder brachte, anfangs als Elternteil noch etwas dort blieb und dann immer länger und öfter wieder wegging, sodass die Kinder lernten, auch ohne Mama oder Papa zu sein, aber dabei die Gewissheit hatten, dass sie wieder kommen. Lilly kannte den Krippenalltag ja bereits aus der ersten Krippe, für Leon war es neu. Sie machten es beide wirklich großartig. Aber für mich war es dennoch ein Stress: beide bereitmachen, beide hinbringen und dann nur für eine kurze Zeit wieder nach Hause oder einkaufen gehen, dann wieder abholen und schlussendlich zwei übermüdete und quengelige Kinder zu Hause beschäftigen, bis es abends wieder ins Bett ging. Ich wusste, dass die Eingewöhnung nur eine Phase war, und vor allem eine sehr wichtige, und deshalb wollte ich das natürlich auch gut überstehen. Die Kinder sollten nicht spüren, welche Gedanken und Sorgen ich teilweise hatte.
An einem Mittwochmorgen, als ich die Kinder in der Früh in die Krippe bringen wollte, hatte ich auch wieder auf der Autofahrt Kreislaufprobleme. Der Schwindel war schlimm und ich wusste, dass es eigentlich fahrlässig war, in diesem Zustand selber zu fahren, zumal ich auch noch meine Kinder dabei hatte. Was, wenn ich während der Fahrt ohnmächtig würde? Es gäbe einen Unfall, im schlimmsten Fall wäre es nicht nur ein Blechschaden, sondern es gäbe Verletzte. Meine Kinder könnten verletzt werden, ich könnte tot sein und sie würden mich verlieren, ihre leibliche Mutter. So, wie es mir passierte, als ich in Indien war. Während ich das erste Mal diese Tatsache so bewusst wahrnahm, kämpfte ich mit den Tränen und versuchte mich am Lenkrad festzuhalten und mich weiter auf den Verkehr zu konzentrieren. Ich stand an der Ampel und wusste, dass ich nur noch links abzubiegen hätte, dann läge die Krippe auch schon vor uns. Ich musste es schaffen. Aber ich wusste nicht, ob ich das tatsächlich konnte.
Irgendwie brachte ich diese zwei Minuten Autofahrt dann doch noch hinter mich. Die Krippenleiterin bemerkte sofort, dass es mir nicht gut ging, und brachte mir Wasser. Als ich ihr sagte, dass der Kreislauf mir Probleme machte, suchte sie nach Schokolade, Gummibärchen und Traubenzucker. Ich setzte mich vor die Krippe auf den Parkplatz. Lilly verstand natürlich nicht, weshalb ich morgens bereits Schokolade essen durfte und draußen saß. Sie blieb die ganze Zeit bei mir und freute sich wohl einfach über die Süßigkeiten. Ich wollte nicht, dass sie bemerkte, wie schlecht es mir ging. Doch mittlerweile wusste ich, dass ich ihr nichts mehr vorspielen konnte, auch wenn sie erst zweieinhalb Jahre alt war. Lilly kannte mich. Und ich kannte sie. Sie streichelte meinen Bauch und sagte, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, dass Lilly da sei und dass das Bauchaua weggehen würde. Ich müsste auf dem Sofa eine Pause machen. Ich war so unglaublich stolz auf meine Tochter, wie viel sie mitbekam und wie fürsorglich sie war. Aber es machte mir auch Angst. Ich konnte ihr nicht erklären, was ich hatte, und ich wollte ihr auf keinen Fall sagen, dass Mama traurig war. Mama war schließlich immer fröhlich und tröstete die Tränen der Kinder, wenn diese traurig waren. Ich traute mich nicht mehr nach Hause zu fahren, obwohl die Kinder ja für den Vormittag in der Krippe bleiben konnten.
Ich rief meinen Mann an und er musste kommen und mich nach Hause fahren. Ich war ihm sehr dankbar, auch dafür, dass er mir keine Schuldgefühle gab, weil er bei der Arbeit alles stehen und liegen lassen musste. Ich war vor allem froh, dass er mich dafür nicht verurteilte. Aussagen wie, dass es ja nur zehn Minuten nach Hause wären oder dass ich mich zu Hause jetzt ja ausruhen könnte, weil die Kinder betreut waren, hätten mir in dieser Zeit nicht geholfen. Ich war Dave sehr dankbar dafür, dass er Verständnis hatte. Aber ich selber hatte diese Gedanken und Schuldgefühle natürlich schon. Es tat mir alles so leid und ich wusste nicht, wie ich das alles erklären und entschuldigen konnte. Zu Hause war jedoch keine Rede davon, mich hinzulegen. Ich tigerte durch die ganze Wohnung und wollte endlich eine Erklärung dafür und eine Antwort darauf, was in mir vorging, weshalb ich plötzlich vor so vielen Dingen Angst hatte. Ab diesem Tag hatte ich nämlich auch Angst, in ein Auto zu steigen. Und von selber fahren konnte sowieso keine Rede mehr sein.
Ich rief meinen Vater an. Er war vor einigen Jahren in die verdiente Frühpension gegangen und arbeitete deshalb nicht mehr. Er hatte seine ganze berufliche Tätigkeit dem Lehrersein gewidmet. Meine Mutter war auch Lehrerin, sie stand jedoch noch immer im Berufsleben. Manche dachten wohl: eine Lehrertochter, dann ist alles klar. Diesen Spruch hatte ich nämlich schon zur Genüge gehört. Ich hatte diese Aussage aber nie wirklich nachvollziehen können. Einen Bezug dazu gab es aber dennoch, diesen erkannte ich jedoch auch erst etwas später. Ich war froh, dass mein Vater Zeit hatte, um vorbeizukommen. Mein Vater war schon immer mein Vorbild gewesen. Oder wie man so schön sagt, ein Papa ist stets die erste Liebe einer Tochter. So war das auch bei mir. Ich liebte meinen Vater und sah zu ihm hoch, auch wenn ich heute selbst erwachsen und Mama war. An dieser Beziehung hatte sich nichts verändert, Papa ist und bleibt mein Held. Wie ich anfangs erwähnt hatte, bin ich adoptiert. Und somit ist er natürlich mein Adoptivvater und meine Mutter meine Adoptivmutter. Sie sind für mich meine Eltern, hatten mich groß gezogen, erzogen und mir ein Leben ermöglicht, dass ich nie hätte leben können, wenn ich damals, am 24. Februar 1994 nicht von ihnen adoptiert worden wäre.
Die Meinung meines Vaters war mir sehr wichtig und ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Ich konnte ihn stets um Rat fragen und es erfüllte mich mit Stolz, seine Tochter zu sein. Ich wollte deshalb immer alles machen und erreichen, damit er stolz auf mich sein konnte. Ich liebe es auch, meinen Vater mit meinen Kindern zu sehen. Er ist ein stolzer und fürsorglicher Nonno. Meine Eltern nennen sich als Großeltern Nonno und Nonna für meine Kinder. Das tun sie, weil wir in der Familie italienische Wurzeln haben und sich das meiste eigentlich immer um Italien dreht. Angefangen natürlich bei meinem geliebten Fußballverein, der AS ROMA, über unser Landhaus im Piemont und meinem Nonno, der in Süditalien lebt. Ich genoss die Gespräche mit meinem Vater jedes Mal, wir konnten uns vieles erzählen, über Gott und die Welt diskutieren und philosophieren. Er konnte mir von seinen Erfahrungen erzählen und ich ihm davon, was mich beschäftigte. Auch an diesem Tag war das so. Ich erzählte ihm, wie es mir ging, und auch wenn ich oft nach Worten suchte, um ihm in irgendeiner Weise verständlich zu machen, was in mir vorging, konnte er mich verstehen. Er erzählte mir, dass auch er einmal eine solche Krise hatte, jedoch aus anderen Gründen wie bei mir. Gründe? Ich kannte meine Gründe ja gar nicht. Wenn ich gewusst hätte, wo das Problem lag, wäre ich dieses gezielt angegangen und hätte dafür eine Lösung gefunden, das wusste ich. So, wie ich nun mal jedes Problem anging. Mir ging es bald etwas besser. Es tat mir sehr gut, dass er bei mir war, und es war schön, von ihm verstanden zu werden. Am Nachmittag holten wir gemeinsam wieder die Kinder ab und abends ging er zusammen mit meinem Mann dann mein Auto holen, welches ja noch immer vor der Krippe auf dem Parkplatz stand. Einmal mehr musste man mein Auto holen, weil ich nicht nach Hause fahren konnte.
Die nächsten Tage waren schlimm. Ich konnte nicht mehr alleine sein. Und damit meinte ich nicht, ganz alleine. Auch das Alleinsein mit den Kindern machte mir Angst, etwas ganz Normales, was bis dahin Gewohnheit und auch mein Alltag war. Meine Eltern kamen fast täglich vorbei, kümmerten sich um die Kinder, während ich nur da saß, immer wieder versuchte, etwas zu essen, wenn auch mit sehr mäßigem Erfolg, oder mich aufgrund von Schwindel und Magenschmerzen weinend ins Bett verkroch. Ich war energielos und hatte den Eindruck, dass mein Körper nicht einmal die Kraft hatte, meinen kleinen Sohn herumzutragen, dass meine Beine oder meine Arme nachlassen würden und er dann zu Boden fallen könnte. Ich traute mich kaum, ihn hochzuheben. Selbst wenn Lilly nur nach mir rief oder etwas trinken oder essen wollte, war das schon zu viel für mich. Ich tat oder gab ihr, was sie brauchte, innerlich zerbrach ich jedoch fast. Und ich stellte mir immer wieder dieselbe Frage: Wie viel konnte ich noch ertragen?
Ein paar Mal kam auch eine Nachbarin vorbei und schaute auf die Kinder, damit ich mich etwas hinlegen konnte, und ich war ihr sehr dankbar dafür. Ich rechnete mir bereits morgens die Stunden aus und plante, wer bei uns sein konnte, bis mein Mann abends wieder nach Hause kam. Aber auch wenn jemand da war, ich fühlte mich immer einsam, alleine und gefangen mit und in dieser Situation. Und die Schuldgefühle darüber, dass ständig jemand für mich da sein und mich unterstützen musste, waren eine schwere Last für mich. Ich wusste, dass mir alle gerne halfen, vor allem auch meine Eltern genossen es, so viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Wovor ich die ganze Zeit Angst hatte? Ich glaube, es war die schlimme Vorstellung, dass mir etwas hätte passieren können und die Kinder dann ihre Mutter nicht mehr hätten. Und das, obschon ich wusste, dass mir wirklich nichts passierte. Das war mir durchaus bewusst und auch im Spital vergewisserten sie mir ja, dass alles gut war. Und dennoch waren diese Gedanken und Gefühle da. Diese große Angst und Panik, die enorme Nervosität und diese angespannte innere Unruhe. Sie hielten mich gefangen, sie bestimmten seit diesem 4. Juli meinen Alltag, zwangen mich in die Defensive und schüchterten mich mehr ein, als jemals irgendetwas anderes, was mir bis dahin in meinem Leben geschah.
Es gab in dieser Zeit nur einen einzigen Tag, an welchem ich mich besser fühlte. Es war ein heißer Sommertag. Am Nachmittag kam Mario, ein guter Freund von mir, mit seinem kleinen Sohn vorbei. Wir kannten uns schon viele Jahre. Einige Jahre lang war der Kontakt jedoch nur auf ein „Happy birthday“ oder „Frohes Neujahr“ beschränkt. Seit wir beide jedoch Eltern wurden und so auch vieles über die kleinen Knöpfe auszutauschen hatten, wurde der Kontakt wieder intensiver und es entstand auch eine sehr schöne und für mich auch wichtige neuauferstandene Freundschaft. Der Kleine war nur vier Monate jünger als Lilly. Ich betete den ganzen Morgen dafür, dass es mir an diesem Tag gut gehen würde und dass es auch am Nachmittag so bleiben würde. Und falls nicht, dass Mario mir zumindest nicht anmerken würde, wie ich mich innerlich fühlte. Wir hatten uns schon sehr lange nicht mehr gesehen und ich freute mich riesig, auch darüber, dass der Kleine mitkam und Lilly jemanden zum Spielen hatte. Die Kleinen aßen Eis, tobten im Garten herum und warfen die Spielsachen in unseren Pool. Leon saß dabei in seinem Kinderstuhl und beobachtete alles mit seinen großen Augen. Ich genoss es, den beiden beim Spielen zuzuschauen. Es war ein schöner Tag, ein Tag ohne Bauchschmerzen und ohne Schwindel und ich war einfach dankbar dafür, dass alles gut ging und ich mich wieder einmal besser fühlen durfte.
Ich hatte auch Angst, ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken, dabei liebte ich Bier und Wein oder selbstgemixten Erdbeermargarita. Aber ich wollte nicht herausfinden, wie sich der starke Schwindel und meine momentane Verfassung mit Alkohol vertrugen. Beim Alkohol war es ja immer so eine Ansichtssache, was gut, was viel und zu viel war. Ich trank gerne Alkohol, das war offensichtlich kein Geheimnis. Er schmeckte mir einfach. Im Frühling bemerkte ich jedoch, dass sich der Genuss von Alkohol für mich irgendwann veränderte. Wenn ich etwas Alkoholisches trank, hatte ich den Eindruck oder redete mir selbst ein, dass dies nun meine Entspannung war, dass es das Wenige war, was ich für mich tat und für niemanden sonst. Ich wusste natürlich da schon, dass etwas nicht mehr im Lot war. Es ging dabei nicht um die Menge. Ich ging stets verantwortlich damit um, schließlich wusste ich, dass ich jederzeit für meine Kinder da sein und auch nachts fit sein musste, wenn eines erwachen würde. Ich hatte also niemals zu viel getrunken. Jedoch hat sich die Sache an sich verändert, der Wert davon war auf einmal anders, und das war nicht gut. Es war mir bewusst, dennoch unternahm ich nichts dagegen, weil ich nicht die eine Sache aufgeben wollte, welche für mich in diesem Moment noch als kleiner Hoffnungsschimmer wirkte. Ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht darüber nachdenken, was die Ursache dafür hätte sein können. Vor allem hatte ich auch gar keine Zeit, mir in Ruhe diese Gedanken zu machen. Ich war vierundzwanzig Stunden am Funktionieren. Dabei blieben ohne zu übertreiben keine fünf Minuten, in denen ich mich hätte in Ruhe hinsetzen können, ohne dass ich dabei eine To-do Liste erstellte, etwas bestellen musste, etwas organisieren, Termine planen, Babybrei zubereiten, Wäsche machen oder sonst irgendetwas erledigen musste.
Natürlich, ich wollte Kinder. Das jedoch auch erst wirklich, als ich mit meinem Mann zusammen kam. Früher wollte ich weder heiraten noch Kinder, ich war sogar absolut dagegen. Ich wollte immer Karriere machen und die Welt bereisen. Ich durfte nämlich schon einiges von dieser Welt bestaunen, flog schon in einige Ecken dieses Planeten und lebte auch für längere Zeit in Australien, Italien, England, Schottland und Frankreich. Das Reisen, Unbekanntes und Neues entdecken, das fehlte mir sehr. Aus diesem Grund wollte ich auch unbedingt ein paar Tage ans Meer fahren. Mit einer Freundin oder auch alleine. Ich war daran, dies zu planen, doch nun traute ich es mir auf einmal nicht mehr zu. Ich konnte ja nicht mal mehr fünf Minuten Auto fahren oder alleine etwas einkaufen gehen. Die Angst davor, was alles hätte passieren können, schränkte mich auf übelste Weise ein. Meine Angst und Panik setzte somit Lebensweichen.
Als Lilly an Weihnachten 2017 zur Welt kam, war für mich sofort klar, dass ich mir irgendwann auch einmal ein Geschwisterchen für sie wünschte. Ich wollte demnach zwei Kinder und ich liebte sie über alles. Ich hätte alles für sie getan. Sie standen für mich immer an erster Stelle. Und das Allerwichtigste für mich war, dass es ihnen gut ging. Also musste ich da auch durch, egal, wie anstrengend es war, egal, wenn ich mich selber nicht mehr spürte und mich selber nicht mehr erkannte und nichts mehr für mich tat oder hatte. Ich wusste genau, dass mein Limit eigentlich erreicht war und, dass ich bald nicht mehr konnte. Und irgendwie wartete ich ständig auf den Moment, in dem etwas passierte, und darauf, dass ich diesen Augenblick erkannte und, dass es endlich vorbei sein würde und ich vom ganzen Druck und Stress erlöst war. In der Schwangerschaft mit Leon hatte ich auch große Verlustängste. Die Angst, dass Leon oder mir während der Geburt etwas passieren könnte, oder auch Lilly, während ich nicht bei ihr sein konnte, da ich bei der Geburt mit Leon war, war immer präsent. Zudem konnte ich mir noch nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn ich einige Tage nach der Geburt im Spital bleiben müsste und Lilly nicht bei mir war. Ich war auch schon vorher für ein paar Tage weg und somit von ihr getrennt gewesen, aber in dieser Zeit konnte ich mir keine Minute mehr ohne meine Tochter vorstellen. Vielleicht auch, weil ich wusste, dass ich, sobald Leon da war, nicht mehr so viel Zeit für sie alleine hätte. Ich war dieses Mal auch nicht gerne schwanger, im Gegensatz zur Schwangerschaft mit Lilly. In der zweiten Schwangerschaft störte mich der ganze Umstand am Schwangersein, der große Bauch, die Vorbereitung auf das zweite Kinderzimmer, die Formulare für den Mutterschaftsurlaub, einfach alles. Es gab Frauen, die diese Gefühle überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Aber ich wusste auch, dass es solche unter ihnen gab, die mir genau nachfühlen konnten. Aufgrund dieser Gedanken hatte ich natürlich große Schuldgefühle. Schließlich war mein kleiner Sohn in meinem Bauch, war gesund und boxte wild darin umher, und dennoch konnte ich nicht sagen, dass ich glücklich war. Wie sah meine Zukunft aus? Würde ich den Rest meines Lebens nur noch Mama sein? Es zerriss mich innerlich jeden Tag. Ich konnte es niemandem sagen und mir selbst nicht erklären. Ich fragte mich jeden Tag aufs Neue, ob dies nun mein Leben war, und ob es auch das Leben war, welches ich für mich wollte. Die Antwort schwankte immer zwischen ja, nein und ich weiß es nicht. Wie die vibrierende Nadel eines defekten Kompasses sich hin und her bewegt und nie stehen bleibt. Ich hatte alles, was man sich nur wünschen konnte. Einen Mann, der mich liebte, eine gesunde kleine Tochter, einen gesunden kleinen Sohn in meinem Bauch, eine Eigentumswohnung, einen tollen Job, viele Freunde und ich selber war auch gesund. Ich hatte wirklich alles. Ich wusste also nicht, was mir fehlte, was ich bräuchte, was ich wollte oder was nicht gut war. Wusste nicht, was der Grund dafür war, dass ich so empfand. Ich wusste nur, dass es so war. Die Schuldgefühle für diese Gedanken und Gefühle waren immens.
Gabriela, einer guten Freundin von mir, erzählte ich, dass es momentan schwierig für mich war. Sie hatte selber Erfahrungen mit Ängsten und ermutigte mich auch im Frühling dazu, eine Psychologin aufzusuchen. Ihre Mutter bot mir sogar an, mich manchmal zu begleiten, wenn ich die Kinder von der Krippe holen musste, und kümmerte sich auch das eine oder andere Mal um sie. Ich war sehr froh und dankbar für diese Hilfe. Ich fühlte mich natürlich schwach, weil ich diese Hilfe brauchte. Ich genoss die Gespräche mit ihr sehr, wir konnten bei uns im Garten viel lachen und uns auch über ihre Lebenserfahrungen mit ihren eigenen Kindern austauschen. Als es mir wieder einmal sehr schlecht ging, fuhr sie sogar die Strecke zur Krippe und wieder zurück und blieb auch bei uns, bis mein Mann abends zu Hause war. Gabriela wusste von einer Psychiatrischen Spitex, welche mir vielleicht helfen konnte. Im letzten Winter erlitt Gabriela einen persönlichen Schicksalsschlag und kämpfte zu dem damaligen Zeitpunkt noch immer damit. Ich konnte vielen Menschen nachfühlen, doch nie wirklich verstehen. Auf einmal sah das anders aus. Auf einem Spaziergang erzählte mir Gabriela, wie es ihr dabei ging, als sie Panik davor hatte, alleine einkaufen zu gehen oder alleine zu Hause zu sein. Sie hatte mir das auch früher schon erzählt, aber ich konnte es nie ganz verstehen. Jetzt konnte ich es. Ich konnte mich in ihren Erzählungen und Schilderungen wiederfinden. Und so erzählte sie mir von der Psychiatrischen Spitex. Im ersten Moment fand ich diese Idee völlig übertrieben und absolut nicht notwendig. Das alles würde sich wieder legen, dachte ich mir, und ich brauchte sicherlich keine solche Hilfe. Wie hätte sich denn das angehört? Ich brauchte doch keine Hilfe im Haushalt. Ich konnte staubsaugen, kochen, Windeln wechseln und putzen. Und wenn ich mir selber nicht erklären konnte, weshalb ich ständig erschöpft war und plötzlich Angst vor den unmöglichsten Dingen hatte, konnte mir auch niemand anders helfen. Dennoch vereinbarte ich einen ersten Termin mit dieser Stiftung, in diesem Moment mehr, um Gabriela einen Gefallen zu tun und mir hinterher nicht sagen zu müssen, hätte ich es doch wenigstens versucht. Ich war jedoch überzeugt, dass es nichts für mich war.
Im Nachhinein war ich natürlich froh, dass ich diesen Termin wahrgenommen hatte. Ich versuchte, meine aktuelle Situation zu beschreiben, und wir vereinbarten gleich zwei weitere Termine. Gemeinsam mit der Psychiatrischen Spitex konnte ich dann sogar die beiden Male den Weg in die Krippe fahren. Ich saß dabei auch selber hinter dem Steuer und es ging ohne Probleme, weil ich die Sicherheit hatte, dass, wenn es nicht ginge, jemand da war, der hätte übernehmen können. Das Ziel bei einer Psychiatrischen Spitex war nicht, dass sie für einen Sachen erledigten, sondern, dass sie alles gemeinsam mit einem machten und einen unterstützen und motivierten. Die Spitex riet mir, meinen Hausarzt aufzusuchen, der mir allenfalls ein Medikament verschreiben konnte. Bei mir schlugen bereits wieder die Alarmglocken, Medikamente! Ich wusste mittlerweile, dass ich Hilfe brauchte. Was ich mir noch viel mehr erhoffte, das war eine Erklärung für das Ganze.
Mein Vater kam vorbei und fuhr mich zum Hausarzt. Ich kannte diesen eigentlich kaum, hatte ihn damals nur aufgesucht, als ich von Zürich umgezogen war, damit ich im Notfall einen Arzt in der Nähe hätte. Denn wie schon erwähnt, ging ich nur ganz selten zum Arzt. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern, weil ich auch nicht musste, da ich zum Glück immer gesund war.
Auch hier versuchte ich wieder, alles zu erzählen. Langsam hatte ich das Gefühl, ich bildete mir mein ganzes Leben nur ein. Dass alles gar nicht war, wie es mir schien, und ich einfach nur weg müsste. Weit weg von diesem Leben und leider auch den Menschen um mich herum. So, dass einfach niemand unter meinen komischen Ängsten leiden müsste und mir auch niemand helfen müsste. Ich war im Moment auf tägliche Hilfe angewiesen, eine schlimme Tatsache für mich in dieser Zeit. Mein Hausarzt meinte, dass ich tatsächlich unter Panikattacken leiden könnte und, dass es Anzeichen für eine Postpartale Depression, umgangssprachlich auch oft als Postnatale Depression bezeichnet, gab. Ich war schockiert. Ich wusste, dass es diese Diagnose oder Krankheit gab und dass sehr viele Mütter darunter litten. Meine Tante hatte auch schon von dieser Krankheit gesprochen beziehungsweise angedeutet, dass sich bei mir Symptome dafür abzeichnen würden. Meine Tante arbeitet in einer leitenden Funktion in einem Spital und kennt sich damit sehr gut aus. Meiner Meinung nach musste man aber nicht immer gleich eine Diagnose stellen. Es war bestimmt nur eine strenge Zeit für mich, das war alles. Es war in diesem Moment also nur eine erste Diagnose. Wie sich später herausstellte, auch nicht die letzte und schon gar nicht die Enddiagnose.
Das alles jetzt von meinem Arzt zu hören zu bekommen, der mir so direkt gegenüber saß, war nicht sehr ermutigend. Der Hausarzt verschrieb mir etwas für die Magenschmerzen und das pflanzliche Lavendelölpräparat Laitea. Ich war froh, dass es etwas Pflanzliches war. Ob es mir auch in diesem Falle half, wusste ich nicht. Pflanzliche Sachen hatten durchaus Heilkräfte, das wusste ich. Es würde, wenn man es über längere Zeit abends einnahm, Ängste lindern und Sorgen mildern. Naja, wie aber sollte eine solche Kapsel, auch wenn sie mit Lavendel gefüllt sein mag, mir meine Ängste und Sorgen nehmen können? Etwas skeptisch war ich trotzdem. Wusste denn die Kapsel etwas über meine Sorgen? Wenn ja, durfte sie mich gerne endlich aufklären. Dennoch war es zumindest kein Antidepressivum, welches er mir als erstes vorgeschlagen hatte. Ich würde niemals Antidepressiva nehmen, wehrte ich mich sofort. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was Antidepressiva waren. Ich konnte mir nur die vielen Nebenwirkungen, welche er aufzählte, speichern. Und wie der Name schon verriet, irgendetwas, in dem das Wort depressiv oder Depression vorkommt, wollte ich auf keinen Fall nehmen.