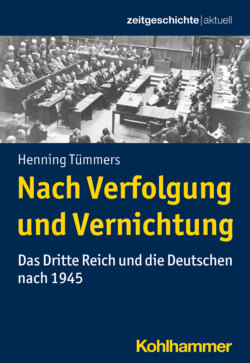Читать книгу Nach Verfolgung und Vernichtung - Henning Tümmers - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеDie Aktion dauerte vermutlich nur ein paar Minuten: Am 12. Mai 1945, die Kapitulation der deutschen Wehrmacht lag erst wenige Tage zurück, näherten sich in Trier drei Männer dem Hotel Monopol. Dort angekommen, bestieg einer von ihnen eine Holzleiter und begann, das an der Gebäudefassade befestigte Straßenschild mit der Aufschrift »Adolf-Hitler-Str.« zu entfernen. Kontrolliert wurde die Maßnahme von einem uniformierten Leutnant der US-Armee und einem Vertreter der amerikanischen Militärpolizei in Zivil. Nachdem der Arbeiter – allem Anschein nach ein Deutscher, der für diese Tätigkeit von den Alliierten verpflichtet worden war – die Schrauben gelöst hatte, legte er diese in Blech gestanzte Erinnerung an den »Führer« in die Hände des Polizisten.
Im Handumdrehen, so könnte man meinen, entledigte man sich unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der alten Römerstadt an der Mosel der jüngsten Vergangenheit. Ganz so einfach sollte es jedoch für die Deutschen, deren Staatsoberhaupt sich am 30. April in Berlin das Leben genommen hatte, sowohl im Frühjahr 1945 als auch in den Dekaden danach nicht werden. Zwar zeitigte diese damnatio memoriae Hitlers in Trier unmittelbar Wirkung: So residierte das an der Zufahrtsstraße zur Porta Nigra gelegene Hotel Monopol fortan wieder in der »Bahnhofstr.«; niemand würde es in Zukunft über eine nach dem Diktator benannte Zufahrt erreichen. Tatsächlich nahm die Auseinandersetzung der vormaligen »Volksgemeinschaft« mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen in Momenten wie diesen aber gerade erst ihren Anfang. Solche Szenen, die sich in den Tagen nach Kriegsende allerorts ereigneten, markierten den Beginn einer bis heute andauernden »zweiten Geschichte« (Reichel 2001, 9) der NS-Herrschaft, einer Geschichte der Deutschen nach der Verfolgung und Vernichtung eines Millionenheeres von »Gemeinschaftsfremden«.
Abb. 1: Austausch von Straßenschildern am Hotel Monopol in Trier unter Aufsicht des US-Offiziers Donald L. Berger (links), wenige Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945.
In ihr spielten, allerdings zu jeweils unterschiedlichen Zeiten, die nach 1933 verübten Verbrechen eine besondere Rolle, darunter die »Ausschaltung« politischer Gegner, die Ermordung von Sinti und Roma sowie geistig und körperlich Behinderter im Rahmen der »Euthanasie«-Aktion, die Verfolgung Homosexueller, »Asozialer« und weiterer Minderheiten, die Entfesselung eines »Angriffskrieges« und vor allem der industriell durchgeführte Massenmord an den Juden.
Wie zahlreiche Beispiele illustrieren, schreibt sich die »zweite Geschichte« des Dritten Reiches bis heute fort: Beispielsweise konstatierte Außenminister Heiko Maas im März 2018 in seiner Antrittsrede demonstrativ: »Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen.« Und auch Frank-Walter Steinmeier unterstrich drei Monate später den Stellenwert der nationalsozialistischen Verbrechen für die Identitätsfrage der Bundesrepublik im 21. Jahrhundert.
Anlässlich des Festakts »Zehn Jahre Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen« am 3. Juni 2018 in Berlin schlug der Bundespräsident einen Bogen zwischen dem Dritten Reich, der anschließenden westdeutschen Rechtsprechung und tagesaktuellen Themen. So gedachte er zwar hauptsächlich der aus sexuellen Gründen NS-Verfolgten und betonte die Notwendigkeit des Erinnerns an das ihnen widerfahrene Unrecht. Des Weiteren verurteilte er aber auch die Verfolgung von Homosexuellen nach 1949 durch bundesrepublikanische Organe, denn der Gesetzgeber hatte die Bestimmungen des »Schwulen-Paragrafen« 175 StGB, der Homosexualität unter Strafe stellte, erst 1969 geändert. Infolgedessen relativierte Steinmeier den Zäsurcharakter des Jahres 1945, indem er seinem Publikum die NS-Geschichte und ihre Nachgeschichte als miteinander verflochtene Zeiträume präsentierte. Der Nationalsozialismus diente dem Bundespräsidenten demnach zwar als Ausgangspunkt, jedoch nicht als Endpunkt für seinen kritischen Blick auf die jüngere deutsche Zeitgeschichte. Für Steinmeier spielte dementsprechend hierbei weniger eine Rolle, wen die Nationalsozialisten einst zum »Gegner« erklärt hatten und aus welchen Gründen. Vielmehr verwies er auf die Existenz einer universalen Menschenwürde, die nicht nur Hitler, sondern auch die ersten Kanzler der Bundesrepublik mit Füßen getreten hätten.
Gleichzeitig kritisierte Steinmeier, dass bestimmte Teile der deutschen Bevölkerung noch immer keine Lehren aus der menschenverachtenden Politik des NS-Staates gezogen hätten. Hierbei dachte er speziell an Anhänger des im 21. Jahrhundert spürbar aufkeimenden Rechtspopulismus. Vor allem ausgelöst durch die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 hatte in der Bundesrepublik die Alternative für Deutschland (AfD) Wähler und Wählerinnen von sich überzeugen können. Diese Partei erfreute sich sogar einer solchen Beliebtheit, dass ihr 2017 der Einzug in den Bundestag gelang; Historiker und Historikerinnen sprechen mit Blick auf diese Entwicklung beunruhigt von einer »Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik« (Frei/Maubach/Morina/Tändler 2019, 7).
Vor dem Hintergrund jüngster Provokationen aus ihren Reihen diente Steinmeier in Berlin das Dritte Reich als abschreckendes Beispiel, um die Bevölkerung an die Notwendigkeit von Zivilcourage und Demokratie zu erinnern. Konkret bezog sich der Bundespräsident auf eine Aussage des Parteichefs Alexander Gauland, der am 2. Juni 2018 erklärt hatte: »Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1 000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.« Dementsprechend erwiderte Steinmeier: »Wer heute den einzigartigen Bruch mit der Zivilisation leugnet, kleinredet oder relativiert, der verhöhnt nicht nur die Millionen Opfer, sondern der will ganz bewusst alte Wunden aufreißen und sät neuen Hass. Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen.«
Wer die Ereignisse aus den Jahren 1945 und 2018 miteinander vergleicht, wird zwei Dinge feststellen. Zum einen waren beide Ereignisse auf eine Demokratisierung und Werteerziehung der Deutschen ausgerichtet. Zum anderen demonstrieren Steinmeiers Ausführungen zugleich, dass sich die Qualität der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, genauer: die Perspektive auf das Dritte Reich, im Zeitraum von mehr als sieben Dekaden auffallend verändert hat.
Darum geht es in diesem Buch. Es analysiert den Umgang der Menschen in Ost- und Westdeutschland mit ihrer NS-Vergangenheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, indem es die Entwicklung der entsprechenden Diskussionen in Gesellschaft und Politik bis in die Gegenwart hinein nachzeichnet. Dieser Umgang war (und ist) ebenso kompliziert wie komplex, denn er betraf die Strafverfolgung einzelner Verbrechen, die Wiedergutmachung von NS-Unrecht, Formen des Gedenkens, Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen, zeithistorische Forschungen, kulturelle Verarbeitungen und Prozesse der Identitätsfindung – zunächst im geteilten, seit 1989/90 dann im vereinten Deutschland.