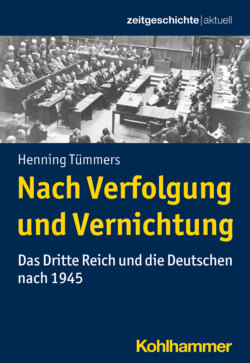Читать книгу Nach Verfolgung und Vernichtung - Henning Tümmers - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Thema, Thesen, Fragestellung und Begriffe
ОглавлениеVersuche, den Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland nach 1945 in einer kompakten Monografie wie dieser umfassend darzustellen, müssen zwangsläufig scheitern. Allein die Literatur für bestimmte Spezialthemen der Nachgeschichte des Nationalsozialismus ist mittlerweile stark angewachsen. Daher ist eine Schwerpunktsetzung nötig.
Bereits die eingangs zitierten Worte Frank-Walter Steinmeiers demonstrieren, dass das Dritte Reich vor allem aus einem Grund nicht in Vergessenheit gerät, nämlich wegen seiner Verbrechen. Dabei ragt der Holocaust aus der Masse an »rassisch« und politisch motivierten Gewalttaten deutlich heraus. Die vorliegende Arbeit folgt der Auffassung des Historikers Peter Longerich, der den Mord an den Juden als »das eigentlich historisch Besondere und Einzigartige an der NS-Diktatur« beziehungsweise als das »zentrale Thema der Geschichte des ›Dritten Reiches‹« (Longerich 1998, 17) betrachtet. Gleichwohl will sie sich nicht auf die postnationalsozialistische Auseinandersetzung mit dem Mord an den europäischen Juden beschränken, der seit den 1970er-Jahren auch als »Holocaust« (von griechisch »holókaustus«, übersetzt »völlig verbrannt«) bezeichnet wird. Im Zentrum steht die politische und gesellschaftliche Beschäftigung mit unterschiedlichen NS-Massenverbrechen im Verlauf der Jahrzehnte. Hierfür wurden paradigmatische Themen ausgewählt.
Die vorliegende, sich an eine interessierte Öffentlichkeit richtende Überblicksdarstellung thematisiert nicht nur den Umgang mit dem Dritten Reich in der Bundesrepublik. Aus guten Gründen wird die DDR in die Analyse mit einbezogen: Zum einen waren jene Gesellschaften, die seit 1949 getrennt voneinander lebten, zuvor im Dritten Reich gemeinsam sozialisiert und durch bestimmte Ideologeme geprägt worden. Ehemalige Nationalsozialisten fanden sich selbstverständlich auch in der DDR, wenngleich der »antifaschistische Arbeiter- und Bauernstaat« seit seinem ersten Atemzug erklärte, er stehe nicht in der Tradition des Deutschen Reichs, weshalb er auch mit den nationalsozialistischen Erblasten nichts zu schaffen habe. Demgegenüber verweisen rezente Studien auf frappierende Ähnlichkeiten im Umgang mit der NS-Vergangenheit in Ost und West. So konstatierte Katrin Hammerstein bezüglich des deutsch-deutschen Gedenkens an das Dritte Reich eine Entwicklung von einer »getrennten Erinnerung« zu einer »Gedächtnismélange« (2017, 488).
Zum anderen beeinflusste die Beobachtung des jeweiligen »Systemgegners« die Beschäftigung mit der Vergangenheit im eigenen Land. Da sich die Staaten beiderseits der Mauer jeweils selbst als die »bessere Antwort« auf »Hitler-Deutschland« verstanden, konkurrierten sie um den effizienteren Bewältigungsansatz. Die Nachgeschichte des Dritten Reichs in Deutschland muss somit als eine Geschichte von »Verflechtung und Abgrenzung« (Kleßmann 1993) geschrieben werden. Dabei zeigt sich: Gerade in der Gegenüberstellung von Bundesrepublik und DDR offenbaren sich in aller Deutlichkeit die langen Phasen der vergangenheitspolitischen Passivität Ostdeutschlands; in Sachen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geschah nur wenig.
Die zeithistorische Forschung hat sich vor allem seit den 1980er-Jahren dem Umgang mit dem Dritten Reich in Deutschland nach 1945 gewidmet, etwa den Nürnberger Prozessen oder den parlamentarischen Debatten über die NS-Vergangenheit im Bundestag (s. Weinke 2006; Dubiel 1999). Sie hat des Weiteren Studien zur deutsch-deutschen Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen vorgelegt (s. Herf 1998). Diese Arbeiten betrachten allerdings entweder nur einen begrenzten Zeitraum oder sie untersuchen bestimmte Ereignisse in lediglich einem der beiden deutschen Staaten.
Im Unterschied dazu umfasst die vorliegende Darstellung, die als Gesamtschau angelegt ist und den aktuellen Stand der Forschung repräsentiert, die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen über die gesamte Epoche der Zweistaatlichkeit hinweg und verlängert den Untersuchungszeitraum sogar bis in die »Berliner Republik« beziehungsweise in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts. Diese Analyse der Beschäftigung mit dem Dritten Reich in drei deutschen Staaten basiert auf Erkenntnissen anderer Historiker und Historikerinnen sowie auf eigenen Studien. Aufgrund der Konzeption der Reihe zeitgeschichte aktuell wird auf die bisherigen Forschungsergebnisse nur in aller Kürze verwiesen. Nichtsdestoweniger werden zumindest zentrale Werke und die Fundstellen der zitierten Texte angeführt.
Gleichwohl stellt dieses Buch, das in vier Kapiteln die vergangenheitspolitischen Entwicklungen in Deutschland nachzeichnet, mehr dar als lediglich ein Literaturbericht. Denn nicht nur die bereits erwähnte Zusammenschau von Ereignissen in der Bundesrepublik und der DDR ist über den hier angesetzten Untersuchungszeitraum innovativ. Durch die Gegenüberstellung von politischen, gesellschaftlichen und erstmalig auch kulturellen Umgangsformen mit dem NS-Unrecht – Peter Reichel hat jene künstlerisch-ästhetische Thematisierung als »erfundene Erinnerung« (Reichel, 2004, 13) bezeichnet – werden abweichende Bewertungen hinsichtlich der Qualität des Umgangs mit der NS-Vergangenheit offenbar, was wiederum zu anderen Periodisierungen führt. So schlägt dieses Buch im Gegensatz zu Arbeiten, die in engeren Abständen Wegmarken setzen und Wendepunkte konstatieren, im dritten Kapitel einen größeren Zeitbogen, der die 1960er- bis 1980er-Jahre umfasst. Zudem treten im Rahmen einer solchen Gesamtschau die Ungleichzeitigkeiten im Umgang mit den NS-Verbrechen deutlicher hervor.
Dabei lautet die Grundannahme dieser Studie, dass sich aus der Nachgeschichte des Dritten Reiches die Demokratisierungs- und Liberalisierungsfortschritte der ehemaligen »Volksgemeinschaft« nach 1945 ableiten lassen. Die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen dient insofern als Sonde, mit deren Hilfe die damaligen Aushandlungsprozesse bezüglich des Umgangs mit entrechteten Gruppen, Unrecht, Menschenbildern, Schuld und Moral besonders sichtbar werden. Aus der Vogelperspektive lassen sich dadurch die Prägekraft eines verbrecherischen politischen Systems ebenso wie soziale Wandlungsprozesse im zeitlichen Längsschnitt studieren. Diese Beschäftigung mit dem Dritten Reich verlief dabei keineswegs geradlinig und stellte für bestimmte Zeiträume alles andere als eine Erfolgsgeschichte dar. Was sie beeinflusste, waren maßgeblich vier Faktoren:
1. die »volksgemeinschaftliche« Sozialisation der Deutschen, die sich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch tradierte Denkmuster und Feindbilder auszeichnete;
2. der Anschluss an »westliche« beziehungsweise »östliche« Wertsysteme und Staatsformen;
3. die Teilung Deutschlands, die zu dem bereits erwähnten Systemwettstreit führte;
4. die Betonung grundlegender Menschenrechte gegen Ende des 20. Jahrhunderts.
Zu diesem Zeitpunkt, so eine weitere Annahme, begann sich die politische Aussprache über den »Führerstaat« durch eine neue Qualität auszuzeichnen. Während sich die wissenschaftliche Forschung kontinuierlich der Aufklärung verpflichtet fühlte, begann der inhaltliche Diskurs über die NS-Zeit in der Öffentlichkeit zu verflachen; konkrete historische Ereignisse oder Taten besaßen immer weniger Bedeutung. Genau genommen ist es deshalb falsch, die Gegenwart nur einer NS-Geschichte zu postulieren. Wer genau hinsieht, erkennt vielmehr unterschiedliche Geschichten, die heutzutage parallel zueinander aus unterschiedlichen Motiven erzählt werden.
Im Mittelpunkt dieses Buchs stehen folgende Fragen: Wer waren die Träger der Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht im 20. und 21. Jahrhundert und was waren ihre Motive? Welche Themen wurden wann angesprochen? Auf welchen gesellschaftlichen Ordnungsentwürfen basierte die Beschäftigung mit den NS-Verbrechen? Wie hat sich die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich über die Jahrzehnte hinweg verändert und welche Faktoren waren dafür verantwortlich? Wie unterschieden sich die Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik und der DDR, welche Gemeinsamkeiten wiesen sie auf, und wie prägte der Mauerfall den Umgang mit der NS-Zeit?
In den Antworten, die dieses Buch gibt, finden sich unterschiedliche Begriffe, die sich in der Historiografie zur Nachgeschichte des Dritten Reiches etabliert haben. Zu den gängigsten zählen »Vergangenheitsbewältigung« beziehungsweise »Vergangenheitsaufarbeitung«, »Geschichts-« und »Erinnerungspolitik« sowie »Vergangenheitspolitik«.
»Vergangenheitsbewältigung« und »Vergangenheitsaufarbeitung« stellen ursprünglich Termini der Zeitgenossen dar. Bereits in den 1950er-Jahren wurden sie in Westdeutschland von Intellektuellen wie Theodor W. Adorno genutzt, zumeist jedoch negativ konnotiert: Wer von »Aufarbeitung der Vergangenheit« spreche, so Adorno, wolle einen Schlussstrich ziehen und das Dritte Reich aus der Erinnerung »wegwischen« (Adorno 1971, 125). Des Weiteren fiel das Wort Vergangenheitsbewältigung – nun allerdings mit dem Adjektiv »unzureichende« versehen – immer dann, wenn Kritiker die Defizite der alliierten Entnazifizierung lautstark anprangerten. Sie störten sich auch an der appellativen, moralisch-pädagogischen Aufladung dieses Schlagworts und bemerkten, dass es sich allein auf jene Generationen beziehen könne, die den Nationalsozialismus miterlebt hätten; eine Entkoppelung von diesen Personenkreisen schließe sich per definitionem aus. Überhaupt, so ein weiterer Einwand, sei unklar, wann das Ziel dieser »Bewältigung« erreicht sei: Der Umgang mit Vergangenheit im Allgemeinen und der nationalsozialistischen im Besonderen müsse als infiniter Prozess begriffen werden.
Erst in den 1990er-Jahren erfuhr der Begriff eine Definitionserweiterung. Diese – zitiert wird an dieser Stelle Helmut König (1998, 375) – erinnert an jene, die man mit dem Forschungsschwerpunkt »Transitional Justice« verbindet:
»Unter Vergangenheitsbewältigung ist die Gesamtheit jener Handlungen und jenes Wissens zu verstehen, mit der sich die jeweiligen neuen demokratischen Systeme zu ihren nichtdemokratischen Vorgängerstaaten verhalten. Es geht dabei vor allem um die Frage, wie die neu etablierten Demokratien mit den strukturellen, personellen und mentalen Hinterlassenschaften ihrer Vorgängerstaaten umgehen und wie sie sich in ihrer Selbstdefinition und in ihrer politischen Kultur zu ihrer jeweiligen belastenden Geschichte stellen.«
Demgegenüber ist »Geschichtspolitik« ein Begriff, der in Deutschland erstmals im Rahmen des »Historikerstreits« Ende der 1980er-Jahre aufkam und der inzwischen eng an das Konzept der »Erinnerungskultur« gekoppelt ist. Ursprünglich negativ aufgeladen, verstanden als eine politisch-ideologisch instrumentalisierte Arbeit verschiedener Akteure wie Regierenden, Historikern und Historikerinnen sowie Publizisten und Publizistinnen an Geschichte, hat sich »Geschichtspolitik« seit Edgar Wolfrums gleichnamiger Habilitationsschrift zu einer Forschungsperspektive entwickelt. Dem Zeithistoriker zufolge ist sie differenzierter zu fassen, als
»ein Handlungs- und Politikfeld, auf dem verschiedene Akteure Geschichte mit ihren spezifischen Interessen befrachten und politisch zu nutzen suchen. Sie zielt auf Öffentlichkeit und trachtet nach legitimierenden, mobilisierenden, polarisierenden, skandalisierenden, diffamierenden u. a. Wirkungen in der politischen Auseinandersetzung« (Wolfrum 1999, 24 f.).
Peter Reichel (1995) führte überdies den Terminus »Erinnerungspolitik« ein, der auf den Bereich der politischen und kulturellen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit (Errichtung von Museen, Gedenkstätten usw.) rekurriert.
Die größte Diskursmacht scheint jedoch der Ausdruck »Vergangenheitspolitik« zu besitzen. Im Gegensatz zu den konkurrierenden Termini ist dieser von Norbert Frei geprägte Neologismus kein Quellen-, sondern ein Analysebegriff. »Vergangenheitspolitik« bezieht sich auf die Jahre zwischen 1949 und 1955 und bezeichnet »einen politischen Prozeß, der […] durch hohe gesellschaftliche Akzeptanz gekennzeichnet war, ja geradezu kollektiv erwartet wurde« (Frei 1996, 13 f.). Gemeint ist damit die soziale und berufliche Integration ehemaliger NSDAP-Mitglieder in die junge Bundesrepublik in Verbindung mit der Aufhebung von Haftstrafen, die unmittelbar nach 1945 verhängt worden waren.
»Vergangenheitspolitik« steht in seiner ursprünglichen Bedeutung für die »Geschichte der Bewältigung der frühen NS-Bewältigung« (Frei 1996, 13). Inzwischen, das belegen zahlreiche Buchtitel, erfährt »Vergangenheitspolitik« als Interpretament sowohl eine zeitliche als auch thematische Ausdehnung: Der Begriff wird als Synonym für den Umgang mit der NS-Vergangenheit schlechthin verwendet. In beiden Lesarten – sowohl seiner ursprünglichen Version als auch seiner erweiterten – findet er auch in dieser Darstellung Verwendung.