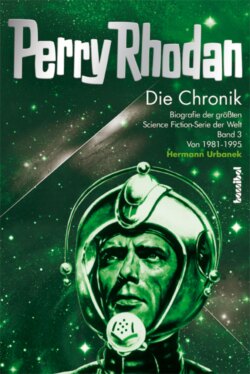Читать книгу Die Perry Rhodan Chronik, Band 3 - Hermann Urbanek - Страница 5
ОглавлениеPERRY RHODAN – Eine Bestandsaufnahme
Das Erscheinen von PERRY RHODAN-Band 1000 im Herbst 1980 war ein weiterer Höhepunkt in der in der an Höhepunkten nicht gerade armen Geschichte der größten SF-Serie der Welt gewesen. Zu diesem Anlass hatte der Verlag auch eine Pressemappe herausgegeben, der die Journalisten über Eckpunkte, die Geschichte, den Handlungsverlauf, die Autoren, die Verteilung der Aufgabenbereiche und die Zielsetzungen von PERRY RHODAN informierte und die zeigte, welche Erfolge die Serie national und international bislang hatte feiern können und wie der gegenwärtige Status war. Besonders, was die Lizenzausgaben betraf, stand PERRY RHODAN im Zenit seiner bisherigen Existenz.
Pressetext des Verlages
PERRY RHODAN ist die größte Science-Fiction-Romanserie der Welt.
PERRY RHODAN ist eine deutsche Serie.
-
PERRY RHODAN erscheint wöchentlich mit einem neuen Roman, einem Roman in der 2. Auflage, einem Roman in der 3. Auflage und in der 4. Auflage.
Jeden Monat dazu ein Taschenbuch in 1., 2. und in 3. Auflage
-
PERRY-RHODAN-BUCHAUSGABE: erscheint dreimal im Jahr am 15.3., 15.5., 15.9.
Preis: DM 19,890 (ca. 416 Seiten)
-
PERRY-RHODAN-MAGAZIN – Größte SF-Zeitschrift Europas: erscheint monatlich.
Preis: DM 3,50
-
Wöchentliche Auflage aller PERRY-RHODAN-Objekte zurzeit 500.000 Exemplare
-
Gesamtauflage aller PERRY-RHODAN-Erscheinungen in deutscher Sprache bei über 1300 Titeln bisher über 550 Millionen
-
Verkaufspreise: jeder Roman DM 1,80
Jedes Taschenbuch DM 4,80
-
Lizenzausgaben:; Französisch bei Fleuve Noir, Paris; Amerikanisch bei Master-Publications, New York; Japanisch bei Hayakawa, Tokio; Portugiesisch bei Ediçôes de Ouro, Rio de Janeiro; Holländisch bei Verlag Born, Amsterdam; Italienisch bei Verlag La Diffusione Nazionale, Rho bei Mailand.
-
PERRY RHODAN ist verfilmt: »Perry Rhodan – SOS aus dem Weltall« (deutscher Verleih: Constantin-Film).
-
Überall in der Welt, wo Perry Rhodan gelesen wird, haben sich PERRY-RHODAN-Fanclubs gegründet. Allein in Deutschland gibt es über 500 solcher Clubs (PRCs). Die Kontaktadresse für Clubinteressenten ist das Zentralsekretariat der PERRY-RHODAN-Clubs, Karlsruher Straße 31, 7550 Rastatt.
PERRY RHODAN ist eine Serie des MOEWIG-Verlages, München, Vertrieb: Erich Pabel Verlag KG, 7550 Rastatt
Da mit Band 1000 der 16. Zyklus DIE KOSMISCHE HANSE eingeleitet wurde, gab es in dem Pressetext nicht nur Kurzzusammenfassungen der zuvor erschienenen Zyklen, sondern auch eine kurze Einführung in die aktuell geplante Handlung:
Im Auftrag von ES, dem geistigen Mentor der Menschheit, hat Perry Rhodan im Jahr 3587 die Kosmische Hanse gegründet, um ES gegen die rivalisierende Superintelligenz Seth-Apophis zu unterstützen. Über vierhundert Jahre nach der Gründung dieser Organisation droht ein Zusammenprall der Völker aus dem Bereich der beiden Mächtigkeitsballungen der Superintelligenzen. Perry Rhodan, der das Geheimnis der Materiequellen kennt und den Status eines »Ritters der Tiefe« erlangt hat, handelt im Sinne der geheimnisvollen Kosmokraten, als er bei der Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung mithilft. Die Legende um das geheimnisvolle »Viren-Imperium« lässt die kosmischen Entwicklungen in einem noch dramatischeren Licht erscheinen. Während die Menschheit um einen weiteren Ausbau der Kosmischen Hanse bemüht ist, kommt es in einem anderen Bereich unseres Universums zu unerwarteten Entwicklungen. Ein neues Sternenreich, das Herzogtum von Krandhor, breitet sich mit atemberaubender Geschwindigkeit aus. Die Kranen, die dieses Imperium aufbauen, werden dabei von einem mysteriösen Orakel unterstützt. Drei Nachkommen von Raumfahrern, die einst an Bord von Perry Rhodans Fernraumschiff SOL lebten, geraten in den Strudel der Ereignisse um das Herzogtum von Krandhor. Sie erleben die Wirkung der seltsamen Spoodies, die Kraft und Intelligenz verleihen und die in ihrer Symbiontentätigkeit tief in die Ereignisse verstrickt sind. Die Zusammenhänge enthüllen sich den Menschen in beiden Regionen immer mehr, und sie erkennen, dass der Fortbestand des Lebens von der Beantwortung der drei Ultimaten Fragen abhängt, die von den Kosmokraten gestellt wurden.
Ebenfalls in diese Richtung, aber mit einigen anderen Akzenten ging die Information von Frank Borsch zum Erscheinen von Band 1000 und dem Start des neuen Zyklus, die den Abonnenten der 5. Auflage anlässlich des Jubiläums mit auf den Weg gegeben wurde.
Kaum eine Zahl hat in den ersten beiden Jahrzehnten der PERRY RHODAN-Serie die Gemüter von Lesern und Autoren derart bewegt wie die Tausend. Eintausend Hefte PERRY RHODAN – das schien den meisten von ihnen ein ferner, unmöglicher Traum. Keine andere Science Fiction-Serie hatte sich bis dahin der magischen Tausender-Grenze auch nur entfernt angenähert. Konnte es gelingen, fragten sie sich, die Zukunftsgeschichte der Menschheit weiter zu neuen Ufern zu führen? Die Leser mit noch ungeheuerlicheren kosmischen Rätseln, noch spannenderen Abenteuern zu fesseln? Die faszinierende Komplexität des PERRY RHODAN-Universums fortzuschreiben und gleichzeitig neuen Lesern zugänglich zu machen?
Es konnte.
William Voltz, der langjährige Exposé-Autor der Serie, nahm die Herausforderung an und bestand sie mit Bravour. Der aus seiner Feder kommende Band Eintausend übertraf die ohnehin hochgesteckten Erwartungen der Leser. Mit »Der Terraner« setzte er Perry Rhodan ein Denkmal und schuf einen Klassiker der Science Fiction: Selten ist der »Sense of Wonder«, der Hauch ferner, exotischer Welten und kosmischer Zusammenhänge, greifbarer als in seinem Roman.
Und Voltz gelang ein zweites Kunststück: der Brückenschlag in eine neue Ära. Im neuen Zyklus »Die Kosmische Hanse« tritt an die Seite der kosmischen Rätsel, des Ringens der Kosmokraten und Chaotarchen, das Abenteuer, die Lust daran, sich kopfüber in unser unendlich vielfältiges Universum zu stürzen.
Folgen Sie uns, lieber Leser, liebe Leserin.
Folgen Sie Perry Rhodan in den fernen Dom Kedschan, in dem er die Weihe zum Ritter der Tiefe erhalten wird. Folgen Sie drei jungen Terranern in die Rekrutenschulen und Flottenstützpunkte des Herzogtums Krandhor. Folgen Sie dem Haluter Icho Tolot zu einem geheimnisvollen, zwei Millionen Jahre alten Artefakt am Rande der Milchstraße – und erfahren Sie die drei Kosmischen Fragen, von deren Beantwortung das Schicksal des Universums abhängt.
Die Verantwortlichkeiten für PERRY RHODAN und alle Nebenprodukte waren laut Pressemappe vom Herbst 1980 auf folgende Mitglieder des Redaktionsstabes aufgeteilt:
• Cheflektor und Redaktion München: Kurt Bernhardt
• Lektorat und Redaktion: G. M. Schelwokat
• Redaktion TBs: G. M. Schelwokat
• Exposéredaktion: William Voltz
• PR-Bücher: William Voltz
• PERRY RHODAN-Magazin: Helmut Gabriel
• PERRY RHODAN-Report: K. Bernhardt, J. Bulla, Walter A. Fuchs, W. Voltz
• Leserbriefredaktion: William Voltz
• Titelbilder: Johnny Bruck
• Innenillustrationen: J. Bruck u. T. Kannelakis
• Risszeichnungsredaktion: W. Voltz
Abschließend gelangte die Pressemappe zu folgendem Resümee:
Niemand, der sich Gedanken über die Entwicklung der Menschheit in den vergangenen einhundert Jahren – eine winzige Zeitspanne in kosmischer Sicht – macht, wundert sich über den Erfolg der Science-Fiction-Literatur im Allgemeinen und PERRY RHODAN im Besonderen. Tag für Tag erreichen uns neue, sensationelle physikalische Forschungsergebnisse. Wissenschaft und Technik verändern das Weltbild mit atemberaubender Geschwindigkeit. Dieses stürmische Vorwärtsdrängen der Menschheit kann ins Verderben, aber auch in eine phantastische Zukunft führen. Der Mensch ist dazu gezwungen, sein Bewusstsein für kosmische Maßstäbe einzurichten, er kann sich nicht länger isoliert und einzigartig sehen.
Was wäre besser dazu geeignet, alle Aspekte einer möglichen Zukunft abzustecken, als die PERRY-RHODAN-Serie? Sie macht es ihren Lesern leichter, die realen Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung zu verarbeiten, in unterhaltsamer und romanhafter Form.
Allen Beteiligten an diesem einmaligen Projekt PERRY RHODAN schwebte von Anfang an vor, eine Serie zu schaffen, die eine mögliche Entwicklung der Menschheit in der fernen Zukunft aufzeigt und die gleichzeitig unterhalten soll. Sie sollte der heute noch weit verbreiteten kleinlichen Denkweise ein humanitäres astropolitisches Menschheitsmodell entgegensetzen. Bei PERRY RHODAN gibt es keine Diskriminierung Andersgearteter. Eine völlige Glaubensfreiheit ist selbstverständlich, und jede Art von Diktatur wird abgelehnt.
PERRY RHODAN ist die Vision einer besseren Welt, die Vision von der kosmischen Bestimmung des Menschen.
Begleiten Sie PERRY RHODAN und seine Freunde auf ihren Reisen und bei ihren Abenteuern in Raum und Zeit.
Erleben Sie die Zukunft – heute!
Die Liste der Verantwortlichen für die ganze Bandbreite des Phänomens PERRY RHODAN hatte aber nur kurzfristig uneingeschränkte Gültigkeit, denn nach dem PERRY RHODAN-WeltCon wurde Helmut Gabriel als Chefredakteur des Magazins gekündigt. Die letzte Ausgabe des Jahres 1980 wurde wieder interimsmäßig von Walter A. Fuchs herausgegeben, der das bereits vorliegende Material zu einem interessanten Journal zusammenfasste. Wieder einmal musste ein neuer Chefredakteur für das PERRY RHODAN MAGAZIN gefunden werden, und die Wahl fiel auf Hans-Jürgen Frederichs, der mit der Herausgabe des unter seiner Regie professionell erschienenen Magazin ANDROMEDA des »Science Fiction Club Deutschland e.V.« schon erste Erfahrungen in diesem Metier gesammelt hatte.
Ein nicht realisiertes Handlungskonzept
Band 1000, dessen Erscheinen mit dem ersten PERRY RHODAN WeltCon in Mannheim gefeiert worden war, ist zweifellos ein Meilenstein der großen deutschen SF-Serie. Doch die Idee dazu ist, wie bei vielen literarischen Projekten, langsam entstanden, wobei andere Handlungskonzepte, die ebenfalls die Serie auf interessante Weise weiterentwickelt hätten, verworfen wurden.
Ein sehr spannendes verfasste William Voltz am 26. und 27. Juni, in dem er, weit vorausplanend, wie er nun einmal war, nicht nur das Konzept der laufenden Handlung bis Band 999, sondern weit darüber hinaus entwarf – und das mit dem, was dann tatsächlich offizielle PERRY RHODAN-Historie wurde, immer weniger gemein hatte, je weiter es sich vom Ausgangspunkt entfernte.
Essay: PERRY RHODAN
1. Teil – Konzeption der Bände Nr. 850 – Nr. 999
2. Teil – Handlungsabriss der Bände Nr. 1000 – ca. 1200
Von William Voltz
1.Teil – Konzeption der Bände Nr. 850 – 999
a) Handlungsarm Perry Rhodan
Perry Rhodan befindet sich in Gefangenschaft von BULLOC, der vierten Inkarnation der Superintelligenz BARDIOC. Nach einer sechs Monate währenden Reise in der Energiesphäre BULLOCs kommt Perry Rhodan auf der Heimatwelt BARDIOCs an.
Perry Rhodan ist seelisch und körperlich erschöpft. Er verlässt die Sphäre und findet eine phantastische Welt vor. Es wimmelt von raumfahrenden Fremdintelligenzen, in erster Linie Hulkoos, die einzig und allein damit beschäftigt sind, eine planetenumspannende gehirnähnliche Wucherung zu pflegen und zu betreuen: BARDIOC!
Rhodan beobachtet, dass auf bestimmten Bäumen gehirnähnliche Ableger regelrecht abgeerntet und an Bord von Hulkoo-Schiffen gebracht werden. Das sind die Kleinen Majestäten, die von den Hulkoos auf andere Planeten gebracht werden, so dass sie dort mit ihren hypnosuggestiven Impulsen die einheimischen Zivilisationen unterjochen und in den Dienst BARDIOCs stellen.
Von BULLOC erfährt Rhodan die Geschichte BARDIOCs, die für die Weiterentwicklung der Serie von großer Bedeutung ist:
In ferner Vergangenheit kamen sieben Fremde in unseren Bereich des Universums. Sie erschienen im Auftrag einer auch ihnen unbekannten Macht. Jeder dieser sieben Fremden besaß ein unvorstellbar großes und wunderbares Raumschiff, das mit Lebenssporen beladen war. Der Auftrag der Fremden bestand darin, die Sporen an Bord des Schiffes in unbelebte Gebiete der Galaxien zu bringen und auf diese Weise für die Verbreitung von Leben zu sorgen.
Einer der sieben Fremden war Bardioc. Er lehnte sich gegen die sechs anderen auf, um sich einen eigenen Machtbereich zu schaffen, So versteckte er sein Sporenschiff, die PAN-THAU-RA (später wird daraus PANDORA werden).
Indessen lief die Stufe zwei im Entwicklungsplan der Fremden an. Sie schufen den Sternenschwarm (Perry Rhodan Nr. 500 – 569), der auf einer langen Reise durch die Galaxien Intelligenz unter den gerade entstehenden Lebensformen verbreiten sollte.
Wieder griff Bardioc negativ ein. Er sorgte dafür, dass der Schwarm in die Hände krimineller Mächte geriet und umgepolt wurde.
Nun verbreitete der Schwarm mit Hilfe seiner Emotio-Strahlung Dummheit in den Galaxien.
Die sechs Fremden erkannten Bardiocs Verrat. Sie beschlossen, ihn zu bestrafen. Sein Gehirn wurde lokalisiert und auf einen fernen Planeten verbannt. Es wurde in einem Lebenserhaltungssystem aufbewahrt.
Die pervertierten Zellen von Bardiocs Gehirn entwickelten jedoch eine Säure, die den Behälter zerfraß. So konnte das Gehirn ins Freie gelangen, wo es eine Symbiose mit der Natur des Planeten einging. Zuerst vereinigte es sich mit ein paar Pflanzen, dann wuchs es und wucherte, bis es immer größer wurde und die Symbiose auf den gesamten Planeten ausdehnen konnte.
So wurde Bardioc zu der Superintelligenz BARDIOC.
Mit Hilfe seiner PSI-Strahlung lockte er eines Tages erste Hulkoo-Schiffe auf seinen Planeten und so begann die Ausdehnung seiner Mächtigkeitsballung. Bei seiner Expansion stieß er schließlich an die Grenzen des Machtbereichs einer anderen Superintelligenz: der Kaiserin von Therm.
Perry Rhodan ist unterdessen ein Verbündeter der Kaiserin von Therm geworden.
Lange Zeit trug er ihren Kristall. Sein einziges erklärtes Ziel ist es jedoch, den Ausbruch eines totalen Konflikts zwischen beiden Superintelligenzen zu verhindern.
Kurze Zeit, nachdem er auf BARDIOCs Welt ist, machte Perry Rhodan die Feststellung, dass dieses seltsame Wesen schläft. Es schläft und erleidet Albträume. So ist es im Grunde genommen für sein Tun nicht verantwortlich zu machen.
Alles, was BARDIOC tut, ist ein Produkt seiner Albträume. Rhodan erkennt, dass BULLOC sich gegen BARDIOC auflehnen und ihn töten will. BULLOC ist durch und durch bösartig, ihn wird Rhodan kaum besiegen können.
Rhodan weiß, dass es nur eine Rettung gibt: BARDIOC muss aufgeweckt werden, bevor BULLOC die zentrale Stelle des Planetenhirns findet und abtötet.
Gleichzeitig aber erkennt BULLOC, dass Rhodan seinen Plan durchschaut hat, und macht Jagd auf ihn.
Rhodan muss sich in die Symbiose von BARDIOC integrieren, um BULLOC zu entkommen und BARDIOC aufzuwecken.
Rhodan schläft in der Symbiose ein und wird zu einer neuen Traumfigur für BARDIOC.
Rhodan erscheint BARDIOC »im Schlaf«. Auf diese Weise kann er ihn tatsächlich aufwecken. BARDIOC erwacht und begreift, was er alles angerichtet hat.
Zunächst einmal wird BULLOC ausgeschaltet, dann erklärt BARDIOC sich bereit, Rhodans Friedensbemühungen zu unterstützen. An Bord der SOL, die inzwischen angekommen ist, und an Bord von zahlreichen Schiffen der Hulkoos wird Gehirnmasse BARDIOCs geladen und zur Kaiserin von Therm gebracht.
Dort gelingt es Rhodan, die beiden Superintelligenzen zu einem Experiment zu überreden, das letztlich gelingt: Die Kaiserin von Therm, dieser Kristallplanet, geht eine Symbiose mit BARDIOC ein. Durch die Vereinigung der beiden Superintelligenzen ist der Frieden zwischen beiden gewährt …
Doch der ruhelose Rhodan hat schon wieder anderes im Sinn. Von BARDIOC kennt er die Koordinaten des versteckten Sporenschiffs PAN-THAU-RA. Er fliegt mit der SOL in dieses Gebiet, dort wird er eine doppelte Überraschung erleben (siehe weiter unten).
b) Handlungsarm Fernraumschiff SOL
Die Zahl der an Bord des Riesenschiffs Geborenen nimmt ständig zu, die der Terrageborenen ständig ab, so dass es nur normal ist, dass die Solgeborenen, die das Schiff als ihre Heimat ansehen, es auch als ihren alleinigen Besitz betrachten.
Hinzu kommt, dass ein Mann namens Gavro Yaal den Solgeborenen eine Idee suggeriert, die diese Menschen nur allzu gerne annehmen: Wenn wir, sagt Yaal, zwei Superintelligenzen befriedet haben, müssen wir selbst auf der nächsten Stufe der Entwicklung stehen!
Und wer als die Solgeborenen könnte die menschliche Superintelligenz sein?
Diese Wahnsinnsidee findet immer mehr Anhänger.
Als schließlich die PAN-THAU-RA gefunden wird, sehen Yaal und sein Gefolge dies als nur natürlich an und beschließen, die SOL als Beiboot in die riesige PAN-THAU-RA zu bringen. Fortan soll die PAN-THAU-RA ein standesgemäßer Sitz für die Solgeborenen sein, Natürlich sind damit weder Rhodan noch die Mitglieder der Expedition (siehe weiter unten) einverstanden.
Nun kommt Yaal auf die Idee, das gigantische Sporenschiff einfach zu entführen …
c) Handlungsarm Terra
Nachdem die Erde wieder im Solsystem steht, sind die Menschen bemüht, die Lage zu stabilisieren. Sammlerschiffe sind unterwegs, um die in der Galaxis verstreuten Menschen zu suchen und heimzuholen (siehe Handlungsarm e) Sammlerschiffe).
Auf der Erde beginnt eine neue politische Ära. Die LFT (Liga Freier Terraner) wird langsam geschaffen. Ihr steht ein Erster Terraner vor, der uns wohlbekannte Zellaktivatorträger Julian Tifflor. In seiner Regierung befinden sich die Terranischen Räte, die je nach ihren Ressorts z.B. »Terranischer Rat für Wissenschaften« usw. genannt werden.
Eine schnelle Konsolidierung ist notwendig, denn die in der GAVÖK vereinigten Fremdvölker schielen bereits wieder misstrauisch und streitbereit auf die Erde.
Lediglich die von den Terranern hochgespielte Gefahr der Molekülverformer hält einzelne GAVÖK-Völker davon ab, die Koalition bereits jetzt zu verlassen. Die Terraner gehen also daran, die Molekülverformer zu hegen und zu pflegen.
Trotzdem kommt es immer wieder zu Zwischenfällen im Weltraum und auf anderen Welten.
Unterdessen arbeitet auf der Erde eine neue Generation von Wissenschaftlern. Eine Gruppe von Archäologen stößt bei Ausgrabungen auf Kreta auf eine prä-minoische Kultur. Auf Schriften ist von einem geheimnisvollen Behälter die Rede, der PAN-THAU-RA genannt wird und Schrecken und Verderben brachte!
Natürlich sind sofort Assoziationen PAN-THAU-RA und der geheimnisvollen Büchse der PANDORA möglich.
Niemand auf der Erde weiß, dass ein paar Mutanten im NEI entstanden sind, die sich versteckt gehalten haben.
Drei von ihnen sind anständig, der vierte jedoch, Margor, träumt davon, einmal die Macht in der Galaxis innezuhaben.
Margor erkennt, was die neuen Wissenschaftler für ihn wert sein können.
Vor allem der uns bereits bekannte Payne Hamiller. Margor erkennt, dass er die für ihn typische PSI-Affinität zu Hamiller hat, und macht sich an ihn heran. Er beeinflusst Hamiller, dass dieser sich zum »Terranischen Rat für Wissenschaften« wählen lässt. Hamiller füllt dieses Amt aus, ohne zu ahnen, dass er insgeheim von Margor benutzt wird.
Indessen versuchen die drei positiven Mutanten etwas gegen Margor zu unternehmen. Margor, Sohn einer Gäanerin und eines Vincraners, der in der Dunkelwolke aufwuchs, ist jedoch allen überlegen – zumal die Altmutanten mit der Expedition unterwegs sind (siehe weiter unten).
So wächst Margors Macht zusehends, ohne dass jemand offiziell etwas davon ahnt.
Irgendwann jedoch, am Tage X, wird Margor zuschlagen …
d) Handlungsarm Expedition
Kershyll Vanne, das Konzept mit den sieben menschlichen Bewusstseinen, wird zu ES gerufen. ES erklärt, dass es einen entscheidenden Auftrag für die Terraner habe.
Ein sogenanntes Lebensschiff sei in ferner Vergangenheit zweckentfremdet eingesetzt worden und müsse nun gerettet werden. Wieder fällt der rätselhafte Name PAN-THAU-RA.
ES verlangt, dass die Terraner eine große Expedition ausrüsten, um das Lebensschiff zu suchen und seinem ursprünglichen Zweck zuzuführen.
Als Vanne nach Terra zurückkommt, zögert man mit dem Entsenden der Expedition, schließlich hat man noch genügend eigene Sorgen und Probleme. Tifflor jedoch weiß, dass man ES beachten muss, so wird die Expedition schließlich durchgeführt. An Bord des Raumschiffes gehen auch die Altmutanten.
Die Schiffe brechen auf und fliegen zu dem von ES angegebenen Koordinatenpunkt. Da merkt man, dass etwas nicht stimmen kann, denn von dem Lebensschiff findet man keine Spur.
Die Suche beginnt, und dabei stößt man auf ein großes raumfahrendes Volk.
Alles deutet darauf hin, dass dieses Volk die PAN-THAU-RA längst gefunden und für seine Zwecke eingesetzt hat. Die Menschen stoßen auf ablehnende Antworten – die Fremden wollen ihr Geheimnis nicht preisgeben.
So muss man, ständig bedroht und verfolgt von diesen Fremden, sich selbst auf die Suche machen.
Als die Expedition das Lebensschiff schließlich findet, muss man erkennen, dass es tatsächlich zweckentfremdet benutzt wurde. Die Aufgabe der Menschen soll es sein, allen entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Ausgerechnet bei der PAN-THAU-RA trifft man einen, den man für tot oder für alle Zeiten verschollen geglaubt hat: Perry Rhodan und die SOL! Gemeinsam macht man sich an die Arbeit, wobei es zu den unter Handlungsarm SOL geschilderten Problemen kommt.
Schließlich entdeckt man, dass die PANDORA, wie sie genannt wird, die Geschichte vieler Völker und Zivilisationen beeinflusst hat. Dieses mächtige Schiff ist in jeder Beziehung einzigartig.
Rhodan gelingt es, ihm nach und nach unter ständiger Gefahr der Fremden, wichtige Geheimnisse zu entreißen, und er erfährt auch, dass dieses und die sechs anderen Schiffe einst an einer Materiequelle beladen wurden.
Rhodan erfährt, dass diese Materiequelle beschädigt ist und zu versiegen droht, was schreckliche Folgen für diesen Teil des Universums hätte …
Damit ist Rhodans nächster Schritt klar: Die Materiequelle muss gefunden und repariert werden, wobei sich die Frage erhebt, was hinter dieser Quelle liegt …
e) Handlungsarm Sammlerschiffe
Dieser Handlungsarm gibt uns Gelegenheit, ab und zu Einzelabenteuer in die Serie einzubauen, die doch zum großen Rahmen gehören.
Eingangs wurde erwähnt, dass die LFT Sammlerschiffe überall in die Galaxis ausschickt, um die verstreut lebenden Terraner zu bewegen, zur Erde zu kommen.
Das ist der offizielle Auftrag dieser Sammlerschiffe.
Darüber hinaus ist Julian Tifflor sich im Klaren, dass es viele Menschen geben wird, die in ihrer neuen Heimat leben bleiben wollen, vor allem jene, die auf anderen Welten geboren wurden.
In diesen Menschen sieht Tifflor sein »Startkapital« für eine Einigung der gesamten Galaxis unter der GAVÖK.
So gibt es an Bord eines Sammlerschiffes neben der offiziellen Arbeit noch eine halboffizielle. An Bord der Schiffe gibt es Crews aus verschiedenen Völkern der GAVÖK.
Es sind in erster Linie Kosmopsychologen. Sie arbeiten bei all jenen, die nicht zur Erde wollen, und bei Fremdvölkern, die gegen die Erde sind, auf eine Einigung im Sinne der GAVÖK hin …
Auf diese Weise dienen die Sammlerschiffe neben ihrer offiziellen Funktion noch heimlich dem Frieden in der Galaxis.
Tifflor ernennt den erfahrenen ehemaligen USO-Spezialisten Ronald Tekener zum Chef dieser Bewegung, Jennifer Thyron wird Tekener bei der Schwere der Aufgabe zur Seite stehen.
f) Verschiedene Nebenhandlungen
Neben den Haupthandlungsarmen gibt es noch eine Reihe von wichtigen Ereignissen, die beachtet werden müssen und so interessant sind, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren dürfen:
Da sind die Molekülverformer, mit ihrem Plan, mit Hilfe der Menschheit ihr altes Reich Tba wiederzuerrichten.
Da ist der Planet Olymp mit dem Robotkaiser Anson Argyris. Olymp wird wieder eine zentrale Schaltstelle der LFT werden.
Da ist die Figur des Tengri Lethos mit seinem Ewigkeitsschiff, die wir wieder aus der Versenkung holen und in den Handlungsrahmen einbauen.
Da ist Eden II mit den drei Milliarden Konzepten, auf seiner Reise in die Ewigkeit.
Da sind Figuren wie Ernst Ellert, Harno und Hotrenor-Taak, die wir nicht ganz aus den Augen verlieren wollen.
2. Teil – Handlungsabriss der Bände Nr. 1000 – ca. 1200
Hinweis:
Die Handlung von Nr. 850 – Nr. 999 führt über Band 1000 hinaus, so dass Band 1000 kein Handlungsbeginn eines neuen Zyklus ist. Der Knalleffekt von Band Nr. 1000 soll vielmehr das Auftauchen einer neuen großen Figur in der PR-Serie sein.
Handlungsabriss:
Endlich dringen Perry Rhodan und seine Getreuen in den eigentlichen Bereich der Materiequelle ein.
Dort stößt man auf den geheimnisvollen und mächtigen »Gefangenen der Materiequelle«, die neue Figur in der PERRY RHODAN-Serie. Falkhor, wie sein Name sein könnte, ist der Einzige, der jemals von »drüben«, von der anderen Seite der Materiequellen, auf »diese« Seite gekommen ist. Dabei gelangte er in den Bereich dieser Quelle, wo er seither gefangen ist.
An diesen Quellen werden auch die sieben Schiffe von Bardioc und seinen ehemaligen Freunden beladen.
Aus diesen Quellen sprudeln Wasserstoffkerne. Rhodan erfährt, dass zu jeder Quelle auch eine Materiesenke existiert, wo der umgekehrte Effekt stattfindet, d.h., Materie wird abgesogen.
Rhodan erfährt entsetzt, dass, wenn die Quelle beschädigt ist, dies auch bei der Senke der Fall sein muss.
Von Falkhor hört er, dass die Senke dann übermäßig viel Materie in sich hineinzieht.
Das bedeutet, dass ganze Sternensysteme in sie hineinstürzen, ein Schicksal, das auch die Milchstraße bedroht. Kein Wunder, dass Perry alles tun will, um diesen Schaden zu beheben.
Doch das lässt sich nicht so ohne Weiteres realisieren. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, auf denen sich die Handlung aufbauen wird:
1. Die technischen, wissenschaftlichen und philosophischen Probleme
2. Im Sektor der Materiequelle leben viele raumfahrende Völker, die diese Quelle als »Besitz, Heiligtum« usw. ansehen. Ihnen und ihren Interessen muss man begegnen.
3. Die Wesen, zu denen Falkhor gehört und die jenseits der Materiequelle leben. Sie sehen jede Manipulation der Quelle als Bedrohung ihrer selbst an und schicken Kommandos durch die Quelle, um die Störenfriede zu vertreiben.
Aus diesen drei Punkten lassen sich im Handlungsbereich der Materiequelle unzählige Abenteuer konstruieren.
Darüber hinaus wird der Handlungsschauplatz Erde einen neuen dramatischen Höhepunkt erleben. Margor, der Mutant, hält den Tag X der Machtübernahme für gekommen und beginnt damit, ein gewaltiges Reich zu errichten.
Ein weiterer Handlungsarm wird die PAN-THAU-RA sein, das mächtige Schiff Bardiocs. Darüber hinaus wird die SOL mit den Solgeborenen allmählich zu einem Generationsraumschiff, an Bord vergisst man die Herkunft von der Erde und von der Menschheit und treibt in die Tiefen des Alls.
Mehr über die Handlung nach Nr. 1000 in Details zu berichten, wäre fehl am Platz, da sich aus der Handlung, die jetzt läuft, naturgemäß viele wichtige Dinge und Aussagen entwickeln, die berücksichtigt und eingebaut werden müssen.
Hinweis:
In dieser Arbeit sind die Vorschläge der anderen PR-Autoren zum Handlungskomplex berücksichtigt.
Die Worte von Willi Voltz waren direkt prophetisch – denn die Handlung bekam ein Eigenleben und entwickelte sich binnen kurzem in eine gänzlich andere Richtung. Zwar finden sich darin schon einige später verwendete Begriffe, doch haben sie eine völlig andere Bedeutung, als sie sie später erhielten. Eine gute Idee wurde durch eine bessere ersetzt. Und den Höhepunkt stellte schließlich nicht das Auftauchen einer neuen Figur im Perryversum dar, sondern die Geschichte eines großen Plans, in dessen Zentrum dann Perry Rhodan selbst stand – »Der Terraner«!
Was dann tatsächlich geschah
Perry Rhodan hat von ES die Struktur des Zwiebelschalenmodells erfahren und weiß jetzt, dass die Materiequellen (und Materiesenken) sich aus den Superintelligenzen heraus entwickeln und die nächsthöhere Stufe der Evolution darstellen. Über diesen stehen dann die Kosmokraten und Chaotarchen, die Vertreter von Ordnung und Chaos, die sich auf allen Ebenen ein unerbittliches und ewiges Gefecht um die Vorherrschaft im Universum liefern. Und ES erteilt Rhodan den Auftrag, zur Verteidigung gegen die negative Superintelligenz Seth-Apophis die Kosmische Hanse zu gründen, dem äußeren Anschein nach eine Handelsorganisation, tatsächlich aber ein Machtfaktor im Kampf gegen Seth-Apophis, die im Begriff ist, die Mächtigkeitsballung von ES anzugreifen. Während sich die Hanse gegen Agenten der negativen Superintelligenz und deren Sabotageversuche zur Wehr setzen muss und im Wega-System ein Fremder ohne Gedächtnis aufgefunden wird, der sich Quiupu nennt und nach einem Viren-Imperium sucht, wird an einer anderen Stelle im Universum, im Herzogtum Krandhor, eine Friedenszelle als Puffer zwischen den beiden Superintelligenzen errichtet. Gelenkt wird das Herzogtum vom Orakel von Krandhor, hinter dem sich niemand anders als der Arkonide Atlan verbirgt, der von Laire angeblich hinter die Materiequellen gebracht wurde. Ebenfalls im Herzogtum Krandhor erleben drei Betschiden, Nachkommen der ehemaligen SOL-Besatzung, zahlreiche Abenteuer.
Quiupu beginnt mit Viren zu experimentieren und verlegt, nachdem ein Experiment außer Kontrolle geraten ist, seine Aktivitäten schließlich auf den Planeten Lokvorth. Icho Tolot läuft unter dem Einfluss von Seth-Apophis in Terrania Amok, kommt nach seiner Inhaftierung wieder frei, findet in der Folge in einer Station einen besonderen Handschuh und gelangt schließlich an Bord der BASIS, die zur Galaxie Norgan-Tur aufbrechen soll. Dort hat Jen Salik auf dem Planeten Khrat den Dom Kesdschan gefunden und wurde zum Ritter der Tiefe geweiht. Auch Perry Rhodan soll sich diesem Ritual zu unterziehen. An Bord der BASIS befindet die nach ihrem Schöpfer genannte Hamiller-Tube, eine hochwertige Positronik, die sich zum richtigen Zeitpunkt selbst aktivieren soll. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.
Auf Terra taucht ein kleines Mädchen namens Srimavo auf, seiner Augen wegen auch Sphinx genannt, das offenbar parapsychische Fähigkeiten besitzt. Es will zu Quiupu gebracht werden, um ihm bei seinen Viren-Experimenten zu helfen. Denn dabei handelt es sich um einen Versuch von vielen, das Virenimperium neu erstehen zu lassen, von dem sich die Kosmokraten die Antworten auf die drei Ultimaten Fragen erwarten. Und Rhodan sieht schließlich die Zeit für gekommen, der Öffentlichkeit die wahre Aufgabe der Hanse zu erklären. Die Betschiden sind zwischenzeitlich an Bord des Schiffes gebracht worden, mit dem die Spoodies abgeerntet werden, Symbionten, die die Intelligenz des Wirtes erhöhen. Dieses Schiff ist die langgesuchte SOL.
Info zur Romanserie: Spoodies
Spoodies sind Symbionten, die sich mithilfe des Doppelrüssels unter der Kopfhaut ihrer Wirte einnisten. Dabei scheinen sie instinktiv zu spüren, wo sich die Bereiche des Gehirns befinden, die für sie wichtig sind. Sie ernähren sich von einer geringen Menge Körperflüssigkeit des Wirtes und scheiden im Gegenzug ein Sekret ins Blut des Wirtes ab, das dessen Intelligenz erhöht sowie dessen spezielle Begabungen verstärkt. Die Wirkung dieses Sekrets ist abhängig von der Qualität der Körpersäfte, die die Spoodies aufnehmen. Bei manchen Wirten wird durch das Sekret keine Wirkung erzeugt.
Spoodies können durch einen operativen Eingriff gezielt auf einen Wirt gesetzt werden. Während die meisten Lebewesen nur einen oder maximal zwei Spoodies vertragen, weil sie sonst den Verstand verlieren, können besonders starke Persönlichkeiten auch zwei oder mehr davon tragen und entwickeln dadurch besonders hohe Intelligenz. Der Betschide Surfo Mallagan trug vier Spoodies (ebenso wie später Brether Faddon und Scoutie), bevor er mit einem ganzen Pulk von Spoodies in Kontakt trat, um Atlan als Orakel von Krandhor abzulösen.
Eine direkte Kommunikation zwischen den Spoodies und ihren Wirten findet nicht statt. Nach sieben bis acht Terra-Jahren sterben als Symbionten eingesetzte Spoodies ab und müssen ersetzt werden.
Im Herzogtum von Krandhor wurden die Spoodies ab 224 NGZ als Symbionten eingesetzt. Die SOL war dort im Auftrag der Kosmokraten mit einer Ladung Spoodies eingetroffen. Atlan wurde zum Orakel von Krandhor und beriet die Herzöge 200 Jahre lang im Sinne der kosmokratischen Interessen. Die SOL transportierte als Spoodie-Schiff immer neue Ladungen der Symbionten aus Varnhagher-Ghynnst ins Krandhor-System.
Mit Hilfe der Spoodies nahm die Entwicklung der Kranen und ihrer Hilfsvölker einen rasanten Verlauf. Bei den Kranen bewirkten die Spoodies eine Zunahme an Intelligenz, Mut und Entschlossenheit. Das Herzogtum von Krandhor entstand und breitete sich bis zu den Grenzen der Galaxie Vayquost aus. Der Plan der Kosmokraten sah vor, dass die Kranen als starke, unabhängige Macht im Niemandsland zwischen den Mächtigkeitsballungen der Superintelligenzen ES und Seth-Apophis für Sicherheit sorgen sollten.
Bei den Kranen war das Tragen von mehr als einem Spoodie verboten. Träger von zwei Spoodies, sogenannte »Doppelträger«, wurden gejagt.
(PERRYPEDIA)
Auf Kran versucht die oppositionelle Bruderschaft, die ihre Agenten in die höchsten Regierungskreise eingeschleust hat, das Orakel abzuschaffen und die Gleichstellung aller Völker im Herzogtum zu verhindern. Dieses enthüllt schließlich den Herzögen die kosmischen Hintergründe des Geschehens und als sich die Bruderschaft doch zum Zuschlagen entschließt, gibt es sich als weißhaariger Humanoider zu erkennen. Auf der BASIS versucht Tolot, der unter dem Einfluss des von ursprünglich von den Porleytern geschaffenen Handschuhs steht, der von Agenten der Seth-Apophis aus dem Dom Kesdschan entwendet und umfunktioniert wurde, das Kommando über das Fernraumschiff an sich zu reißen, scheitert aber an der Hamiller-Tube, woraufhin er sich mit seinem Helfershelfer Bruke Tosen an Bord ihres Raumboots absetzt.
Auf Lokvorth sind Srimavo und ein Begleittrupp auf der Suche nach dem verschwundenen Quiupu. In einer domartigen Höhle, die sie dabei entdecken, hat sich Quiupu ein neues Labor eingerichtet. Das kosmische Findelkind ist aber momentan nicht anwesend. Dafür entdeckt die Sphinx in einem energetischen Fesselfeld einen winzigen Teil des rekonstruierten Virenimperiums. Kurz darauf erscheint Quiupu, und es kommt zwischen ihm und Srimavo zu einem Duell auf geistiger Ebene, das Quiupu für sich entscheiden kann. Das kosmische Findelkind hat hier in der Abgeschiedenheit die Vishna-Komponente so weit reduziert, dass sie keine Gefahr mehr für die weiteren Experimente bedeutet, wie das beim gescheiterten Experiment in Terrania der Fall war.
Atlan vermittelt zwischen den Herzögen und der Bruderschaft und kehrt schließlich diesem Raumsektor an Bord der SOL endgültig den Rücken. In Varnhager Ghynnst trifft Atlan in einer uralten Station auf eine junge Frau, die eine starke Faszination auf alle Männer ausübt und sich Gesil nennt. Sie geht an Bord der SOL und fliegt mit in Richtung Milchstraße. Im Verlauf des Weiterflugs gehen alle Buhrlos von Bord, um ihrer neuen Bestimmung als echte Weltraummenschen zu folgen. Die BASIS hat mittlerweile Khrat erreicht, und Perry Rhodan folgt per Distanzlosem Schritt, um dort die Ritterweihe zu empfangen. Im Gewölbe unterhalb des Doms findet er die Steinerne Charta von Moragan-Pordh, die die Regeln und Zielsetzungen der Porleyter, einer Vorgängerorganisation des Ritterordens, enthält und ihm mental die drei Ultimaten Fragen übermittelt, an deren Beantwortung den Kosmokraten sehr viel liegt:
1.Was ist der Frostrubin?
2.Wo beginnt und wo endet die Endlose Armada?
3.Wer hat das GESETZ initiiert und was bewirkt es?
Während die BASIS noch in Norgan-Tur bleibt, kehrt Rhodan in die Milchstraße zurück, um sich auf die Suche nach den Porleytern zu machen und sie um Hilfe zu bitten. Die von Khrat mitgebrachten Informationen weisen auf M 3 als Versteck der Porleyter hin. Aber auch Seth-Apophis ist bemüht, die Porleyter ausfindig zu machen, und schickt ihre Agenten aus.
Nachwehen des Großereignisses
Immer schon ist von allen Mitarbeitern des Verlags behauptet worden, die Leser von PERRY RHODAN und allen damit zusammenhängenden Reihen und Serien hätten einen großen Einfluss auf Inhalt und Gestaltung der Serie. Wie groß dieser Einfluss tatsächlich ist, das machte ein Rundschreiben deutlich, das Willi Voltz am 18.11.1980 an alle PERRY RHODAN-Mitarbeiter adressierte:
»Auf dem PR-Con in Mannheim sind Klaus Mahn und ich regelrecht bestürmt worden, den PR-Computer wieder die PR-Serie aufzunehmen. Das entspricht auch der Meinung, die aus den Leserzuschriften zu entnehmen ist.
Klaus Mahn hat nun seine Computerbeiträge wieder ab Nr. 1025 aufgenommen. Die Beiträge werden ab Nr. 1025 in PERRY RHODAN I veröffentlicht.
Die Computerbeiträge von Klaus Mahn werden, ebenso wie die Exposés, unmittelbar nach Eintreffen im Verlag vervielfältigt und an die PR-Autoren verteilt.
Nicht betroffen von dieser neuen Regelung ist das PR-Lexikon von K.H. Scheer, das in jedem Fall weitergeführt werden muss, denn der Ruf nach PR-Lexikon Band II bzw. einer Gesamtbearbeitung von PR-Lexikon I mit II ist nicht minder laut als der nach dem Computer.
Es muss vom Verlag/Herstellung geklärt werden, ob ab Nr. 1025 das Lexikon mit dem Computer zusammen erscheinen kann oder ob die Lexikonbeiträge angesammelt werden. In absehbarer Zeit stellt sich die Frage nach dem Lexikographen für ein PR-Lexikon in der Aufmachung der PR-Bücher, das PR I (durchgeforstet und korrigiert/ergänzt) und PR II-Lexikon enthält. Ich bitte K.H. und Heidrun Scheer, sich darüber schon einmal Gedanken zu machen.«
Peter Griese hatte schon in einem Brief an Kurt Bernhardt, datiert mit 2. April 1980, auf diese Leserwünsche hingewiesen:
»… aus Gesprächen mit PR-Lesern, Willi Voltz und aus einigen Zuschriften habe ich erfahren, dass sich in Leserkreisen ein gewisser Unmut breitmacht. Er betrifft die seit einigen Monaten in PR – 1. Auflage – zu findenden ›Lexikon-Beiträge‹. Diese stoßen auf Unverständnis, und das aus diversen Gründen.
Ersten sind diese Beiträge nicht aktuell oder auf die Handlung bezogen. Der PR-Computer war das, und er kam besser an. Hier handelt es sich um Datenangaben, die teilweise über drei Jahre (!) alt sind.
Zweitens enthalten die Daten überwiegend Angaben, die in der damaligen PR-Handlung gar nicht so oder so detailliert enthalten waren. Es entsteht der Eindruck einer nachträglichen, von der Handlung losgelösten Datenmacherei ohne erkennbaren Sinn.
Drittens beklagen einige Leser, dass die ›aufgelockerte‹ Art des Drucks eine reine Platzverschwendung sei.«
Die Idee, das neue Lexikon in zwei Bänden im Silberband-Format herauszubringen, war Monate zuvor anlässlich eines Gesprächs zwischen dem Vertriebsleiter Herrn Zenkert und Willi Voltz geboren worden. Ebenso die Idee eines »PERRY RHODAN-Weltraum-Atlas Band Nr. 1« in der Aufmachung wie die RHODAN-Silberbände, nachdem die frühere Idee verworfen worden war, diesen »nicht in Heftform kostenlos abzugeben, sondern besonders wertvoll aufgemacht als Buchausgabe herauszubringen.« (Brief von Zenkert an Bernhardt am 25.3.1980).
Kurt Bernhardt einmal anders
Kurt Bernhardt war in gewisser Weise ein Unikum, ein Verlagsmensch, wie man ihn heutzutage kaum mehr antrifft. Er hatte ein unglaubliches Gespür dafür, wofür ein Markt vorhanden sein könnte, was die Leser wünschen und erwarten, und reagierte entsprechend. Das bewies er bei allen Reihen und Serien, die in seiner jahrzehntelangen Laufbahn initiiert und herausgebracht hat, nicht nur mit PERRY RHODAN und den damit in Zusammenhang stehenden Heftserien und später auch Taschenbuchreihen. Bernhardt war ein Macher vom alten Schlag, er gab den Projekten auch Chancen und ließ ihnen Zeit, sich auf dem Markt zu etablieren, und stellte nicht kurzfristig Reihen und Serien ein, nur anhand von Verkaufszahlen, wie das heutzutage leider im Verlagsbranche üblich ist, und nicht nur dort. Freunde von TV-Serien können da ebenfalls ein Lied davon singen.
Er genoss auch den Ruf, ein Choleriker zu sein. Dass er auch über eine gesunde Portion bissigen Humors verfügte, das zeigt ein Brief, den er am 3. Dezember 1980 an einen Autor schrieb:
»Lieber XXXXX,
wie ich erfahren habe, sind Sie wieder auf großer Reise (…) und haben pflichtbewusst – wie Sie sind – vorher noch Ihr PERRY-RHODAN-Manuskript Nr. 10XX abgeliefert. Aber oh Schreck! Unseren zwei Meistern, Herrn Voltz und Herrn Schelwokat, ist das Manuskript in die Knochen gefahren. Sie haben große Teile so schlecht gestaltet, dass beide Herren sich entschließen mussten, eine grundsätzliche Überarbeitung vorzunehmen, und wer macht das natürlich? Unser Arbeitstier, Herr Voltz. Sicher können wir alle froh sein, dass wir einen Mann wie Herrn Voltz haben, und Sie ganz besonders. Aber Sie können nicht verlangen, dass Herr Voltz diese Arbeit umsonst macht, und Sie werden daher verstehen, dass wir bei einem Ihrer nächsten Honorare DM 100,00 (und dieser Betrag ist noch niedrig angesetzt!) in Abzug bringen müssen. Ich bitte Sie daher, dies bei Ihrer nächsten Rechnung zu berücksichtigen.
Ich würde Ihnen empfehlen, sich bei Herrn Voltz persönlich zu bedanken, dass er so viel Verständnis für Ihre Arbeit und Ihre Reiselust hat. Hoffentlich wird Ihnen Herr Voltz noch lange Zeit zur Seite stehen. Sie sind eben ein Glückspilz.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kurt Bernhardt.«
Bernhardt dürfte sich nicht oft von dieser Seite gezeigt haben, denn auf der Kopie des Schreibens fand sich der handschriftliche Vermerk: »Wo hat Bernie plötzlich den Humor her?«
Das Jahrzehnt der Clubs
In den achtziger Jahren wurden fast alle der großen und auch heute noch aktiven PERRY RHODAN-Clubs gegründet.
Als erster betrat der »Science Fiction Club Universum« (SFCU) die Szene, der 1980 im Saarland von Hans-Dieter Schabacker, Volker Kunter, Gerhard Zeitzen und Wendelin Holbach aus der Taufe gehoben wurde. Schwerpunkt des Jahre lang von Hans-Dieter Schabacker geleiteten Fanclubs, der heute rund 90 Mitglieder nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, Frankreich und Übersee zählt, lag neben der Beschäftigung mit Science Fiction im Allgemeinen und PERRY RHODAN im Besonderen ursprünglich bei Raketenexperimenten, verlagerte sich dann aber Anfang der neunziger Jahre auf die Herausgabe von Sekundärliteratur zu PERRY RHODAN und alle im Perryversum spielenden Publikationen, für die der SFCU heute berühmt ist. Diese Aktivitäten startete der SFCU, dessen Mitglieder sich zu Stammtischen in Berlin, Köln, Münster und Bad Homburg treffen, zunächst mit der Publikation einer Handlungszusammenfassung der ATLAN-Serie unter dem Titel »ATLAN – Helfer der Menschheit«, geschrieben von Dr. Robert Hector, die mehrere, verbesserte Auflagen erlebte, sowie ein drei Hefte umfassender Leitfaden durch die PERRY RHODAN-Taschenbücher von Band 1 bis Band 330 unter dem Titel »Im Einsatz für Terra«, der von Michael Maus zusammengestellt wurde und neben kurzen Inhaltsangaben eine Zeittafel mit der Einordnung der einzelnen Titel, eine Inhaltsangabe der sieben Jubiläumsbände sowie einige Randnotizen enthielt, in denen auf die größten Gedankenfehler innerhalb der Serie hingewiesen wurde. Robert Hector sammelte seine Ideen zur größten SF-Serie der Welt in mehreren Bänden der Reihe »Gedankenspiele«, in der Reihe »Kleine Kostbarkeiten« gab es zum Beginn eine Sammlung von MYTHOR-, PERRY RHODAN- und ATLAN-Storys, die mehr als ein Jahrzehnt zuvor im PERRY RHODAN MAGAZIN erstmals veröffentlicht worden waren.
Eines der großen Highlights im Sekundärprogramm des SFCU waren und sind aber die ZEITRAFFER-Bände, die 1991 mit der Herausgabe des ersten PERRY RHODAN-Zeitraffers gestartet wurden, in dem Michael Thiesen sehr detailliert auf die Inhalte und inneren Zusammenhänge der PERRY RHODAN-Hefte einging. Hans-Dieter Schabacker hatte völlig recht, als er in seinem Vorwort schrieb: »Es schlummern immer noch unentdeckte Talente im deutschen Fandom, eines davon ist Michael Thiesen aus Kaiserslautern. Der vorliegende Sonderdruck wurde textlich von ihm erstellt, und auch das hervorragende Seitenlayout stammt von ihm – und dies alles hat ihm auch noch Spaß gemacht, wie er mir schrieb. Da bleibt zu hoffen, dass das vorliegende Werk auch euch Spaß macht und dass Michael noch lange so weitermacht und wir Fortsetzungen dazu herausgeben können.« Dieser Wunsch wurde erfüllt. Nicht nur hat Michael Thiesen im Lauf der seither verstrichenen mehr als zwei Jahrzehnte alle PERY RHODAN- und mit Ausnahme des »König von Atlantis« alle ATLAN-Zyklen erfasst, die ZEITRAFFER wurden auch immer wieder überarbeitet, mit neuen Erkenntnissen erweitert und optisch immer wieder verbessert. Damit haben Michael Thiesen, der zwischenzeitlich zu einem wichtigen freien Mitarbeiter der PERRY RHODAN-Redaktion geworden ist, und der SFCU nicht nur den Fans interessante und tiefschürfende Publikationen an die Hand gegeben, sondern auch den Autoren wichtige Grundlagen für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Auch für Neuleser sind die »Zeitraffer«-Bände ein fast unentbehrlicher Ratgeber für den erfolgreichen Einstieg in die größte und längstlaufende SF-Serie der Welt.
Kurzbiografie: Michael Thiesen
Michael Thiesen wurde am 23. Mai 1956 in Trier an der Mosel geboren, wo er auch aufwuchs und 1975 das Abitur machte. Danach studierte er Biologie und Chemie für das Lehramt an Gymnasien.
Bereits als 13-Jähriger kam er mit PERRY RHODAN in Kontakt. »Seit meiner Kindheit bin ich ein konsequenter Leser und Sammler von SF aller Art«, beschreibt Thiesen selbst sein Interesse. »Von Anfang an hatte es mir speziell die Kunst der SF-Illustration und die Visualisierung phantastischer Themen in Filmen und Comics angetan.« Den Kontakt zu PERRY RHODAN fand er 1970 über Band 126 »Die Schatten greifen an«. Besonders fasziniert war er von William Voltz, da dieser viele Personen in der Handlung, besonders aber Alaska Saedelaere, als einsame Antihelden darstellen konnte.
Mitte der siebziger Jahre kam er erstmals mit dem Fandom in Berührung und arbeitete an Fanzines mit, unter anderem Michael Nagulas THINK OVER und COLLOQUIUM sowie W.K. Giesas TIME GLADIATOR.
Obwohl er zweimal die Lektüre der PERRY RHODAN-Serie abgebrochen hatte, kam er jedes Mal »reumütig« – so Thiesens eigene Formulierung – zurück. »Irgendwann habe ich es einfach aufgegeben, aussteigen zu wollen«, sagt er selbst. Er blieb seiner Lektüre treu, wenngleich er immer wieder kritische Worte zur aktuellen Handlung und zu aktuellen Romanen findet. 1990 startete er das ambitionierte Projekt PERRY RHODAN-ZEITRAFFER, das aus einzelnen Paperbacks besteht, die jeweils die Romane eines Zyklus ausführlich zusammenfassen und miteinander in einen Kontext stellen. Das Nachschlagewerk besteht aus mittlerweile 22 Einzelbänden zur Hauptserie sowie einer zu PERRY RHODAN ACTION, wurde mehrfach überarbeitet, auf CD-ROMs herausgegeben und immer wieder aktualisiert. Zuletzt wurde der ursprüngliche Band 1 mit den Heften 1–200 stark erweitert und als Band 1A und 1B neu herausgegeben. Dabei war der Anfang der Arbeit vergleichsweise untypisch: »Ich suchte nach einer Möglichkeit, um auf unterhaltsame Weise mit dem Schreibprogramm Word – damals noch in der Version 4.0 für DOS – vertraut zu werden.« Im Lauf der Jahre hat er sich durch seine zahllosen, sachkundigen Artikel und Zusammenfassungen, wie sie auch regelmäßig im PERRY RHODAN JAHRBUCH erscheinen, durch seine ZEITRAFFER-Bände und durch seine Zusammenarbeit mit dem Autorenteam längst zu einem unentbehrlichen Berater im Hintergrund entwickelt.
Angeregt durch entsprechende Veröffentlichungen Ernst Vlceks im PERRY RHODAN-Report, begann Thiesen damit, eigene Schauplatzkarten zur PERRY RHODAN- und ATLAN-Serie zu entwerfen, die er immer mehr optimierte und von denen bereits einige auf den Report-Seiten veröffentlicht wurden. Zudem gewann er mit seiner Story »Herbstlaub« den 2. Platz des Kurzgeschichten-Wettbewerbs »Begegnung an der Großen Leere«, steuerte eine Kurzgeschichte zu dem 1999 erschienen vierten Band der ATLAN-TRAVERSAN-Buchausgabe bei, verfasste zu jedem der 23 Bände der bei HJB erschienenen PERRY RHODAN GOLD-EDITION ein informatives Nachwort und stellt regelmäßig für die SOL, das Magazin der PERRY RHODAN-FANZENTRALE, ein Völker-Datenblatt zusammen.
Michael Thiesen ist von Beruf Lehrer und lebt mit seiner Familie in Kaiserslautern.
Das zweite Highlight bei den Veröffentlichungen des SFCU ist das PERRY RHODAN JAHRBUCH, das erstmals 1993 für das Jahr 1992 erschienen ist. Neben Michael Thiesens Zeitraffer der in diesem Jahr erschienenen PERRY RHODAN-Romane, der auch in jedem der Folgebände zu finden war, gab es eine Übersicht über die 1992 erschienenen Taschenbücher von Marcus Kubach, Andrew Acrus stellte die Silberbände und das erste ATLAN-Hardcover vor, es gab Jahresrückblicke von Uwe Anton, Rüdiger Schäfer, Hans-Dieter Schabacker und dem Chronisten, ein Interview mit Dr. Florian Marzin, einen Nachruf von Michael Thiesen auf Günter M. Schelwokat sowie einen Text zum Ausstieg von Marianne Sydow aus dem PR-Team, Artikel zum Wiedereinstieg von Horst Hoffmann und Peter Terrid sowie zur PERRY RHODAN SIMULATION, und Rüdiger Schäfer informierte über seine ATLAN FANZINE-Serie im Besprechungsjahr; hinzu kamen jede Menge Statistiken. Das PERRY RHODAN JAHRBUCH erschien im SFC Universum bis zur Ausgabe für 1996, dann übernahm die PERRY RHODAN-FANZENTRALE ihre Herausgabe. Nach drei Ausgaben beendete die PRFZ seine Publikation. Nachdem es längere Zeit kein PR-JAHRBUCH mehr gegeben hatte, übernahm der SFCU im Jahr 2006 wieder die Herausgabe des wichtigen Sekundärwerks. Unter der Regie von Frank Zeiger und Andreas Schweitzer werden die PR-Fans seither wieder über alles informiert, was innerhalb eines Jahres wichtiges im Perryversum geschehen oder erschienen ist
Nicht vergessen werden dürfen bei der Aufzählung der SFCU-Publikationen zwei Hefte, die der Erinnerung an zwei Autoren gewidmet waren und die kurz nach deren Ableben erschienen sind: »K.H. Scheer – Einer von uns« und »Begegnungen – Zur Erinnerung an Kurt Mahr«. Und natürlich auch nicht der von Klaus Bollhöfener zusammengestellte Band »Die etwas anderen PR-Autoren«, in dem die wenig bekannten Autoren vorgestellt wurden, die nicht an der PR-Serie mitgeschrieben, sondern »nur« PR-Taschenbücher veröffentlicht haben.
Und für noch etwas ist der SFCU berühmt: Seit den 80er Jahren gab es keinen vom Verlag auf die Beine gestellten PERRY RHODAN-Con, bei dem nicht die Mitglieder des SFCU unermüdlich als verlässliche Helfer bereitgestanden hätten und ohne deren tatkräftige Mitarbeit bei den Vorbereitungsarbeiten oder der Abwicklung des Programms und der Betreuung der Ehrengäste und Referenten alle diese Veranstaltungen nicht so reibungslos und für die Besucher so angenehm abgelaufen wären, wie es der Fall war!
Fünf Jahre nach dem SFC Universum betrat dann der ATLAN CLUB DEUTSCHLAND die Szene.
Der schwierige Weg in die Buchhandlungen
Schon lange war es das Bestreben des Bauer-Konzerns gewesen, die Taschenbücher seiner Verlage nicht nur über Kioske und Bahnhofsbuchhandlungen verkaufen zu können, sondern auch im Buchhandel Fuß zu fassen. Was mit den vielen Pabel-Taschenbüchern nicht möglich war, da diese von den Buchhändlern nicht akzeptiert wurden, weil sie von einem Romanheft-Verlag stammten. Diese Überlegungen hatten handfeste finanzielle Gründe, gab es doch bei den Buchhandlungen im Gegensatz zum Zeitschriftenmarkt, wo die unverkauften Titel einfach retourniert wurden und nur die verkauften Exemplare zur Verrechnung gelangten, nur ein beschränktes und genau definiertes Rückgaberecht. Und die Remittenden waren zu dieser Zeit ein finanzielles und logistisches Problem, speziell im Taschenbuchbereich. Bei den Heften hatten die Verlage die Lösung gefunden, diese in Dreierpacks zusammenzufassen und in dieser Form nochmals zum Schnäppchenpreis auf den Markt zu bringen, sofern sie nicht den Lesern, wie bei Pabel und Moewig lange Zeit üblich, die Möglichkeit boten, früher erschienenen Hefte direkt beim Verlag nachzubestellen, solange es von diesen noch einen Lagerbestand gab.
Mit dem 1979 neu gegründeten Moewig Verlag wurde die Basis geschaffen, neue Taschenbuchkonzepte zu entwickeln und einen neuen Versuch zu starten, sich im heiß umkämpften Buchmarkt einen Teil vom Kuchen zu holen. Als Verlagsleiter wurde der ehemalige Heyne-Lektor Egon Flörchinger gewonnen, der das neu aus der Taufe zu hebende Taschenbuchprogramm auf zwei Label aufteilte: die unter »Moewig« firmierenden Reihen und Titel und ein unter dem Label »Playboy« erscheinendes Programm. Unter Letzterem erschienen bereits ab Frühjahr 1980 – also ein halbes Jahr früher als die eigentlichen Moewig-Taschenbücher und im gleichen Überformat wie diese – pro Monat sechs Titel, aufgeteilt in Subreihen wie ROMAN, REPORT, EROTIK, ESPRIT, STORY, PARTYWITZE UND CARTOONS und SCIENCE FICTION. Die PLAYBOY SF-Reihe blieb – mit Ausnahme des Romans zum ersten Star Trek-Film – ausschließlich Anthologien und Erzählbänden bekannter SF-Größen vorbehalten. Die Gestaltung war einheitlich hellblau mit kleinem Titelbild und nach außen versetzter Titelschrift. Wurden die zumeist sehr umfangreichen Originalbände anfangs ungekürzt wiedergegeben, so kam es in der Folge aus finanziellen Gründen zu teilweise extremen Kürzungen, die bis zur Hälfte des Originals gingen. Bis zum September 1982 erschien monatlich ein Band, dann wurde die Reihe für ein Jahr eingestellt. Unter der Federführung von Hans Joachim Alpers belebte man sie im Herbst 1983 wieder, der neue Erscheinungsrhythmus war zweimonatlich.
Die Reihe hatte an sich schon mit der Schwierigkeit zu kämpfen, dass sich Kurzgeschichtenbände, Anthologien wie Collections gleichermaßen, im deutschen Sprachraum ungleich schwerer verkaufen als Romane und Zyklen, der Todesstoß wurde ihr aber versetzt, als sich ein als »Highlights«-Band angekündigter Aktionstitel als »Rupfbuch« mit Neuherausgaben von Lagerbeständen entpuppte, denen man die ursprünglichen Cover entfernt (»gerupft«) hatte und die mit neuem Umschlag nochmals an drei Seiten geschnitten wurden. Erschwerend kam noch dazu, dass der Klappentext überhaupt nichts mit dem tatsächlichen Inhalt zu tun hatte. Der darauf folgende Band wurde zwar noch publiziert, die weiteren für 1986 eingeplanten und angekündigten Titel sind dann nicht mehr erschienen.
Für die Reihe MOEWIG SCIENCE FICTION, die mit vier Titeln im Monat einen Schwerpunkt im Verlagsprogramm darstellte, verpflichtete Verlagsleiter Flörchinger den Fachmann und literarischen Agenten Hans Joachim Alpers. Alpers hatte zuvor die mit einem Band pro Monat laufende Reihe KNAUR SCIENCE FICTION von Start weg betreut und trennte sich von Knaur, weil ihm die neue Aufgabe mehr Möglichkeiten bot. Nach längerer Vorbereitung, die Alpers für den gezielten Einkauf noch nicht auf Deutsch erschienener Titel bekannter Genre-Autoren nutzte, wurden die ersten Bände der neuen SF-Reihe im Oktober 1980 publiziert. Von Oktober bis Dezember kamen drei Titel pro Monat heraus, dann wurde der monatliche Ausstoß auf vier Bände gesteigert. Alpers’ Konzept sah so aus, dass jeden Monat der Spitzentitel eines bekannten und eines weniger bekannten Autors, eine Anthologie oder Storysammlung und ein weniger anspruchsvoller Titel eingeplant wurden. Besonderes Augenmerk richtete er in der Anthologienreihe KOPERNIKUS und dem jährlichen ALMANACH auf die deutsche SF. 1982 erschien das erste SCIENCE FICTION JAHRBUCH, dem noch vier weitere folgten. Die Aufmachung war einheitlich bunt und in kräftigen Farben gehalten: blauer Buchrücken mit weißer Schrift und einem großen, weiß umrandeten »Moewig«-Schriftzug. Für die Titelbilder wurden die bekanntesten internationalen Künstler gewonnen. Und jeder Band enthielt auch ein informatives Nachwort, das auf Autor und Werk näher einging.
Doch es wurde bald deutlich, dass sich die Taschenbücher nicht so gut verkauften, wie von Konzernseite her erwartet worden war, wobei sich die SF-Bände noch am bestens schlugen. Hauptursache dafür war, dass die Buchhändler Probleme hatten, die Bände verkaufsfördernd zu platzieren. Die Moewig- und Playboy-Taschenbücher hatten nämlich ein anderes Format als die sonst im Handel befindlichen Taschenbücher, und was ein exklusives Merkmal sein sollte, erwies sich jetzt als verkaufshemmend; die Bücher passten nicht in die herkömmlichen Displayständer, die in jeder Buchhandlung zu finden waren. Aus heutiger Sicht war Flörchinger mit diesem neuen Format seiner Zeit zu weit voraus. Heutzutage sind zahlreiche unterschiedliche Formate auf dem Markt, sogar innerhalb von Reihen, und das, auch ohne die Paperbacks zu berücksichtigen, die in den letzten Jahren sehr an Marktanteilen gewonnen haben. Dazu kam, dass die Preise der Moewig-Taschenbücher über denen der Wettbewerber lagen und die Startauflagen viel zu hoch angesetzt waren. Der Verlag sah sich schließlich gezwungen, darauf entsprechend zu reagieren. Deshalb erschienen ab Januar 1983 statt vier nur noch zwei Bände im Monat. In erster Linie von der Programmkürzung betroffen war die deutsche Ausgabe des US-Magazins ANALOG.
Kurzbiografie: Hans Joachim Alpers
Hans Joachim Alpers wurde am 14. Juli 1943 in Wesermünde/Niedersachsen geboren, das 1945 Bremerhaven zugeschlagen wurde. Er arbeitete nach einer Lehre als Schiffsschlosser und einem Ingenieursstudium in Bremen einige Zeit als Maschinenbauingenieur und studierte anschließend noch Politik und Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Das Studium gab er schließlich auf, um sein Hobby zum Beruf zu machen und sich künftig mit literarischen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Für die SF interessierte er sich schon in jungen Jahren. Er veröffentlichte in Fanzines, übernahm 1968 als Chefredakteur und Herausgeber das SF-Fanzine SCIENCE FICTION TIMES, das unter seiner Leitung zu einem kritischen semiprofessionellen Fachblatt wurde, und war 1970 Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Spekulative Thematik (AST). Die eingehende Beschäftigung mit der Literatur führte schließlich zur Veröffentlichung eigener Texte für den Profimarkt, beginnend mit dem unter dem Pseudonym Jürgen Andreas 1967 publizierten SF-Storyband »Erde ohne Menschen«. Am Beginn seiner schriftstellerischen Karriere nahmen die Jugendbücher einen breiten Raum ein, von denen einige in Zusammenarbeit mit seinem Freund und Kollegen Ronald M. Hahn entstanden und für die das Gemeinschaftspseudonym Daniel Herbst verwendet wurde. Unter seinem richtigen Namen veröffentlichte er die gemeinsam mit Ronald M. Hahn konzipierte und geschriebene, sechs Bände umfassende SF-Jugendbuch-Serie DAS RAUMSCHIFF DER KINDER. Weitere Pseudonyme waren Thorn Forrester, unter dem auch andere Autoren veröffentlichten, Mischa Morrison, P. T. Vieton und Jörn de Vries. Auch zu Basteis SF-Serie COMMANDER SCOTT steuerte er einen Roman unter dem Verlagspseudonym Gregory Kern bei.
Zu Beginn der 70er Jahre kam es durch ihn und seine Freunde und Kollegen Ronald M. Hahn und Werner Fuchs zur Gründung der literarischen Agentur UTOPROP, die neben deutschen Nachwuchsautoren auch zahlreiche SF-Schriftsteller aus dem Ausland vertrat, und für Alpers in der Folge zu ersten redaktionellen Arbeiten im Profibereich, beginnend 1977 als Lektor für Kelters SF-Reihe GEMINI und dazu dann als Redakteur beim SF-Magazin COMET. Von 1978 bis 1980 gab er die SF-Reihe von Knaur heraus, die von Werner Fuchs übernommen wurde, als er das Angebot erhielt, für die neuen Moewig-Taschenbücher die Reihe MOEWIG SCIENCE FICTION zu konzipieren und zu betreuen, für die er ebenso wie für die Reihe PLAYBOY SCIENCE FICTION und MOEWIG PHANTASTIKA bis 1986 verantwortlich zeichnete. Die MOEWIG SF brillierte mit renommierten Autoren und exzellenten Anthologien, die großartigen »Kopernikus«-Bände, die von ihm ebenso zusammengestellt und herausgegeben wurden wie der »Moewig Science Fiction Almanach«, das »Moewig Science Fiction Jahrbuch« oder die Auswahlbände aus dem renommierten amerikanischen SF-Magazin »Analog«. Die Auswahl war hervorragend, nur war das das generelle Konzept des Moewig-Taschenbuchprogramms mit dem für die damalige Zeit ungewöhnlich großen Format letztlich nicht vor Erfolg gekrönt. Ebenfalls exzellent die Anfang der 80er Jahre gemeinsam mit Hahn und Fuchs für Hohenheim liebevoll zusammengestellte Reihe der »Science Fiction Anthologien«, in denen etliche Kleinode aus dem Goldenen Zeitalter der amerikanischen Science Fiction erstmals dem deutsche Leser präsentiert wurden.
1978 erschien auch der erste von etlichen bahnbrechenden Sekundärbänden, die von Alpers mit herausgeben wurden: der prächtige Bildband »Dokumentation der Science Fiction ab 1926 in Wort und Bild«. 1980 folgte bei Heyne als erster Meilenstein das zweibändige »Lexikon der Science Fiction Literatur«, das 1988 in einer aktualisierten einbändigen Ausgabe nochmals auf den Markt kam, und 1982 »Reclams Science Fiction Führer«. 1999 erschien unter seiner Federführung das »Lexikon der Horrorliteratur«, 2005 gefolgt vom »Lexikon der Fantasy-Literatur«. Eine ursprünglich geplante aktualisierte Neufassung des SF-Lexikons wurde leider nicht mehr realisiert. Glanzlichter der SF-Sekundärliteratur waren auch seine Sachbücher über Isaac Asimov und Marion Zimmer Bradley (beide 1983).
1984 konzipierte er gemeinsam mit Ulrich Kiesow und Werner Fuchs das größte deutsche Rollenspiel DAS SCHWARZE AUGE. Dafür schrieb er 1996/97 die Trilogie DIE PIRATEN DES SÜDMEERS und entwickelte die im DSA-Universum spielende Serie RHIANA DIE AMAZONE, zu der er vier Romane beisteuerte; ein bereits angekündigter fünfter wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Und zu SHADOWRUN verfasste er die Trilogie DEUTSCHLAND IN DEN SCHATTEN. Darüber hinaus publizierte er mehrere Romane der Jugendbuch-Serie DIE ÖKOBANDE und schrieb er auch an Basteis Krimi-Serie CHICAGO mit, die ohne Autorennennung erschien. Auch bei PERRY RHODAN gab er 2007 mit dem 3. ARA-TOXIN-Band »Necrogenesis« ein Gastspiel.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends übersiedelte Alpers nach Nordfriesland, wo er ein Bauernhaus nach seinen Wünschen umbaute und dort sehr zurückgezogen seiner Sammelleidenschaft frönte, mit Schwerpunkt auf deutschsprachige Vorkriegs-SF. Für seine Leistungen als Autor und Herausgeber wurde er mehrmals mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet, für das »Lexikon der Fantasy-Literatur« erhielt er den »Deutschen Fantasy-Preis«. Am 16. Februar 2011 starb er nach kurzer schwerer Krankheit im Wilhelminen-Hospiz in Niebüll an Krebs.
Sparen bei den Zeichnern …
Um die Ausgaben besser in den Griff zu bekommen, wurde vonseiten des Pabel-Verlags analysiert, wo Einsparungspotenziale vorhanden sein könnten. Eine der Maßnahmen, zu denen man sich schließlich entschloss, war, die Honorare für die Zeichner der Serien PERRY RHODAN und ATLAN zu kürzen. Doch nicht alle der davon betroffenen Künstler konnten sich mit den neuen Bedingungen anfreunden. So setzte William Voltz, dem die undankbare Aufgabe übertragen worden war, die Zeichner von der Maßnahme des Verlags in Kenntnis zu setzen und ihre Bereitschaft, auch zu geringerem Honorar weiterzuarbeiten, auszuloten, Walter A. Fuchs am 27. Januar 1981 über die Ergebnisse seiner Gespräche in Kenntnis:
»Die Antworten der Illustratoren sehen so aus:
T. Kannelakis zeichnet nicht weiter (allerdings soll er lt. eigener Aussage im Auftrag von Herrn Bernhardt weiterzeichnen, bis neue Zeichner gefunden sind).
Dirk Geiling zeichnet weiter, möchte aber bei seinen Zeichnungen eine Form entwickeln, die weniger zeitraubend ist, um einen Ausgleich zu erzielen, was das Honorar angeht.
Alfred Kelsner zeichnet weiter.
Die Illustrationen für PR I und IV von Kannelakis liefen direkt über München, so dass ich nicht weiß, wie die Termine stehen.
Die Illustrationen von Geiling und Kelsner für ATLAN laufen über mich, da geht alles klar. Die Illustrationen von Kannelakis für ATLAN laufen direkt über München, so dass ich nicht weiß, was geliefert ist.«
Die Koordination war zu diesem Zeitpunkt insofern sehr schwierig, als sich der Verlag mit Walter A. Fuchs in Rastatt befand, Kurt Bernhardt und die Redaktion aber immer noch in München. Der Cheflektor wehrte sich mit Händen und Füßen gegen eine Übersiedlung nach Baden. Nachdem er zum Jahresende 1981 aus Altersgründen in Pension geschickt worden war, wurde das Münchener Büro aufgelöst und alle verlegerischen Tätigkeiten in Rastatt konzentriert. Bernhardt, der lieber weitergearbeitet hätte, blieb der Serie auch nach seiner Pensionierung verbunden. Seinen Ruhestand konnte er nur jedenfalls nur kurz genießen, denn er starb am 13. Juli 1983 im Alter von nur 67 Jahren.
… und beim Kopieren
Nicht nur bei den Zeichnern wurde gespart, auch in anderen Bereichen wurden Maßnahmen getroffen, die Kosten zu reduzieren. So schrieb Willi Voltz am 31. August 1981 an alle PERRY RHODAN- und ATLAN-Mitarbeiter:
»Das Fotokopieren von Exposés und Romanmanuskripten hat sich für den Verlag zu einem erheblichen Kosten- und Zeitfaktor entwickelt. Es wurden daher einige neue Regelungen getroffen, die vorsehen:
PERRY RHODAN-Manuskripte werden weiterhin fotokopiert und verteilt. Jeder Autor macht fünf Kopien für: Verlag, GMS1, Dolenc, Bruck und WiVo. (Wer eine Kopie seines Romanes behalten möchte, muss sechs Kopien machen). Die genannten Kopien sind direkt und sofort nach Fertigstellung des Romans zu verschicken.
ATLAN-Manuskripte werden nicht mehr fotokopiert. Jeder Autor macht vier Kopien für: GMS, WiVo/Griese, Bruck, Nachfolgeautor (also den, der den Anschlussband schreibt), Wer eine Kopie seines Romanes behalten möchte, muss fünf Kopien machen.
Die Seitenzahl der PERRY RHODAN- und ATLAN-Exposés soll dadurch verringert werden, dass die Papierfläche voll für den Text genutzt wird (Manuskriptform).«
Man sieht also, mit welchen Problemen sich Autoren und Verlag in diesem vor-elektronischen Zeitalter zu Beginn der 1980er Jahre noch herumschlagen mussten. Damals mussten die Kopien mit Kohlepapier hergestellt werden (Kopieren mit Kopierapparaten war noch umständlich und sehr teuer, zudem standen diese normalerweise nur in Firmenbüros, auf Postämtern und dergleichen), dann wurden die Manuskripte eingetütet, und es ging ab zur Post. Danach dauerte es wieder einige Tage, bis die Sendungen beim Empfänger ankamen. Heute ist das eine Angelegenheit von Minuten, mit einem einfachen Mausklick.
Startvorbereitungen für das neue Lexikon
Es war allen Verantwortlichen klar, dass so schnell wie möglich mit den Arbeiten an einem aktuellen Lexikon begonnen werden musste, da seine Erstellung für den oder die damit Betrauten einen enormen Arbeitsaufwand mit sich bringen würde. So wandte sich Kurt Bernhardt in Beantwortung des Schreibens von Peter Griese vom 9. April 1980 an diesen und ersuchte ihn um seine Vorstellungen. Peter Griese antwortete darauf prompt am 11. April:
»Ihr Schreiben vom 9.4.1980 betr. PR-Lexikon habe ich erhalten. Da ich auch schon mit Herrn Voltz über dieses Thema gesprochen habe, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, die man klären sollte, bevor eine neue Arbeit begonnen wird.
Das alte Lexikon ist stark überholungsbedürftig. Daran besteht wohl kein Zweifel. Auch enthält es eine Vielzahl von kleineren Fehlern und Ungenauigkeiten.
Ich weiß aber nicht, ob es richtig wäre, dieses Lexikon nur zu überarbeiten und neu herauszubringen. Natürlich kann ich das machen. Ich vermute aber, dass der große Leserkreis, der im Besitz des alten Lexikons ist, sich das neue überhaupt nicht kaufen wird. Ich räume ein, dass dies nur eine Überlegung ist, da ich nicht weiß, in welchem Umfang sich das alte Lexikon verkauft hat und wie viel Vorrat noch beim Verlag besteht.
Nicht nur aus dieser Überlegung heraus erschient es mir zweckmäßiger, wenn man statt der Überarbeitung von Lexikon I und der späteren Erarbeitung eines Lexikon II (Band 501 bis 1000) einen anderen Weg geht. Dieser Weg wär ein Lexikon, das Band 1 bis 1000 inhaltlich umfasst, also sozusagen das alte Lexikon mit beinhaltet. Die Entscheidung darüber liegt natürlich bei Ihnen. Vielleicht wäre ein klärendes Gespräch mit kompetenten Leuten erforderlich. Man sollte die Meinungen von Herrn Schelwokat und Herrn Voltz wohl dazu hören.
Für ein solches ›Gesamt-Lexikon‹, wie auch für die Überarbeitung des Lexikons I oder für ein Lexikon II schlage ich ferner vor, diese in zwei Teile zu gliedern. Ein (kleinerer) Teil sollte nur die allgemeingültigen Begriffe enthalten und erklären, wie beispielsweise ›Asteroiden‹, ›Schwarze Löcher‹, ›Frequenz‹ etc. Der zweite Teil sollte die reinen PR-Begriffe enthalten. Das wäre die Masse des Inhalts. Auch wäre eine Dreiteilung in
allgemeinwissenschaftliche Begriffe
allgemeine Science-Fiction-Begriffe
PERRY RHODAN-Begriffe
unter Umständen noch zweckmäßiger.
Jedenfalls erscheint es mir unpraktisch und wenig sinnvoll, hinter jedem zweiten Begriff ›ein Begriff aus der PERRY RHODAN-Serie‹ zu drucken.
Falls es bei der Lexikon-I- (neu) und Lexikon-II-Version bleiben sollte, könnte man die allgemeinen Begriffe auch sinnvoll aufteilen. In Anlehnung an den Inhalt der PR-Serie kämen also Begriffe wie ›Black Hole‹ in Band II.
Wie dem auch sei, und was Sie letztlich für zweckmäßig erachten und wünschen, ich bin gern bereit, diese Arbeiten zu machen.«
Man sieht alleine an den hier aufgezählten Möglichkeiten, welcher Entscheidungsprozess schon im Vorfeld abgelaufen ist, bis das neue Lexikon letztlich auf Schiene kam. Die Entscheidung fiel schließlich für ein schon wegen der Fülle des Materials in zwei Silberbände aufgeteiltes Lexikon, das ohne spezielle Kennzeichnung der PR-spezifischen Begriffe auch einige wissenschaftliche mit einschloss und sich auf die PR-Bände 1 bis 1100 bezog. Allerdings wurde nicht Peter Griese mit der Erarbeitung des neuen zweibändigen Lexikons betraut (vermutlich klafften seine Honorarvorstellungen und die des Verlags zu weit auseinander), sondern zwei noch junge Mitarbeiter: Horst Hoffmann und Peter Terrid. Für einen der beiden sollte die erfolgreiche Bewältigung dieser mühseligen und enorm arbeitsaufwendigen Aufgabe einige Jahre später die Berufung zu höheren Weihen bedeuten.
Das PRM nach Gabriel
Das letzte PERRY RHODAN MAGAZIN, das noch unter der Federführung von Helmut Gabriel erschien, war die Ausgabe 11/1980. Für die nächsten drei Nummern war dann wieder Walter A. Fuchs zuständig. Walter Fuchs fungierte zu dieser Zeit als stellvertretender Chefredakteur des Magazins und trug am Verlagssitz in Rastatt die Verantwortung für das Zentral-Sekretariat der PERRY RHODAN-Clubs, für das er im PERRY RHODAN-Report und später auch im PRM das Club-Magazin betreute. Dort stellte er in dem er in loser Folge diverse Fan-Clubs und deren Aktivitäten einer breiten Leserschaft vors. Der Umgang mit den Fans, für etliche Verlagsmenschen eine eher unangenehme Aufgabe, war für ihn kein Problem, war er doch selbst in jungen Jahren im Fandom aktiv gewesen, sowohl als Herausgeber eines Fanzines als auch als Veranstalter einiger Salzburg-Cons in den 70er Jahren. 1982 übernahm er die Aufgaben des pensionierten Kurt Bernhardt und ist heute, nach etlichen Jahren bei Burda und in führenden Positionen des Bauer-Konzerns, Geschäftsführer der Pabel-Moewig Verlag GmbH. Als Interimsherausgeber setzte Walter A. Fuchs schon alleine wegen des bereits angekauften Materials das PRM ganz in der Tradition seines Vorgängers fort, der das Magazin optisch neu gestaltet und versucht hatte, das Periodikum auch für Nicht-PR-Leser interessant zu machen. So hatte Gabriel verstärkt auch Storys und Artikel zu nicht serienspezifischen Themen präsentiert. In Fuchs’ Ausgaben waren neben den regelmäßigen Kolumnen – Editorial und die letzten Folgen des Fortsetzungsromans »Das Weltraumteam« von William Voltz, »Fanzines in Deutschland« von Hermann Urbanek, »Phantome des Schreckens« von Peter Krassa, dem »Clubmagazin« von Walter A. Fuchs und dem von Alfred Vejchar und Hermann Urbanek betreuten Info-Block »SF-MEDIA« – Beiträge von Claude Seignolle, Isaac Asimov, Gene Wolfe, Joe Haldeman, Kurt Mahr, Jesco von Puttkamer, Michael Nagula, Ursula K. Le Guin, Manfred Riepe, Zenna Henderson, Erich von Däniken, Manfred Knorr, Harlan Ellison, Ronald M. Hahn, Jack London, George R.R. Martin und Christian Hellmann. Von besonderem Interesse für die PERRY RHODAN-Leser von heute dürfte nach wie vor auch die 12. Folge der Reihe »Fanzines in Deutschland« sein, in der »Die Uwe Anton Productions« vorgestellt wurden: eine Fülle hochwertiger Fanzines, die der gegenwärtige Exposé- und Chefautor in seiner Jugend herausgegeben hat, beginnend mit GANYMED 1 im Dezember 1970, als Uwe Anton gerade mal vierzehn Jahre alt war. Fanzines, die im Gegensatz zu vielen anderen auch rund vierzig Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch interessant, informativ und gut zu lesen sind.
Mit PR-Bezug gab es außer dem Clubmagazin Storys von Hubert Haensel und Marianne Sydow sowie einen Artikel über »Frauen in PERRY RHODAN« von William Voltz.
Zum Thema »Frauen und die Science Fiction« meinte William Voltz in seinem Editorial im PRM 2/1981:
Einen Beitrag von Ursula K. Le Guin in diesem PRM benutzte Walter A. Fuchs, um mir ein Editorial zum Thema »Die Stellung der Frau in der Science-Fiction« abzuverlangen. Er legte, ohne es zu wollen, einen Finger in eine Wunde, die mir Dutzende Leserbriefe von emanzipationsbesessenen Schreibern geschlagen haben.
Darüber bin ich mir mittlerweile im Klaren: Von allen Patriarchen sind Mitarbeiter der PR-Serie die größten, und weil der William die PR-Handlung entwickelte, ist er konsequenterweise in dieser Schurkenriege der Schlimmste. Jedes Mal, wenn ich in einem amerikanischen Fernsehkrimi den Alibi-Farbigen agieren sehe, denke ich peinlich berührt an die Alibi-Frauen in verschiedenen Voltz-Exposés.
In der modernen SF beginnt die Stellung der Frau (oft genug auch in experimenteller Weise!) sich allmählich zu normalisieren, aber im Allgemeinen leidet die Science Fiction an der »Ursünde«, den gleichen Ideenklischees wie Kriminal- und Westernromane entsprungen zu sein: SF war in den Anfängen, kein Weg geht daran vorbei, sterile Männerliteratur. Man erinnere sich nur an das Aufsehen, das zum Beispiel Philip José Farmer 1952 mit seinem Roman »The Lovers« erregte, als er ein regelrechtes SF-Tabu missachtete und sich dem Thema Sexualität widmete. Heute erscheint uns dieser Roman nicht sehr ungewöhnlich.
Trotzdem halte ich nichts davon, nun mit aller Gewalt auf eine Stellung der Frau in der SF hinzuarbeiten, die von ihrer »normalen« Rolle allzu weit entfernt ist: Wer wollte sich mit derart utopischen weiblichen Wesen noch identifizieren? Entwicklungen verlaufen zäh, und allzu eifrige Verfechter neuer Ideen resignieren oft an ihrer eigenen Ungeduld. Meine Frau (sie nimmt in meinem SF-Bereich natürlich eine exponierte Stellung ein) reagierte auf meine entsprechende Frage gelassen: »Ich werd’ dir schon sagen, wenn mir was nicht passt!« Offensichtlich geht’s an der Basis normaler und zufriedener zu, als man denken möchte. Und nur von dort (Orwell, »1984«) kann eine Veränderung kommen.
Dieses Editorial wurde vor mehr als dreißig Jahren geschrieben, und tatsächlich hat sich seither in diesem Bereich – und nicht nur dort – ich Sachen Emanzipation sehr viel getan. Immer öfter sind Frauen die Protagonistinnen, und die Geschichten werden aus ihrer, der weiblichen Sicht geschildert. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die »Science«, die Wissenschaft, heute einen viel geringeren Stellenwert in der Science Fiction hat als früher und die Themenpalette der Publikationen vielfältiger und bunter geworden ist, die unter dem Label SF zur Veröffentlichung gelangen.
Und was hatte William Voltz zum Dauerbrenner »Stellung der Frau in PERRY RHODAN« zu sagen?
Essay: Frauen in PERRY RHODAN – von William Voltz
Als ich zu ersten Mal davon hörte, dass das Thema dieses PERRY-RHODAN-MAGAZINS den Titel »Frauen in der Science-Fiction« tragen werde, ergriff mich in düsterer Vorahnung schiere Verzweiflung. Ich fürchtete, alle möglichen Abhandlungen und Kommentare schreiben zu müssen. Eine Zeitlang sah es so aus, als käme ich, vom Editorial einmal abgesehen, ungeschoren davon. Trotzdem nahm ich kaum noch Telefongespräche entgegen, ließ Post des Verlages unter fadenscheinigen Gründen zurückgehen und verbreitete skrupellos das Gerücht, mehrere Wochen Urlaub auf den Westindischen Inseln zu machen. Walter A. Fuchs, der für PRM zurzeit das ist, was man in der Fußballsprache als »Interimstrainer« bezeichnet, schaffte es dennoch, mich aufzuspüren und zur Niederschrift dieses Artikels zu überreden. Ich will gar nicht darauf eingehen, welche Register der Überredungskunst er dabei gezogen hat; als er dann noch die Illustrationen von Pierangelo Boog erhielt, traf mich vollends der Schlag. Nicht, dass mir die Bilder nicht gefielen (Erbarmen, genau das Gegenteil ist der Fall!), aber sie sind die Essenz der (Vor-)Urteile, die eine Gruppe von Lesern den Frauen in PERRY RHODAN gegenüber hegt. (Die andere Gruppe findet alle Frauen in PERRY RHODAN steril, und obwohl ich meinen Freund einigermaßen kenne, werde ich nie begreifen, wie eine solche Polarisierung möglich ist!) Was immer wir mit den Frauen in PERRY RHODAN auch anfangen: Es gibt mit Sicherheit jemanden, der sich darüber aufregt und uns heftig kritisiert.
Jeder Leser macht sich natürlich ein eigenes Bild von den Frauen in PERRY RHODAN, so auch Angelo. In der Vorstellungswelt der Autoren sehen sie dabei wieder anders aus. Das mag auch daran liegen, dass der gute Illustrator sich ausgerechnet die Frauen ausgesucht hat, die mit Perry Rhodan verheiratet waren. Es ist schade, dass er nicht Auris von Las Toór (sie fand leider schon in Band Nr. 125 den Tod), Demeter, Irmina Kotschistowa, Betty Toufry oder Tipa Riordan (um nur einige zu nennen) ausgewählt hat, denn er zwingt mich förmlich, besonders auf diese drei Frauen einzugehen. Das Problem, einen Unsterblichen mit einer Sterblichen zu verheiraten, wurde in der PERRY RHODAN-Serie von verschiedenen Autoren mehrfach aufgegriffen; auch ich habe mir die Zähne daran ausgebissen: Zwei, die einander lieben, sehen sich altersmäßig immer wieder auseinanderstreben, ein wahrhaft tragischer Vorgang.
Kurt Brand hat dies in Band Nr. 78 »Thoras Opfergang« zu schildern versucht, für meine Begriffe mit zu viel Seelenschmalz. Erinnern wir uns: Thora war die hochmütige Kommandantin eines auf Luna havarierten arkonidischen Forschungskreuzers. Als Mitglied der auf Arkon regierenden Dynastie Zoltral sah sie in den Menschen der Erde zunächst nur barbarische Wesen. Thora war, so das PERRY-RHODAN-Lexikon, »eine faszinierende Erscheinung, hochgewachsen, mit hellen, fast weißblonden Haaren, ausdrucksvollen Augen mit der für Arkonidinnen charakteristischen goldroten Färbung.« (Etwas später verstieg sich K.H. Scheer übrigens zunehmend auf rothaarige, vollbusige Frauen mit eurasischem Gesichtsschnitt, die ich, nachdem ich die Exposé-Arbeit übernahm, durch schwarzhaarige, etwas schlankere Typen ersetzte. Ich hoffe, man vergibt uns beiden!)
Bei ihrer ersten Begegnung waren sich Perry Rhodan und Thora spinnefeind, die beiden konträren Persönlichkeiten prallten aufeinander wie Feuer und Wasser. Dann, um abermals das Lexikon zu zitieren, »kam es im Verlauf der Jahre zu einem Verstehen, Freundschaftsverhältnis und schließlich zur Eheschließung«. Die Hochzeit zwischen Perry Rhodan und Thora war natürlich die Nachvollziehung eines Klischees, aber jede andere Lösung wäre uns von den Lesern nie verziehen worden.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein nettes Erlebnis während des ersten (und einzigen) PERRY-RHODAN-Cons in Washington. Walter Ernsting (Clark Darlton) und ich bemühten uns um die Gunst einer Amerikanerin, die in der Maske der Thora zum Con erschienen war. Walter, gegen dessen Charme bekanntlich nicht einmal Bulldozer ankommen, schlug mich als Rivalen aus dem Feld, indem er dem Mädchen vorschwindelte, ich sei der »Mörder« Thoras. Daraufhin würdigte sie mich keines Blickes mehr.
Aber auch in unseren Landen fand der Tod Thoras wenig Beifall. Zum Glück ließen wir uns von den Lesern nicht zu einer Wiederauferstehung überreden, wie dies z. B. bei der Figur des Roi Danton gründlich misslungen ist. Jedes Mal, wenn eine bekannte Person aus der PERRY-RHODAN-Serie stirbt, geht ein Proteststurm durch die Reihen der Leser, bei Thora war er jedoch besonders stark. (Ich stelle mir gerade vor, was passieren würde, wenn ich Gucky sterben ließe!)
Nach Thoras Tod trauerte unser Held eine Zeitlang – bis er sein Augenmerk auf eine neue Favoritin richtete, die Plophoserin Mory Abro, eine Tochter Lord Abros, des Neutralistenführers von Plophos. Auch sie war eine faszinierende Erscheinung, groß, schlank, mit rotblonden Haaren, weißer Haut und grünen Augen. Ihr Charakter wurde als »explosiv« bezeichnet, und was immer man darunter verstehen mag, ich bin froh, dass meine Frau nicht explosiv ist.
Mit fünfundzwanzig Jahren wurde Mory Abro Nachfolgerin des Obmanns von Plophos, Iratio Hondro. Sie erhielt den Zellaktivator des Diktators Hondros, was sie allerdings nicht vor dem Tod bewahrte. Nachdem sie Perry Rhodan im Jahre 2329 heiratete und ihm zwei Kinder schenkte (auch so eine blödsinnige Ausdrucksweise), starb sie zusammen mit ihrer Tochter Suzan Betty Rhodan während des Panither-Aufstands im Jahre 2931 auf Plophos. Das zweite Kind war der schon erwähnte Roi Danton alias Michael Rhodan. Übrigens gilt es, den Nachwuchs zu komplettieren: Aus Perry Rhodans Ehe mit Thora ging ebenfalls ein Sohn hervor, Thomas Cardif, ein regelrechter Revoluzzer. Ich muss meinen Kollegen Respekt zollen, die damals Cardif als einen Menschen darstellten, der wegen verweigerter Elternliebe auf die schiefe Bahn geriet.
Das Pech mit den Frauen blieb dem damaligen Großadministrator des Solaren Imperiums also treu. Wollen wir ihm aber zugestehen, dass er, wie jeder halbwegs vernünftige Mann, fürderhin nicht im Zölibat lebte, wenn auch in der PERRY-RHODAN-Serie solche Abenteuer kaum je Erwähnung finden.
Kommen wir zur Ehefrau Nummer drei. Orana Sestore war Chefin einer Forschungsstation im Plejadensektor und, laut Exposé, »mittelgroß, schlank, vollbusig, mit einer Haut wie zartes Elfenbein! (Ausrufezeichen vom Verfasser dieses Artikels), langen, tiefschwarzen Haaren und dunkelblauen Augen.« Diese bildschöne Frau war schon einmal verheiratet gewesen, und zwar mit dem Experimentalphysiker Dr. Sestore. In der PERRY RHODAN-Serie tauchte sie erstmals in Band Nr. 550 auf. Später heirateten Perry Rhodan und Orana. Diese Frau spielte eine ungewollt tragische Rolle, als sie vom Konzil (um die Bände 656 bis 660) als lebende Bombe missbraucht werden sollte. Orana starb in den Wirren des Mahlstromes, ohne dass Perry Rhodan jemals im Detail Aufschluss über ihr Schicksal erhielt. Kein Wunder, dass unser dreimal vom Schicksal gebeutelter Held bis ins Jahr 424 Neuer Galaktischer Zeitrechnung keine weiteren festen Bindungen mehr einging. Doch das ist nicht endgültig.
Ein weiteres »faszinierendes« weibliches Wesen besteht zumindest schon in Exposéform; und es wird die dramatischste Beziehung werden, die Perry Rhodan je zum anderen Geschlecht knüpfte. Mehr jedoch will und darf ich an dieser Stelle nicht verraten. (Nur im Manuskript: Ich bin froh, dass Angelo von dieser noch nicht im Detail ausgearbeiteten Figur kein Bild gemalt hat – die Konsequenzen wären nicht übersehbar.)
Eines steht jedenfalls fest: Die Frauen in und um PERRY RHODAN sind und bleiben ein unerschöpfliches Thema, so oder so.
(Auszug aus: SF-PERRY RHODAN MAGAZIN 3/1981)
Bei dieser überaus beeindruckenden Frau handelte es sich, wie die langjährigen Leser der Serie wissen, um niemand anders als Gesil, die zweite Inkarnation der Kosmokratin Vishna, mit der Perry Rhodan im Jahr 426 NGZ einen unbefristeten Ehevertrag eingeht; dieser Verbindung entstammt die gemeinsame Tochter Eirene, die sich in der Folge dazu entschließt, ihren Kosmokratennamen Idinyphe anzunehmen. Und Gesil sollte beileibe nicht die letzte Frau an Rhodans Seite sein.
Natürlich war allen Beteiligten klar, dass Walter A. Fuchs neben seinen anderen Aktivitäten für den Verlag trotz aller Unterstützung nicht nebenbei auch noch das PERRY RHODAN MAGAZIN herausgeben konnte, und so wurde ein neuer Chefredakteur gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf Hans-Jürgen Frederichs, der schon als Herausgeber des professionell vertriebenen SFCD-Magazins ANDROMEDA erste Erfahrungen in diesem Metier gesammelt hatte.
ANDROMEDA – Das Profi-Magazin
Seit Walter Ernsting 1955 den Science Fiction Club Deutschland e.V. gegründet und die erste Ausgabe des neuen Club-Magazins ANDROMEDA herausgegeben hatte, hatte dieses zahlreiche Höhen und Tiefen durchlaufen. Zumindest ein regelmäßiges Erscheinen war von 1975 an durch wechselnde Redaktionen in Deutschland und Österreich gewährleistet. Und dann griff die Überlegung Raum, den SF-Boom, der sich abzuzeichnen begann, auszunützen und ANDROMEDA einem größeren Publikum als nur den Vereinsmitgliedern zugänglich zu machen. Und so war im Editorial von ANDROMEDA 96, der Ende 1978 in den Handel gebrachten ersten flächendeckend erhältlichen Ausgabe, zu lesen:
»Im August dieses Jahres beschloss die Mitgliederversammlung (des SFCD) in Marburg auf Vorschlag des Vorstandes, ANDROMEDA Hans-Jürgen Frederichs zu übertragen und damit in den freien Handel zu bringen. Hans-Jürgen Frederichs, schon seit langem im Verlagsgewerbe tätig und Profi in Entwicklung und Konzeption von Zeitschriftenobjekten, verspürte schon lange die Lust, ›mal ein Blatt zu machen, das auch meinen persönlichen Neigungen entspricht und nicht nur vom Kommerz diktiert wird.‹
Und er fand auch zwei Partner, Eberhard Bode und Ralf H. Grosshans, die ebenso wie er Spaß an der Sache haben und mit ihm das verlegerische Risiko teilen. Alle Beide sind vom ›Fach‹. Eberhard Bode als Vertriebsleiter und Druckspezialist und Rolf H. Grosshans als Redakteur, der lange mit SF zu tun hatte und früher selbst SF-Romane für den Pabel-Verlag schrieb.
Und mit von der Partie ist natürlich Jürgen Mercker, erster Vorsitzender des SFCD, der die Koordination zwischen dem bewährten alten Redaktionsstab und der neuen Verlagsleitung übernommen hat.«
In Marburg waren auch schon die Aufgabenbereiche der vom SFCD gestellten Redakteure aufgeteilt worden. Der Stab setzte sich aus dem Chronisten Hermann Urbanek (Storys), Viktor Farkas (Wissenschaftliche Artikel), Helmut Magnana (Literarische Artikel), Alfred Vejchar (Kritiken), Eva Bartoschek (Grenzwissenschaften), H.-J. Ehrig (Comics), Robert Christ (Galerie) und Peter Ripota (Nachrichten) zusammen. Das Team wurde aus der Profi-Szene sehr tatkräftig unterstützt und lieferte das erbetene Material, auch wenn dafür kein Honorar gezahlt werden konnte. So konnten in den ersten drei Ausgaben Storys von Kai Riedemann, Clark Darlton (eine ursprünglich fürs PRM gedachte und von G. M. Schelwokat abgelehnte PR-Story) und Peter Griese sowie Künstlerporträts von H.R. Giger, Virgil Finlay und Helmut Wenske neben Interviews und Artikeln veröffentlicht werden. Doch der Erfolg hielt sich in Grenzen, und die anfänglich relativ kleinen Differenzen zwischen Redaktion und dem neu gegründeten ANDROMEDA-Verlag wurden immer größer. Die Ausgabe 99 war dann nur mehr eine Sparnummer, die lediglich an die Clubmitglieder ging (der Story-Reader enthielt Kurzgeschichten von Günter Zettl, William Voltz, Kai Riedemann, Georg Mackowiack und Wolfgang Hohlbein, einen SF-Comic von Michael Götze und eine Galerie von Thomas Franke), während Hans-Jürgen Frederichs ein neues Konzept für das Magazin ausarbeitete, diesmal ohne Mitsprache des SFCD und mit völlig neuem Redaktionsstab. Als er die Nummer 100 dann zum Jahresende 1979/80 herausbrachte, kündigte der SFCD den Vertrag mit ihm und gibt seitdem das Club-Magazin wieder nur für seine Mitglieder heraus. H.J. Frederichs brachte im Sommer 1980 im 3. Jahrgang noch eine ANDROMEDA-Ausgabe 1/1980 heraus, doch blieb es bei dieser einen Ausgabe. Damit war ein weiterer Versuch, ein flächendeckend vertriebenes SF-Magazin auf dem deutschen Markt zu etablieren, gescheitert.
PRM – Countdown zum Finale
Im PERRY RHODAN MAGAZIN 3/1881 wurde dann mit Verspätung bekanntgegeben, dass Helmut Gabriel aus der Redaktion ausgeschieden sei, um sich künftig anderen Aufgaben zu widmen. Als neuer Chefredakteur wurde Hans-Jürgen Frederichs vorgestellt, die Ausgabe präsentierte sich in einem neuen, offeneren Layout. Im inhaltlichen Bereich hingegen gab es nur wenige Änderungen. So blieben die einzigen Bezüge zur größten Weltraumserie das Clubmagazin und eine Story von Ernst Vlcek. Neu hinzu kamen der Fortsetzungsroman »Die Galaxis Rangers« von Harry Harrison, dessen Autorenporträt der heutige Literaturpapst Denis Scheck beisteuerte, sowie die Artikelserie »Space Rock« über phantastischen Rock von Joachim Körber. Gleich blieb der Mix aus Storys und Artikeln, diesmal von Clark Ashton Smith, Ed Naha, Herbert W. Franke, Robert Bloch, Frederic Golden, Ernst Vlcek, Christian Hellmann und Manfred Riepe verfasst, dazu gab es eine Galerie zum Thema »Raumschiffe« sowie eine weitere mit Werken von Hubert Schweizer. Auch in den folgenden drei Ausgaben kam es zu keinen größeren inhaltlichen Änderungen. So wurden Autorenporträts von Philip K. Dick, Ray Bradbury, M. Lucie Chin und William Morris ebenso veröffentlicht wie Storys von A. Merritt, Philip K. Dick, William Morris und Jack Vance, Artikel von Uwe Luserke, Michael Nagula und Manfred Riepe, Peter Krassa, Christian Hellmann, Isaac Asimov, Jesco von Puttkamer, Erich von Däniken, Heinz J. Galle, es gab SF-MEDIA, das Clubmagazin sowie PR-Storys von Clark Darlton und Ernst Vlcek und eine ATLAN-Story von Hans Kneifel.
Dass es mit dem Magazin nicht zu Besten stand und ihm offenbar weniger Aufmerksamkeit bei der Produktion geschenkt wurde, das war erstmals zu bemerken, als man bei Ausgabe 4/1981 kräftig schlampte und in der Inhaltsangabe einige der Beiträge anstelle des Autornamens mit einem Fragezeichen versehen waren. Im Heft 6/1981 war es dann traurige Gewissheit: Das PERRY RHODAN MAGAZIN war mit der 28. Ausgabe eingestellt worden. Es war damit zwar das am längsten laufende SF-Periodikum im deutschen Sprachraum, das auf professioneller Basis erschienen ist, aber das war kein Trost. Im Editorial der letzten erschienenen Ausgabe las sich das dann so:
»Mit dieser Ausgabe, die schwerpunktmäßig der Fantasy gewidmet ist, präsentiert sich das PERRY-RHODAN-MAGAZIN zum letzten Mal in seiner monatlichen Erscheinungsweise. Das PRM soll in Zukunft in größeren Zeitabständen unregelmäßig erscheinen. Wir werden Sie davon rechtzeitig in den SF-Objekten des Pabel-Verlags informieren.«
Normaler Weise bedeuten solche Worte das endgültige Aus. Doch nicht so im Fall des PERRY RHODAN MAGAZINS. Hier gab es tatsächlich ein Fortsetzung, oder besser gesagt: deren zwei! Die erste wurde als Sonderausgabe 1/1998 anlässlich des Starts des Thoregon-Zyklus herausgebracht und war schwerpunktmäßig tatsächlich ein wirkliches »PERRY RHODAN«-Magazin, auch wenn einige andere Themen behandelt wurden. So fanden sich Artikel über die Zukunft der bemannten Raumfahrt, Roboter im Einsatz, das SETI-Projekt und die TV-Serie »Babylon 5«. Ansonsten PERRY RHODAN pur: eine Vorstellung der Zyklen sowie der neuen Illustratoren und des aktuellen Autorenteams, Infos über multimediale Neuerscheinungen, ein Künstlerporträt von Johnny Bruck und ein Porträt von Forrest J. Ackerman, ein Auszug aus PR-Band 1900 und viele interessante Dinge mehr. Und die zweite kam im September 2001 zum 40-jährigen Bestehen der PERRY RHODAN-Serie heraus und enthielt neben einer exklusiven Rhodan-Story von Andreas Eschbach Beiträge von Robert Feldhoff, Klaus N. Frick, Frank Borsch, Torsten Dewi, Rüdiger Vaas, Ulrich Bettermann, Florian Breitsameter und Hannes Riffel & Birgit Will. Wie heißt es doch: Aller guten Dinge sind drei! Lassen wir uns also überraschen, wann das dritte unregelmäßige PRM die Fans und Leser auf grandiose Neuigkeiten rund ums RHODAN-Universum noch neugieriger macht!
Neue Aufgabenverteilung
Willi Voltz hatte zwar die Exposéredaktion für den neuen ATLAN-Zyklus übernommen, aber er wollte die neuen Abenteuer der SOL nur richtig auf Schiene bringen. Er hatte nicht die Absicht, sich länger als seiner Meinung nach erforderlich mit dieser zusätzlichen Arbeit zu belasten. Deshalb informierte er Kurt Bernhard in einem Schreiben vom 14. Januar 1981, wer für welche Exposébereiche künftig zuständig sein werde und wie die Zusammenarbeit und Abstimmung funktionieren sollte:
»Ab Nr. 510 schreibt Frau Marianne Ehrig wieder die ATLAN-Exposés … Meine Arbeit besteht in der Koordination der PERRY RHODAN- und ATLAN-Serien, d.h., ich muss mit Frau Ehrig die ATLAN-Handlung absprechen, ihre Exposés lesen und nötigenfalls korrigieren. Auch die ATLAN-Romane müssen von mir gelesen und nötigenfalls im Sinne von PERRY RHODAN korrigiert werden. Darüber hinaus bestimme ich die Autoreneinsätze und kümmere mich um die Termine bei ATLAN. Auch die Beschaffung von Innenillustrationen mit dem Einsatz der Zeichner gehört zu meinen Aufgaben.«
Marianne Sydow, die den Berliner Fan und Sammler Heinz-Jürgen Ehrig geehelicht hatte, war allerdings – vorläufig – nur ein halbes Jahr für die ATLAN-Exposés zuständig, dann übernahm Peter Griese Exposé-Redaktion.
ATLAN-Jubiläum und Neustart
Im Vorjahr hatte PERRY RHODAN das große Jubiläum zum Erscheinen von Band 1000 gefeiert, jetzt stand für Ende April 1981 das nächste Jubiläum an: der ATLAN-Band 500. Nachdem der sehr fantasylastige Vorgänger-Zyklus um Atlantis und den Dunklen Oheim bei den Lesern auf wenig Gegenliebe gestoßen war, sollte die Serie wieder zurück zu ihren Wurzeln geführt werden. Und da bot sich eine Thematik an, die bei PERRY RHODAN sehr gut angekommen war und sich auch bei ATLAN größerer Beliebtheit erfreuen sollte: das Generationenraumschiff SOL. William Voltz verfasste ein Arbeitspaper und veröffentlichte es auf den Leserseiten aller SF-Publikationen des Verlags, so auch Mitte April 1981 in TERRA ASTRA 503.
Essay: Die Abenteuer der SOL – Von William Voltz
Ebenso wie die PERRY RHODAN-Serie ist auch die ATLAN-Serie in Handlungszyklen unterteilt, allerdings nach einem völlig anderen Schema. In PERRY RHODAN ist der Ablauf der Zyklen ein chronologischer, das heißt, trotz verschiedener Zeitsprünge wird die Geschichte der Menschheit kontinuierlich fortgesetzt. Bei der ATLAN-Serie stellen wir jeweils wichtige Abschnitte im Leben des Arkoniden Atlan heraus. Das begann mit dem Zyklus »Im Auftrag der Menschheit«, in dem jene Epoche geschildert wurde, in der Atlan als Lordadmiral der United Stars Organisation (USO) der Menschheit zur Seite stand. Im zweiten Zyklus, »Der Held von Arkon«, wurden die Jugenderlebnisse des Arkoniden geschildert. Nun geht in diesen Tagen mit den Bänden Nr. 498 und 499 der dritte Zyklus in der ersten Auflage der ATLAN-Serie zu Ende. Er hieß »Der König von Atlantis« und schilderte in einer Mischung von Science Fiction und Fantasy die Abenteuer Atlans auf dem verlorenen Kontinent Atlantis.
Nachdem wir bei der PERRY RHODAN-Serie vor einigen Monaten mit Band Nr. 1000 ein großes Jubiläum feiern konnten, ist nun die ATLAN-Serie mit Band 500 an der Reihe. Natürlich wird dieser Jubiläumsband in einer Sonderausstattung erscheinen, mit umlaufendem Titelbild, erweitertem Umfang usw. Das Wichtigste jedoch ist, dass mit diesem Jubiläumsband in der ATLAN-Serie ein völlig neuer Zyklus beginnt. Sein Titel ist »Die Abenteuer der SOL«. Insider haben, nachdem sie diesen Titel gehört haben, geargwöhnt, wir könnten die Serien PERRY RHODAN und ATLAN so eng miteinander verknüpfen, dass für den Leser zum Verständnis einer Serie die Lektüre beider Serien nötig ist. Diese Bedenken habe ich auf verschiedenen Leserkontaktseiten schon zerstreut, aber ich will an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass kein RHODAN-Leser die ATLAN-Serie lesen muss (und umgekehrt), um »seine« Serie zu verstehen. Zwar baut der neue Zyklus, der ab Nr. 500 beginnt, auf dem RHODAN-Material auf, aber er ist völlig in sich abgeschlossen. Auch der Zyklus »Im Auftrag der Menschheit« war schließlich eng an die PERRY-RHODAN-Serie angelehnt, ohne dass er zum besseren Verständnis dieser Serie von RHODAN-Lesern gelesen werden musste.
Worum geht es also in diesem neuen Zyklus? Die SOL ist bekanntlich das größte Fernraumschiff (wenn man die BASIS, die ja eine völlig andere Geschichte hat, einmal ausklammert), das jemals von der Menschheit gebaut worden ist. Die RHODAN-Leser werden sich erinnern, dass Perry Rhodan die SOL im Dezember des Jahres 3586 an die Solgeborenen abgeben musste. Die Solgeborenen waren Menschen, die an Bord des riesigen Schiffes »zur Welt« gekommen waren und es als ihr rechtmäßiges Eigentum betrachteten. Diese Menschen hatten zunehmend Schwierigkeiten, sich außerhalb des Schiffes, z.B. auf Planeten, zurechtzufinden. Sie beanspruchten die SOL, um zukünftig ausschließlich an Bord zu leben. Rhodan gab diesen Wünschen nach, und am 24. 12. 3586 brach die SOL mit ihrer ausschließlich aus Solgeborenen bestehenden Besatzung mit unbekanntem Ziel auf. (Dies wurde von Marianne Sydow in PERRY-RHODAN-Band Nr. 907 »Das Weltraumbaby« erzählt.)
In der PERRY-RHODAN-Serie taucht die SOL ab Band 1001 zunächst als Mythos, später als (wenn auch nicht mehr komplettes) Fernraumschiff wieder auf – man schreibt das Jahr 4012 alter Zeitrechnung. Die SOL blieb also über 400 Jahre aus der Handlung der RHODAN-Serie verschwunden. Atlan, unser Held, verschwand im November des Jahres 3587 ebenfalls vorübergehend aus der PERRY-RHODAN-Serie (erzählt von William Voltz in PERRY-RHODAN-Band Nr. 982 »Der Auserwählte«). Er wurde von den Kosmokraten in das Gebiet jenseits der Materiequellen geholt. Ebenso wie die SOL tauchte Atlan indirekt ab Band Nr. 1002 bereits wieder in der PERRY-RHODAN-Serie auf. Bald wird er dort wieder unmittelbar am Geschehen teilnehmen.
Die Handlung des neuen Zyklus, der in Band Nr. 500 der ATLAN-Serie beginnt, spielt in den Jahren 3791 – 3810, in einer Zeit also, in der weder die SOL noch Atlan in der PERRY-RHODAN-Serie eine Rolle spielten. Es wird sich nun ab Band Nr. 500 herausstellen (die RHODAN-Leser wissen es spätestens seit dem Band Nr. 1014 der PERRY-RHODAN-Serie), dass die SOL und Atlan sich in einem gemeinsamen großen Abenteuer im Einsatz befanden. Unser neuer ATLAN-Zyklus »Die Abenteuer der SOL« beginnt am 4. März 3791 alter Zeitrechnung. Seit über 200 Jahren haben sich die Solgeborenen von der übrigen Menschheit getrennt und sind ihre eigenen Wege gegangen. Über 200 Jahre ist es her, seit Perry Rhodan den Solanern das große Schiff zur Verfügung stellte, damit sie ihren eigenen Neigungen nachgehen und ihre Entwicklung ungestört vorantreiben konnten.
Doch die optimistische Stimmung der Solaner ist längst verflogen, das riesige Schiff wird seit Jahren von heftigen Krisen geschüttelt; völlig neue Gruppierungen haben sich an Bord gebildet – Machtkämpfe zwischen den einzelnen Parteien sind im Gang. Noch schlimmer: SENECA, die allwissende Bordpositronik mit ihrem Roboterpärchen Romeo und Julia, erledigt die ihr zugewiesenen Aufgaben nur noch fehlerhaft und unvollkommen, ohne dass der Grund des Schadens erkannt werden kann. Zu allem Überfluss ist die SOL vor einiger Zeit in eine gigantische kosmische Falle geraten: Sie sitzt fest im Traktorstrahl eines fremden Planeten, der sie, zusammen mit kosmischem Müll und anderen eingefangenen Raumschiffen, in ein unheimliches Sonnensystem hineinzieht. Außerhalb der SOL operieren einige Buhrlos. Das sind jene Menschen, die sich aufgrund einer evolutionären Entwicklung ohne Schutzanzug im Vakuum aufhalten können. Während ihres Aufenthalts im Weltraum laden sie sich wie lebendige Akkumulatoren mit einer geheimnisvollen, angeblich lebensverlängernden Energie auf – dem E-kick. Doch sie repräsentieren nur einen Teil der bunt zusammengewürfelten Bordgemeinschaft, die mittlerweile 92.340 Mitglieder zählt.
Kein Wunder, dass bei dieser Zahl der Kampf um das tägliche Überleben an Bord der SOL bestimmend ist. Beherrscht wird die SOL in diesen Tagen von dem Ehernen Orden unter der Führung des High Sideryt. Der High Sideryt ist der Diktator Chart Deccon, für den Magniden, Ferraten, Trolliten, Pyrriden, Ahlnaten und Vystiden (alles Brüder der verschiedenen Wertigkeit) arbeiten und seine Macht ausdehnen. Eine andere Machtgruppe sind die Terra-Idealisten, die den Mythen und Legenden der Urheimat Erde anhängen und das Schiff dorthin zurückbringen wollen. Dazu kommen die Monster, ausgestoßene körperliche Mutanten. Ebenfalls an Bord der SOL leben die Extras, Außerirdische, die bei verschiedenen Besuchen auf Planeten an Bord genommen wurden. Im Augenblick des Handlungsbeginns noch nicht aktiv sind die Schläfer, geheimnisvolle Wesen aus vergangenen Tagen der SOL, die nur im äußersten Notfall geweckt werden sollen.
Während die SOL unaufhaltsam in das fremde Sonnensystem treibt, findet das unverantwortliche Spiel um Macht und Gewinn an Bord seinen Fortgang, niemand scheint da, der das Schiff vor allen Bedrohungen retten könnte. Da entdecken einige Weltraummenschen, die Buhrlos, mitten in den dahintreibenden Trümmern im All eine menschliche Gestalt im Raumanzug. Auch sie scheint von dem unwiderstehlichen Traktorstrahl ergriffen worden zu sein. Die Buhrlos retten den Unbekannten und bringen ihn in die SOL. Es ist ein schlanker, großer Mann mit rötlichen Augen und langen silbernen Haaren – Atlan!
Kaum, dass Atlan an Bord der SOL ist, beginnt er seinen einsamen Kampf um die Rettung des Schiffes. Er weiß, dass er die verschiedenen Gruppen befrieden und auf jenes neue Ziel einschwören muss, das die Kosmokraten ihm genannt haben: Varnhagher-Ghynnst. Diesen Raumsektor muss die SOL unter allen Umständen erreichen, wenn sie den Auftrag der Kosmokraten ausführen will. Atlan stellt sich der schier unlösbar erscheinenden Aufgabe, die SOL aus der Falle zu befreien, die Krisen an Bord zu bewältigen und schließlich das Schiff auf einen neuen Kurs zu bringen, der zu einer langjährigen Odyssee der SOL werden kann.
Dies ist, im großen Rahmen und ohne im Interesse der Spannung viel zu verraten, die Geschichte, die in ATLAN Nr. 500 »Die Solaner« von William Voltz beginnt. Es handelt sich um einen SF-Zyklus ohne Fantasy-Einschlag.
Nachdem die Buhrlos auf einem ihrer Weltraumspaziergänge den bewusstlos im All treibenden Arkoniden Atlan gefunden und an Bord der SOL gebracht haben, ist dieser in den nächsten Monaten in erster Linie damit beschäftigt, das Generationenschiff aus der Falle, in die es geraten ist, zu befreien und an Bord wieder geordnete Verhältnisse zu schaffen. Dann nimmt er mit der SOL Kurs auf sein neues Ziel Varnhagher-Ghynnst, dessen Koordinaten ihm die Kosmokraten in seinem Gehirn eingespeichert haben. Doch der Flug verläuft nicht ohne Komplikationen, denn immer wieder versuchen feindliche Kräfte, ihn an der Erfüllung seiner Aufgabe zu hindern. Als Erstes kristallisiert sich HIDDEN-X als gefährlicher Gegenspieler heraus, eine Spiegelung der negativen Superintelligenz Seth-Apophis, die neue Raumgebiete für ihr Original vorbereiten soll, das dabei ist, sich in eine Materiesenke zu verwandeln und das verhindern will, indem es sich Teile der Mächtigkeitsballung der positiven Superintelligenz ES aneignet und mit den dort gesammelten positiven Energien auflädt.
Ein neuer Autor für ATLAN
Mit Band 501 gab ein neuer Autor bei ATLAN sein Debüt, der sich binnen kurzem zu einem der wichtigsten Autoren der PERRY RHODAN-Schwesterserie entwickelte und etliche Jahre auch ihren weiteren Handlungsverlauf bestimmte oder zumindest mitbestimmte. Dabei war er zu diesem Zeitpunkt im PERRY RHODAN-Universum schon längst kein Unbekannter mehr, denn sein erster Beitrag zum Perryversum war bereits 1977 unter dem Titel »Das Erbe der Pehrtus« erschienen. Sein Name: Peter Griese!
Kurzbiografie: Peter Griese
Peter Griese wurde am 2. Juni 1938 in Frankfurt am Main geboren und wuchs in der Nähe des Tegernsees auf. Schon als Schüler war Griese ein begeisterter Leser, doch damals stand die SF noch nicht im Mittelpunkt seines Interesses: »Am Anfang war der Wildwestroman; mit zehn und elf Jahren las ich BILLY JENKINS, TOM PROX oder KANSAS-JACK. Mit zwölf Jahren entwarf ich eine eigene Serie, DIN-A 7, alles per Hand gezeichnet und geschrieben. Auflagenhöhe: 1. Immerhin kam die »Serie« BEN EVING bis Band 18! Dann spielte mir der Zufall ein Heft RAH NORTON – DER EROBERER DES WELTALLS Nr. 4 – »Der rote Baldachin« – in die Hände, Nach der Lektüre verbannte ich alle Wildwestromane in die Abstellkammer und ging mit meinem Bruder Erhard der Herkunft des Heftchens nach (…). Das war etwa 1951/52. Das Samenkorn für den SF-Fan war gelegt. Griese studierte an der Fachhochschule Neubiberg Elektrotechnik, schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur ab und war von 1959 bis 1986 bei der Bundeswehr tätig. Ausbildung und eine erste Ehe verhinderten weitere eigene schriftstellerische Aktivitäten vorerst ebenso wie andere Hobbys, darunter Angeln und Amateurfunk. Zum Schreiben kam Peter Griese dann durch die PERRY RHODAN-Serie, die er mit einigen Unterbrechungen vom Start weg mitverfolgt hatte. Ein Aufruf von William Voltz auf der LKS, ihm Amateurkurzgeschichten zur eventuellen Veröffentlichung zu senden, führte zum Verfassen zweier Storys, die 1975 publiziert wurden. Ein Probemanuskript wurde nach einigen Überarbeitungen von Günter M. Schelwokat angenommen, der den Roman 1977 in TERRA ASTRA unter dem Titel »Im Bann der Psi-Intelligenz« heraus brachte. Star-Agent Thor Delgado und die Geheimdienstorganisation SEDOR standen auch mit Mittelpunkt der Folgeromane »Die Intelligenzfresser«, »Invasion der Symbionten«, »Am Tag der sechs Monde«. »Das Energie-Labyrinth«, »Mann aus der Tiefe« und »Als die Sonne erlosch«. Nicht zu diesem SF-Agentenzyklus gehören die zusammenhängenden Romane »Die unsichtbare Grenze« und »Der galaktische Bote«. Die meisten seiner Kurzgeschichten sind in den Sammlungen »Er kam aus der Sonne«, »Sturz in die Vergangenheit« und »Mondgeschichten« enthalten. Nachdem er 1977 mit dem PLANETENROMAN »Das Erbe der Pehrtus« sein Debüt im Perryversum gegeben hatte, wurde er von Willi Voltz beauftragt, die Schlussauswahl der zum Thema »Psi in PERRY RHODAN« eingereichten Leserstorys durchzuführen und die besten Beiträge dieses Wettbewerbs in einem PR-Taschenbuch zu präsentieren – das war »Unternehmen Psi« (1978). Weitere Romane in der Taschenbuchreihe folgten, wobei er bevorzugt Themen aufgriff, die in der PERRY RHODAN-Heftserie – und später auch bei ATLAN – seiner Meinung nach nicht ausführlich genug behandelt worden waren, wie »Das Tor zur Tiefe«, »Welt der Flibustier«, »Findelkinder der Galaxis«, »Die Weltraummenschen«, »Paladin«, »Ultimatum für Terra«, »Geheimprojekt der Hyptons«, »Der Zeitkäfig« und »Der lange Weg der SOL«. In den PERRY RHODAN-Jubiläumsbänden war Griese ab Band 2 regelmäßig vertreten.
Im Jahr 1980 wurde Peter Griese ins Autorenteam von PERRY RHODAN berufen. Sein erstes PR-Heft war Band 963, »Mission der Flibustier«, und er schrieb zunächst bis Band 1065, also ziemlich genau zwei Jahre lang, an der Serie mit. 1981 wurde er von William Voltz, der gerade den Zyklus »Die Abenteuer der SOL« für ATLAN konzipierte und die Exposés gestaltete, aufgefordert, auch an der zweiten SF-Serie des Verlags mitzuschreiben, wo mit Band 501 »Die Terra-Idealisten« sei erster Beitrag erschien. Noch im gleichen Jahr erhielt er das Angebot, die Exposé-Redaktion von ATLAN zu übernehmen, was ab Band 533 erfolgte. Um in die Serie etwas frischen Schwung zu bringen, wurde er mit Band 698 von Marianne Sydow als Exposé-Schreiber abgelöst, um von Band 708 bis 764 mit ihr im Team die Wege der Serie zu steuern, bis Marianne Sydow ihrerseits durch H.G. Ewers ersetzt wurde. Mit ihm konzipierte Griese die Handlung bis zur Einstellung der Serie mit Band 850, einem von beiden gemeinsam geschriebenen Roman. Einige noch offen gebliebene Themen der ATLAN-Serie arbeitete Griese in der Folge in den PR-Taschenbüchern »Der lange Weg der SOL« und »Am Rand des Universums« auf. Nach dem Tod von William Voltz im Jahr 1984 wurde Griese vom damaligen PERRY RHODAN-Redakteur Horst Hoffmann wieder ins PR-Autorenteam zurückgeholt und feierte mit Band 1240 »Kampf um das Technotorium« seinen Wiedereinstieg. In den Folgejahren war er ein regelmäßiger Mitarbeiter bei PR, weshalb für ihn die Einstellung der ATLAN-Serie nicht so existenzbedrohend war wie für etliche seiner Autorenkollegen. Trotzdem traf sie ihn schwer, weil er bei der Bundeswehr seinen Abschied genommen hatte, um sich ausschließlich dem Schreiben zu widmen. Nach dem Tod von Kurt Mahr übernahm Griese 1993 den PERRY RHODAN COMPUTER, 1994 auch den PERRY RHODAN REPORT. In der Nacht vom 28. auf den 29. April 1996 starb Peter Griese völlig überraschend in Bad Ems, wo er mit seiner zweiten Frau und den beiden Kindern in den letzten Jahren gelebt hatte, an Herzversagen. Sein letzter Roman »Flucht durch Bröhnder« lag zu diesem Zeitpunkt erst zum Teil vor; er wurde von Robert Feldhoff fertig geschrieben und erschien posthum als Band 1827.
Kein neuer Autor für ATLAN
In der Vorschau von ATLAN 514 wurden die Leser darauf aufmerksam gemacht, dass der Folgeband von einem neuen ATLAN-Autor stammen werde. Und tatsächlich betrat in diesem Heft ein neuer Autor die Bühne: Wilfried A. Hary. Was aber niemand zu diesem Zeitpunkt wusste: Es sollte sein einziger Beitrag für das PERRY RHODAN-Universum bleiben, gewissermaßen ein Gastroman. Das war allerdings nichts zu erwarten gewesen, nachdem Hary im Jubiläumsband noch euphorisch gemeint hatte, er freue sich schon auf die Schilderung der Abenteuer des »Beuteterraners«.
Nun, das war vor oder während seiner Arbeit an ATLAN 515. Daraufhin befragt, warum es bei diesem Gastspiel geblieben sei, antwortete er dem Chronisten dieses Bandes am 5. September 2012 per Mail:
»Was meinen ATLAN betrifft: Ich war vorgesehen für das PR-Team. Der ATLAN sollte mein Einstiegsband werden. Danach sollte ich noch den einen oder anderen schreiben, ehe ich endgültig Mitglied im Hauptteam werden sollte. So war das damals mit Schelwokat abgemacht. Er kannte mich ja von TERRA ASTRA und wollte mich unbedingt als PR-Autor haben. Als der Roman entstand, hatte ich monatelanges PR-Studium hinter mir. Dennoch quälte mich jeder einzelne Satz, weil ich ständig Angst hatte, etwas falsch zu machen. Immerhin hatten die Fans weit über tausend Bände Vorsprung (tausend allein in der Hauptserie und fünfhundert im ATLAN-Ableger). Da ich gleichzeitig als Erno Fischer TERRANAUTEN für Bastei schrieb, musste ich mich entscheiden, und ich entschied mich für die TERRANAUTEN. Das heißt, ich schied freiwillig aus dem Team aus, zu einem Zeitpunkt, da die nächsten Exposés und somit der nächste Auftrag für ATLAN bereits auf dem Weg waren. Aus heutiger Sicht gesehen mit Sicherheit ein dicker Fehler, zumal die TERRANAUTEN anschließend eingestellt wurden, trotz aller anderslautender Beteuerungen von Seiten Basteis, der meine Treue in keiner Weise honorierte …«
»Gastromane« und Gastromane
Wilfried A. Harys einmalige Betätigung bei ATLAN mit Band Nr. 515 »Die Flucht der Solaner« kann man nach Kurt Brands ATLAN-Band Nr. 15 »Die Transmitter-Falle« und Harvey Pattons PERRY RHODAN-Band Nr. 747 »Die Körperlosen von Grosocht« als den dritten Gastroman für eine im PERRY RHODAN-Universum handelnde Serie ansehen, auch wenn es bei den beiden letztgenannten nicht aus freien Stücken bei dem einen Roman geblieben ist. In den 90er Jahren sollte dann der Begriff »Gastroman« eine neue Bedeutung erhalten: Autoren, die sich in der SF-Szene – und auch darüber hinaus – einen Namen gemacht hatten, wurden gebeten, einen Beitrag zur größten SF-Serie zu leisten, basierend auf einem speziell für sie zugeschnittenen Exposé. Zahlreiche bekannte deutschsprachige Autoren und auch frühere Teamautoren, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Mitarbeit an der Serie beendet hatten, wurden seit 1997 zu einem Gastspiel bei PERRY RHODAN eingeladen, wie beispielsweise Gisbert Haefs, Frank Böhmert, Titus Müller, Markus Heitz, Richard Dübell und natürlich Andreas Eschbach, der dieses neue Tradition mit PERRY RHODAN Band 1935 »Der Gesang der Stille« begründete.
Der bekannte und beliebte SF-Bestseller-Autor verriet, wie es dazu kam:
Erinnerungen eines Mitarbeiters: Wie die Gastromane erfunden wurden – von Andreas Eschbach
Alles begann im März 1997 in Dortmund, im Auditorium des futuristischen Harenberg-Centers. Es waren die 9. Science-Fiction-Tage NRW und ich hatte gerade den Kurd-Laßwitz-Preis für meinen Roman »Solarstation« entgegengenommen, als ein hagerer Mensch mit grünen Stoppelhaaren auf mich zukam und mich fragte, ob ich schon mal was von PERRY RHODAN gehört hätte?
Diese Frage verschlug mir die Sprache, hatte ich doch mehr oder weniger meine Jugend damit verbracht, an der Seite von Perry, Atlan und Gucky das Universum zu bereisen. Locker um die tausend Hefte lagerten damals bei mir im Keller und belegten die besten Plätze im Schrank, staubgeschützt hinter Glas.
Ja, brachte ich heraus, von PERRY RHODAN hätte ich durchaus schon einmal gehört.
Daraufhin stellte sich der Typ mit den grünen Haaren als Klaus N. Frick vor, Chefredakteur besagter Serie, und erklärte, er habe »Solarstation« gelesen, ausgesprochen spannend gefunden und wolle mich fragen, ob ich mir vorstellen könne, auch mal etwas zu schreiben, das im Universum Perry Rhodans spielte?
Das konnte ich mir nicht nur vorstellen, das hatte ich im Prinzip sogar schon gemacht: Meine allerersten Schreibversuche – circa vierundzwanzig Jahre vor diesem Tag – hatten darin bestanden, mit Hausmitteln eigene Romanhefte zu basteln und mit Text zu füllen, die meiner damaligen Leib- und Magenlektüre, vorsichtig ausgedrückt, ausgesprochen stark nachempfunden waren. Im Alter von zwölf Jahren darf man das. Außerdem hatten diese Hefte nur meine Schulfreunde zu lesen bekommen (und ehe jemand fragt: Dabei bleibt es auch!).
Ich antwortete also, ohne diese Details zu erwähnen – es war nicht die Situation dafür –, dass ich mir das durchaus vorstellen könne.
Er erklärte mir daraufhin, dass ihn das freue, dass das alles aber erst ein spontaner Gedanke sei, sozusagen ins Unreine gedacht, und man mal sehen müsse, wo man mich unterbringen könne. Er dachte weiter laut nach, die ganzen Nebenserien und Reihen durchhechelnd, wobei ich mich nur erinnere, dass ich sagte, mit Atlan hätte ich es nicht so, und dass er etwas sagte von wegen, leider gebe es die PR-Taschenbücher nicht mehr, das wäre ideal gewesen.
»Am liebsten«, gestand ich geradeheraus, »wäre mir die PERRY-Serie selber. Dass ich dafür ein Heft schreibe.«
Er lachte so nachsichtig wie ein Kardinal, dem ein kleines Kind vorschlägt, man könne doch zur Abwechslung mal eine Päpstin wählen. Nein, sagte er, das gehe natürlich nicht; die PERRY RHODAN-Serie sei doch so etwas wie das Allerheiligste. Aber man werde schon eine Möglichkeit finden. Sie hätten zum Beispiel gerade eine schicke neue Romanreihe in der Pipeline – Romane im Hardcover, etwa vom doppelten Heftumfang – »Space Thriller« hießen die. Da werde er mir mal was schicken.
Das tat er auch prompt. So kam ich an Robert Feldhoffs Roman »Grüße vom Sternenbiest«, einen in Terrania City angesiedelten, äußerst spannenden und für die Verhältnisse von PERRY RHODAN ungewöhnlich düsteren Krimi, den ich mehr oder weniger in einem Rutsch weglas.
Und dann hatte ich ein Problem. Der Roman als solcher hatte mir gut gefallen, aber: Erstens war er mit über zweihundert Seiten viel zu dick für ein Zwischendurchprojekt, zweitens fand ich die Aufmachung alles andere als berauschend, und drittens brauchte ich eigentlich nicht den Rahmen einer Serie, um diese Art Roman zu schreiben. Ich wisse nicht so recht, schrieb ich zurück, das sei doch etwas aufwendiger, da müsse ich erst sehen, wo ich das zeitlich unterbrächte.
Kein Problem, hieß es, es sei nicht so dringend, es müssten ja erst mal die vier Bände herauskommen, die schon geschrieben seien.
So blieb das Projekt in der Schwebe, und zu meiner Erleichterung wurde die »Space Thriller«-Reihe mit Erscheinen des vierten Bandes eingestellt.
»Aber«, ließ mich Klaus N. Frick zusammen mit dieser Mitteilung wissen, »es könnte sein, dass wir die PERRY RHODAN-Taschenbücher wiederbeleben; da sind wir gerade in Gesprächen.«
Danach hörte ich erst einmal lange nichts.
Im Oktober 1997, in Frankfurt auf der Buchmesse, liefen wir uns wieder über den Weg. Genauer gesagt, als ich am VPM-Stand vorbeischaute, saß Klaus Frick gerade mit Robert Feldhoff zusammen und lud mich ein, mich dazuzusetzen. Er wollte immer noch, dass ich etwas für PERRY RHODAN schrieb, doch je länger wir diskutierten, desto mehr zeigte sich, dass immer noch unklar war, wo man mich unterbringen konnte.
Irgendwann in diesem Sommer hatte ich jemanden etwas über die amerikanische Fernsehserie »Dallas« erzählen hören: nämlich dass es unter amerikanischen Schauspielern irgendwann geradezu Kult geworden sei, kleine oder kleinste Gastauftritte in dieser (nun nicht gerade höchste cineastische Kunst verkörpernden) Serie zu absolvieren; dass es sich selbst Oscar-Preisträger und Shakespeare-Darsteller nicht nehmen ließen, für winzige Nebenrollen mit ein paar Worten Text auf der Southfork Ranch vorstellig zu werden.
Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht mal, ob das überhaupt stimmt; ich habe in meinem Leben keine zehn Minuten »Dallas« gesehen. Aber damals habe ich das für bare Münze genommen und den beiden erzählt, weil es mich dazu ermutigte, noch einmal den Vorschlag zu machen, mich einfach eine Folge für die Erstauflage schreiben zu lassen: einen »Gastroman« sozusagen. Was in einer Serie wie »Dallas« möglich sei, könne einer Serie wie PERRY RHODAN doch nicht schaden, oder?
Meinem tollkühnen Vorhaben einen anderen Namen zu geben wirkte Wunder. Ein »Gastroman«! Das gefiel den beiden. Plötzlich stieß die einst undenkbare Idee doch auf, sagen wir, eine gewisse Offenheit. Darüber müsse man mal nachdenken, meinte der Chefredakteur, der inzwischen keine grünen Haare mehr hatte. Vielleicht, sagte er an Robert Feldhoff gewandt, wenn man die Handlung so lenke, dass ein Bereich entstehe, in dem ich im schlimmsten Fall nicht viel kaputtmachen könne?
Klaus Frick formulierte es natürlich weitaus höflicher, aber das war es, was er meinte. Wobei mir jede Lösung recht war, Hauptsache, ich durfte mich in der Hauptserie verewigen! Denn das und nichts anderes, so viel war mir in der Zwischenzeit klar geworden, reizte mich: selber für eben die Serie zu schreiben, die mich schon als Steppke fasziniert hatte. Nur eine Einladung von Sir Paul McCartney, auf seinem nächsten Album die Triangel zu spielen, hätte das noch überbieten können.
Der Anruf von Paul McCartney lässt bis heute auf sich warten, doch der Anruf von Klaus N. Frick kam: Wir würden das machen mit dem Gastroman, das sei ein interessantes Konzept. Termine wurden vereinbart, Textumfänge abgesprochen, ein Vertrag unterzeichnet. Die ersten Exposés trudelten ein, damit ich mich schon mal einlesen konnte.
Und dann folgte wildes Gedrängel: Das Exposé für Band 1935, meinen Gastroman, traf fast gleichzeitig mit dem lektorierten Manuskript von »Jesus Video« ein, dem Roman, den ich damals gerade fertiggestellt hatte. Und der Abgabetermin für die Einarbeitung der Korrekturen war noch enger als der für den PERRY RHODAN-Roman! So gestalteten sich die folgenden Wochen nicht ganz unstressig, doch der Zeitdruck blieb ohne nachteilige Auswirkung auf die beiden Romane, die da sozusagen nebeneinander entstanden: Das »Jesus Video« sollte mir später bescheren, was man in der Branche den »Durchbruch« nennt, und PR 1935 geriet zu einem Heft, das ich heute noch gerne lese und das in einer Umfrage zu den beliebtesten Heften der Serie auf einem sagenhaften 19. Platz landete.
So also wurde der »Gastroman« erfunden.
Man sagt ja, wenn man einer Idee so richtig zum Erfolg verhelfen will, muss man erreichen, dass andere sie für ihre eigene halten. Das scheint in diesem Fall – wenn auch unbeabsichtigt – gelungen zu sein. Der »Gastroman« ist zur Tradition geworden. Inzwischen haben viele bekannte Autoren, oft aus verblüffend weit entfernten literarischen Regionen, auf diesem Weg einen Auftritt in der Serie absolviert, und das Ganze beginnt eindeutig, Kult zu werden. Etwas, »das man einfach mal gemacht haben muss«.
In Veröffentlichungen zu den verschiedenen Jubiläen steht bisweilen zu lesen, »die PERRY RHODAN-Redaktion« habe die Idee mit den Gastromanen gehabt. Doch wo, wann und wie die Idee aufkam, ist in Vergessenheit geraten.
Tatsächlich war es so, wie ich es geschildert habe: Nicht »P.R.« war schuld – sondern »J.R.«.
(Andreas Eschbach, 05.09.2012)
Doch noch zwei Neue im ATLAN-Team
Zwar blieb Wilfried Hary ATLAN nicht erhalten, aber zwei andere junge Nachwuchsautoren taten es: Arndt Ellmer und Falk-Ingo Klee. Während Arndt Ellmer, der mit bürgerlichem Namen Wolfgang Kehl heißt, ab 1983 auch für PERRY RHODAN schrieb, war Falk-Ingo Klee, von den PERRY RHODAN-Taschenbüchern »Im Bann des Kometen« (Band 235) und »Geiseln der Sterne« (Band 248) abgesehen, ausschließlich bei PRs »Schwesterserie« aktiv, für die er, beginnend mit »Stadt der Außenseiter« (ATLAN 526), bis zu ihrer Einstellung im Januar 1988 insgesamt 31 Bände verfasste.
Kurzbiografie: Falk-Ingo Klee
Falk-Ingo Klee wurde am 21. Dezember 1946 in Bochum geboren. Er ist gelernter Großhandelskaufmann, staatlich geprüfter Ausbilder für kaufmännische Berufe, Mitglied im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer und Handlungsbevollmächtigter eines großen Autohauses. Zur SF-Literatur kam er durch einen Krankenhausaufenthalt während seiner Schulzeit. Nachdem erste Manuskripte unangenommen zurückgeschickt worden waren, nahm er Kontakt zu TERRA ASTRA-Lektor und -Redakteur Günter M. Schelwokat auf, der ihm wertvolle Tipps und Anregungen gab. Das darauf folgende Manuskript wurde dann auch angenommen und erschien unter dem Titel »Das neue Leben« 1978 in TERRA ASTRA. In der Folge behandelte der frischgebackene SF-Autor in seinen Romanen die unterschiedlichsten Themen, wobei das Unterhaltungselement immer im Vordergrund stand: »Sklaven für Anur« (1979), »Planet der Saurier« (1979), »Station der Biorobots« (1. Abenteuer der Crew der TOBRA), »Der Anticomputer« (1980), »Zielplanet Mercaror« (1980), »Insel der Manipulierten« (1980), »Intelligentes Leben unbekannt« (1980; TOBRA 2), »Im Zeichen des Schwertes« (1981), »Formel des Seins« (1981), »UFO-Kontakt« (1981), »Friedensmusik« (1983), »Der mystische Planet« (1983) und »Der kybernetische Despot« (1984). 1981 erhielt Klee die Chance, bei ATLAN einzusteigen. Sein Proberoman »Stadt der Außenseiter« erschien Anfang November 1981 als ATLAN-Heft 526, er wurde ins ATLAN-Autorenteam aufgenommen. Bis zur Einstellung von ATLAN mit Band 850 war er regelmäßig mit Beiträgen zur Schwesterserie von PERRY RHODAN vertreten; insgesamt veröffentlichte er hier 31 Bände. Klee, der ein Faible für Roboter und Computer hat, publizierte daneben noch die PR-Taschenbücher »Im Bann des Kometen« und »Geiseln der Sterne« sowie zwei Kurzgeschichten in Anthologien von Thomas Le Blanc. Große Resonanz hatte er mit seinem Sachbuch »Jasmin K. (3 Jahre), Diagnose: Krebs« (1986), in dem er den verzweifelten, schlussendlich aber erfolgreichen Kampf um das Leben seiner jüngeren Tochter aufs Eindringlichste schilderte.
Wolfgang Kehl erzählte dem Chronisten in einer Mail vom 24. September 2012, wie es zu seinem Einstieg bei ATLAN kam und wie er seine Arbeit dort im Rückblick sieht:
»Damals gab es keine Vernetzung wie heute. Die ›Macher‹ kannten ganz selten ›Macher‹ anderer Verlage. Entsprechend fehlte die interdisziplinäre Kommunikation, wie ich es mal nenne. Deshalb hat mein Eintritt ins ATLAN-Team ungefähr dieselbe Vorgeschichte wie die der meisten anderen ATLAN-Autoren.
Auf mich aufmerksam wurden die ›Macher‹, sprich Willi Voltz und Günter Schelwokat, durch ein paar Kurzgeschichten, die ich für die Leserseiten geschrieben hatte. Dort erschienen sie in PERRY RHODAN IV und ATLAN II. Parallel dazu habe ich mit einem Bekannten aus dem Umfeld des Fanzines SCIENCE-FICTION-BAUSTELLE einen Heftroman geschrieben, jeder abwechselnd ein Kapitel nach dem anderen. Besagtes Manuskript lehnte Lektor Schelwokat ab, aber er fragte mich, ob ich Lust hätte, eine Storysammlung für die Reihe TERRA ASTRA zu schreiben. Ich hatte. Danach kam ein Einzelroman für TERRA ASTRA, ein Doppelroman, dann der zehnbändige Sternenkinder-Zyklus. Die Exposés schrieb ich im England-Urlaub. Das Okay kam wenig später. Im Oktober 1980 nahm ich das Projekt in Angriff, schrieb den ersten Band, las Korrektur, verfasste ein paar Passagen neu, erledigte die Reinschrift und gab das Manuskript am Freitagnachmittag zur Post. Eine Stunde später war ich auf dem Weg zum WeltCon nach Mannheim. Dort fragte mich Willi Voltz, ob ich Lust hätte, bei ATLAN mitzuschreiben.
Weihnachten und Ostern auf einem Tag – meine Güte!
Es dauerte dann noch ein halbes Jahr, bis es soweit war. Wir waren drei Neue, Wilfried Hary, Falk-Ingo Klee und ich. Übrig blieben Falk und ich. Noch immer erinnere ich mich an eine Leserzuschrift, die damals auf der ATLAN-LKS erschien. Man merkt sofort, meinte der Leser sinngemäß, dass Falk-Ingo Klee ein Pseudonym sei und Arndt Ellmer ein Realname. Die Wahrheit: Es ist umgekehrt.
Die ersten Exposés für den neuen ATLAN-Zyklus ›Die Solaner‹ schrieb Willi selbst. Dann übernahm Marianne Sydow für ca. 20 Bände. Anschließend machten Marianne und Peter Griese es, und schließlich PeGe allein. (Ich hoffe, meine Erinnerung täuscht mich hier nicht. Möglich ist auch, dass Peter es ab 530 schon allein gemacht hat.)
Ab Band 750 dann übernahmen es Peter und H.G. Ewers gemeinsam, das Schiff zu steuern. Sie schufen zwei völlig grundverschiedene Ebenen, so dass es sich stellenweise wie zwei Serien nebeneinander las.
Aus der Erinnerung heraus ist es mir, als sei damals die Thematik und die Solaner, die SOLAG und die Entwicklung der Menschen in dem Generationenschiff die beliebteste aller Handlungsebenen gewesen. Danach wimmelte es für damalige Verhältnisse zu sehr von körperlosen Entitäten, der xten Ableitung von Anti-ES usw. Ab 750 brachte die Ewers-Handlung um Tuschkan, die Hathor, die Chadda etc. historisches kosmisches Flair.
Die Einstellung der Serie mit 850 kam überraschend, unerwartet. Irgendwie wähnten sich Leser wie Autoren im falschen Film.«
Hier kommt die SOL!
Im PERRY RHODAN MAGAZIN Nr. 4/1981 stimmte Willi Voltz die Leser in seinem Editorial, das sich mit der Bedeutung, die Raumschiffe in der Science Fiction haben, auseinandersetzte, auf den Start des neuen ATLAN-Zyklus »Die Abenteuer der SOL« ein, der im April starten sollte:
Essay: William Voltz über Raumschiffe
Bei der Definition des Begriffs »Science Fiction plagen sich Kritiker und Fachleute genauso wie bei den Versuchen, einmal exakt zu erklären, was »Country Music« ist. Nun gibt es Leute, die mir auf dem Gebiet der »Country Music« mehr Sachverständnis zuerkennen als auf dem Gebiet der »Science Fiction«. Es sind jene, die unzweideutig »erkannt« haben, dass »Country Music« reaktionär ist und denen es darum auch nicht schwerfällt, Beziehungen zwischen dieser Art von Musik und einem PERRY RHODAN-Autor zu konstruieren, die in einem höchsten Maße politisch sind. Aber hier geht es nicht um Politik, sondern um Eisenbahnen. Sie spielen in der »Country Music« eine fast mystische Rolle, wie so populäre Titel wie »Orange Blossom Special« oder »Wasbash Cannonball« beweisen. Züge dieser Art sind übrigens weiblichen Geschlechts. Diese Mystifizierung finden wir auch bei den Schiffen, die die Meere dieser Welt befahren; seltsamerweise gibt es sie nicht bei Flugzeugen.
Eine hauptsächliche Technik der »Science Fiction ist die Extrapolation. Es ist daher kein Wunder, dass Raumschiffe in dieser Art von Literatur mitunter ein Gewicht haben, das sie über den Status seelenlosen Beiwerks weit hinaushebt. Von »Raumschiff Enterprise« und »Raumschiff Orion« wissen wir, dass sie sogar den entsprechenden Fernsehserien ihren Namen liehen.
Es gibt Themen, deren sich fast jeder Science-Fiction-Autor im Laufe seines Schaffens einmal auf die eine oder andere Weise annimmt; in Zusammenhang mit den weiter oben gemachten Aussagen denke ich hier natürlich an das Thema des »Generationsraumschiffs«. In der Regel haben die Besatzungsmitglieder an Bord solcher Schiffe vergessen, wo sie sich befinden (eine elitäre Clique, die es noch weiß, gehört ebenso regelmäßig natürlich dazu!), und es ist fast immer der Held, der die Wahrheit herausfindet und (es gibt Ausnahmen) ein Happy-End herbeiführt. Von Brian W. Aldiss bis Robert Heinlein haben sich fast alle berühmten Science-Fiction-Autoren damit befasst.
In der PERRY RHODAN-Serie erlangten einige Raumschiffe ebenfalls eine Bedeutung, die nicht mehr allein der des technischen Instrumentariums entspricht, so z.B. die CREST IV, die ihre Popularität bei den Lesern einem unfreiwilligen Dilatationsflug verdankt, die MARCO POLO, die lange Zeit die größten Entfernungen überbrückte, und die BASIS, die nach einem (zunächst) geheimnisvollen »Plan der Vollendung« gebaut wurde. Von allen Raumschiffen der PERRY RHODAN-Serie aber steht eines an besonders exponierter Stelle: die SOL. Das hantelförmige Fernraumschiff tauchte erstmals in Band Nr. 700 auf. Es war in jahrelanger Arbeit erbaut worden, um Perry Rhodan und immun gebliebene Menschen von einer Erde hinwegzutragen, auf der die gefühllosen Aphiliker das Sagen hatten. In einer Odyssee ohnegleichen erreichte die SOL schließlich die Milchstraße. Dies – und die später auftauchenden Solaner, die das Schiff für sich beanspruchten und schließlich auch von Perry Rhodan zur Verfügung gestellt bekamen – sind offenbar die Gründe für die Popularität dieses Schiffes bei den PERRY RHODAN-Lesern. Nicht minder populär bei den Freunden der PERRY RHODAN-Serie ist die Figur des Arkoniden Atlan. Davon konnte ich mich überzeugen, als ich in PERRY RHODAN Band Nr. 982 Atlan vorübergehend aus der Handlung verbannte; eine Flut von Protestschreiben war die Reaktion. Eine (eigentlich nicht geplante) Handlungsfolge fügte es nun, dass Atlan und die SOL in einem Zyklus die Hauptrolle spielen, der in dem Jubiläumsband Nr. 500 der ATLAN-Serie (er erscheint Ende April) beginnt. Der Zyklus »König von Atlantis« wird mit Band Nr. 499 abgeschlossen, danach beginnt der Zyklus »Die Abenteuer der SOL«. An anderer Stelle (vor allem in den laufenden Leserkontaktseiten der PR- und ATLAN-Serien) berichte ich ausführlich über die Handlung, wie sie in diesem Jubiläumsband beginnt. Johnny Cash, neben dem legendären Jimmie Rodgers und dem erst in jüngster Zeit in Europa bekannt gewordenen Boxcar Willie immer noch der Country-Sänger mit der schönsten Röhre, wenn es gilt, das Pfeifen eines Zuges nachzumachen, interpretiert eine Zeile aus »Orange Blossom Special« so:
»Lookin’ on, she’s coming!« Auf unsere Verhältnisse übertragen: Schaut her, da kommt die SOL!
(Auszug aus SF-Perry Rhodan Magazin 4/1981)
Jubiläumsband zum Zweiten
Im Herbst 1980 war anlässlich des Erscheinens von Band Nr. 1000 der weltberühmten SF-Serie ein von Günter M. Schelwokat herausgegebener »Perry Rhodan Jubiläumsband« mit acht neuen Geschichten der PERRY-RHODAN-Autoren Kurt Mahr, H.G. Ewers, Ernst Vlcek, William Voltz, K.H. Scheer, Clark Darlton, Hans Kneifel und H.G. Francis erschienen. 1981 gab es einen neuen Grund zum Feiern: Die PERRY RHODAN-Serie feierte ihren 20 Geburtstag. Und nachdem sich der Jubiläumsband als Verkaufshit erwiesen hatte, lag es nahe, dieses erfolgreiche Konzept zu wiederholen.
So erging mit Datum von 13. April 1981 folgendes Rundschreiben von Walter A. Fuchs an Frau Sydow, die Herren Ernsting, Franciskowsky, Gehrmann, Griese, Kneifel, Mahn, Ritter, Scheer, Vlcek und Voltz sowie an Herrn Schelwokat zur Kenntnisnahme:
»Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens der PERRY RHODAN-Serie erscheint im Herbst dieses Jahres ein PERRY RHODAN JUBILÄUMSBAND, in dem alle PR-Autoren mit einer Kurzgeschichte aus dem PR-Milieu vertreten sein sollen.
Dieser Jubiläumsband ist ein Dankeschön an die Treue unserer Leser und soll wieder zu einem Jubiläumspreis abgegeben werden. Senden Sie bitte ein Kurzexposé ihrer geplanten Erzählung an Herrn Schelwokat, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und eine Koordination zu ermöglichen.
Der Umfang der Story soll 78.000 bis 85.000 Anschläge betragen und bis spätestens 20. Mai d. J. an Herrn Schelwokat zum Redigieren gesandt werden.
Aller weiteren Details wegen setzen Sie sich bitte direkt mit Herrn Schelwokat in Verbindung.«
In der Tat schrieben alle genannten Teamautoren einen Beitrag für den zweiten Jubiläumsband, der im September 1081 erschien, einen Umfang von 430 Seiten aufwies und zum Spottpreis von DM 5,80 erhältlich war. G. M. Schelwokat ging in seinem Vorwort dann auch auf Jubiläum und Inhalt ein:
»Am 8. September 1961 erschien der erste Band einer SF-Heftserie, deren Dauer und Bestand in der ganzen Welt bisher einmalig ist.« – So steht es auf Seite 1010 des Lexikons der Science-Fiction-Literatur, und es gibt keinen Grund, diese Aussage des Lexikons in Zweifel zu ziehen. Mit der SF-Serie ist natürlich PERRY RHODAN gemeint, und da wir inzwischen 1981 schreiben, feiert die Serie jetzt ihr 20-jähriges Bestehen.
PERRYs 20. Geburtstag ist allen, die aktiv an der Serie mitarbeiten, Anlass genug, eine gehörige Portion Stolz zu empfinden, sich anerkennend auf die Schultern zu klopfen oder klopfen zu lassen und sich eventuell kräftig die Nase zu begießen.
Doch wem verdanken die stolzgeschwellten Rhodanisten im Grunde dieses Erfolgserlebnis? Sie verdanken es IHNEN, den PERRY-RHODAN-Lesern, die der Serie so lange die Treue gehalten haben und – hoffentlich – auch weiter halten werden. IHNEN gebührt ein ganz großes und dickes Dankeschön!
Als ein solches Dankeschön von Seiten des Verlages soll die vorliegende Jubiläumsausgabe verstanden werden. Elf Autoren haben sich mit Eifer (wenn auch zähneknirschend ob der knappen Terminierung des Projekts) an die Arbeit gemacht und ihr Garn gesponnen – kein schlechtes, wie wir meinen.
Der Zeitraum, in dem die Storys dieses Jubiläumsbandes angesiedelt sind, ist diesmal besonders weit gespannt. Er reicht vom 11. nachchristlichen Jahrhundert, in dem Hans Kneifels Atlan-Abenteuer bei den Mauren spielt, bis hin zu Icho Tolots Rettungsaktion von H.G. Francis, die in das Jahr 425 der Neuen Galaktischen Zeitrechnung fällt.
Was die Thematik der meisten Erzählungen angeht, so werden darin Probleme behandelt, die uns hier und heute auf unserem Planeten Erde bewegen. Es geht um Frieden und Verständigung, um Umweltprobleme, Konflikte zwischen den Generationen und Ähnliches mehr.
Der Tenor der Stories ist somit ernster Natur, zu schmunzeln gibt es nichts. Und wenn Sie sich darüber beschweren wollen, bitte tun Sie es und schreiben Sie uns. Wir werden uns dann zum Ausgleich verpflichtet fühlen und dem nächsten Jubiläumsband eine weniger ernsthafte Grundnote verleihen. Einen Aufhänger für ein weiteres PERRY-RHODAN-Jubiläum im Jahre 1982 glauben wir schon gefunden zu haben.«
(Auszug aus PERRY RHODAN JUBILÄUMSBAND 2 (1981))
Damit wurde eine Tradition begründet, die bis zum Jahr 1986 Bestand haben sollte. Auch wenn im Laufe der Jahre der Umfang auf bis zu 256 Seiten schrumpfte und der Preis um eine D-Mark angehoben wurde.
Der erste Todesfall
Am 8. Mai 1981 verstarb der SF-Autor W. W. Shols, der in der Frühzeit der Serie auch vier Romane zu PERRY RHODAN beigesteuert hatte, während eines Urlaubs in Portugal. Er war 55 Jahre alt.
Kurzbiografie: W. W. Shols
W. W. Shols wurde am 30. August 1925 in Bielefeld unter dem bürgerlichen Namen Winfried Scholz geboren. Er besuchte die Mittel- und Aufbauschule und wurde nach dem Kriegsabitur 1942 zur Wehrmacht eingezogen. Nach dem Krieg arbeitete er als Kaufmann im grafischen Gewerbe. In den fünfziger Jahren begann er sich mit der Schriftstellerei ein zweites Standbein zu schaffen und war bis in die siebziger Jahre hinein einer der fleißigsten und produktivsten Leihbuchautoren. Sein Erstling erschien 1959 unter dem Titel »Tödlicher Staub«. Ihm folgten zahlreiche weitere SF-Titel, teilweise unter dem Verlagspseudonym William Brown. Zu seinen interessantesten SF-Leihbüchern, die zumeist im Heftformat eine gekürzte Neuauflage erlebten, gehören die Tetralogie »Der Prokaskische Krieg« um Perry (!) Barnett und die dreizehn Bände umfassende Serie UTO-SPION, die es nur im Leihbuch gibt. Von seinen Einzeltiteln wären vor allem »Die Zeitpatrouille«, »Seine Heimat war der Mars«, »Zweimal Weltgericht«, »Der Hexer vom Mars« und »Mooreland vererbt einen Krater« zu erwähnen. Er schrieb die PERRY RHODAN-Bände Nr. 6, 9, 23 und 31 sowie fünf Romane für die erste PR-Konkurrenz MARK POWERS, bevor er sich 1962 aus dem Genre zurückzog, da er sich aus beruflichen Gründen nicht mehr in der Lage sah, für periodisch erscheinende SF-Serien zu schreiben. In der Folge veröffentlichte Shols zahlreiche Kriminalromane, in erster Linie für die KOMMISSAR X-Taschenbücher. Zu PERRY RHODAN steuerte er nicht nur vier Romane bei – ein fünfter wurde nicht angenommen und von musste von K.H. Scheer neu geschrieben werden –, er trug auch zur Namensfindung der japanischen Mutanten bei. Er arbeitete nämlich 1961 in einer Bielefelder Großdruckerei und hatte Zugriff auf ein japanisches Adressbuch, was ihn in die Lage versetzte, K.H. Scheer mit einer Liste tatsächlich existierender Personen zu versorgen, die dann als Mitglieder des legendären Mutantenkorps Geschichte schrieben.2
Die Universität Tübingen und PERRY RHODAN
Auch der Verlag war in Sachen PERRY RHODAN nicht untätig. Vor allem Walter A. Fuchs war bemüht, die Sicht der Öffentlichkeit auf PERRY RHODAN, die Fans der Serie und die SF-Freunde insgesamt ins rechte Licht zu rücken. Deshalb verschickte er mit Datum vom 12. Juni 1981 ein Rundschreiben folgenden Inhalts an die Redaktionen diverser Zeitungen und Zeitschriften:
»Die neuphilologische Fakultät der Uni Tübingen hat eine sehr interessante Untersuchung der Science-Fiction-Leser am Beispiel der Teilnehmer des 1. PERRY RHODAN-Weltkongresses durchgeführt.
Eine mit dem Forschungsleiter abgestimmte Zusammenfassung der Untersuchung möchten wir Ihnen heute übermitteln, da bisher das Verhalten der Käufe rund Leser von Science-Fiction-Lesern noch nicht erforscht worden ist.
Wir würden uns sehr freuen, wen Sie in Ihrem Blatt über dieses Untersuchung berichten würden. Für Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichner jederzeit gerne zur Verfügung.«
Das Schreiben trug die Unterschrift von Walter A. Fuchs.
Die Reaktion war enorm und reichte von ganzseitigen Berichten bis zu kurzen News-Einschaltungen. Die Überschriften trugen Titel wie »Ein sehr aktives Fremdwesen – Umfrage korrigiert das Bild von Science-Fiction-Fan«, »Perry Rhodan – Gründer der Kosmischen Hanse«, »Heim zu den Sternen… – Eine Lanze für die Leser der Science-Fiction-Hefte«, »SF-Held Perry Rhodan – Leser-Untersuchung der Universität Tübingen«, »Kein Wilder Westen im Weltall – Die Leser von Science-Fiction-Literatur und ihre Vorlieben«, »Wo, bitte, geht’s zur Zukunft? – Verlag räumt mit Vorurteilen gegen PERRY RHODAN-Freunde auf«, »Viel besser als ihr Ruf … – Universität Tübingen revidiert Urteil über PERRY RHODAN-Fans« oder »Ihr Romanheld ist 2000 Jahre jung – Eine Uni-Untersuchung ergab: PERRY RHODAN-Leser sind besser als ihr Ruf«. In mehr oder weniger ausführlicher Form wurde auf die Ergebnisse der Untersuchung eingegangen. So meldete das MÜNCHNER BUCH-MAGAZIN in Ausgabe 3/1981: »Die neuphilologische Fakultät der Universität Tübingen untersuchte die soziologische Struktur der Science-Fiction-Leser anlässlich des 1. PERRY RHODAN-Weltkongresses. Die Auswertung der Fragebogen ergab, dass PERRY RHODAN-Leser politisch und vor allen Dingen wissenschaftlich aufgeschossener sind als der Durchschnittsjugendliche. So lehnen sie etwa in großer Überzahl die Zwangsrückführung von Gastarbeitern in ihre Heimat oder den Einmarsch westlicher Truppen in die OPEC-Länder zur Sicherung des Energiebedarfs ab. Sie wählen mehrheitlich die Grünen oder die SPD und lesen zu über 75% Tageszeitungen.«
Diese Untersuchung der Uni Tübingen trug nicht unwesentlich dazu bei, dass sich das Bild, das sich die Öffentlichkeit von PERRY RHODAN und seinen Lesern machte, deutlich verbesserte und so unberechtigte und aus der Luft gegriffene Anschuldigungen, wie sie der Serie in den 70er Jahren gemacht worden waren, der Vergangenheit angehörten.
Scheers Rückkehr, die erste!
Seit K.H. Scheer aus gesundheitlichen Gründen seit Band Nr. 500 keinen neuen Roman für PERRY RHODAN geschrieben hatte, war von Leserseite immer wieder der Wunsch geäußert worden, der Altmeister solle doch wieder zum Autorenteam der von ihm mitkonzipierten Serie stoßen. Doch Scheer fühlte sich nicht in der Lage, regelmäßig an der Serie mitzuschreiben, bei der er nach wie vor für die technischen Belange zuständig war – eine Aufgabe, die später von Kurt Mahr übernommen wurde und die jetzt Rainer Castor wahrnimmt. So widmete er sich, unterbrochen von gesundheitlichen Rückschlägen, von 1972 bis 1977 der überarbeiteten Neuherausgabe und Weiterführung seiner ZBV-Serie in Taschenbuchform, wobei auch andere Autoren nach seinen Exposés die Abenteuer von Thor Konnat alias HC-9 und Hannibal Othello Xerxes Utan alias MA-23 schilderten. Der letzte Band 50 erschien erst 1980 und war eigentlich der Beginn eines mehrbändigen Abenteuers. Zu einer Fortsetzung kam es nicht, weil sich Scheer und der Verlag nicht einigen konnte, was zuerst kommen sollte: das Huhn oder das Ei; im speziellen Fall, ob Scheer erst mehrere fertige Manuskript vorlegen musste, bevor ZBV fortgesetzt wurde, oder ob Scheer erst mit dem Schreiben beginnen würde, wenn es eine verbindliche Zusage zur Weiterführung von Verlagsseite gäbe. Scheer war nicht bereit, gewissermaßen »auf Luft« neue ZBV-Romane zu verfassen, deshalb wurde ZBV nicht fortgesetzt und das begonnene Abenteuer auch nicht abgeschlossen.
Aber er fühlte sich seit einigen Jahren wieder erstmals in der Lage und war auch willens, wieder bei PERRY RHODAN einzusteigen. Und so schrieb Willi Voltz am 14. August 1981 folgenden Brief an Walter Fuchs im Pabelhaus in Rastatt:
»Wie ich telefonisch bei Dir und gestern im Gespräch mit Herrn Blach, Herrn Zenkert und Dir ankündigte, will ich K.H. Scheer wieder als Co-Autor für die PR-Serie gewinnen. Skepsis und Bedenken des Verlags sind mir bekannt, vor allem was die Einhaltung der Termine angeht. Ich habe nun mehrfach mit K.H. Scheer gesprochen und bin der Überzeugung, dass er gerne wieder PR-Romane schreiben will und schreiben wird. Die Verantwortung für die Termineinhaltung übernehme ich. (…) Was die Grundthemen der Serie angeht, werde ich in einem Gespräch mit Herrn Scheer darüber sprechen, dass Dinge wie Waffenfetischismus, Rassenverherrlichung (Terraner) und undifferenziertes Supermanngehabe darin nichts mehr zu suchen haben. Auch werde ich K.H. Scheer dazu anhalten, sich positiv hinter die Serie zu stellen.
Grundsätzlich glaube ich, dass K.H. Scheer eine Bereicherung für die Serie sein wird und dass man mit der Reaktivierung der speziellen Scheer-Anhänger PR I (trotz der allg. Wirtschaftslage und der damit verbundenen Probleme, von denen Herr Blach gestern sprach) auch weiterhin unbeschadet durch sinkende Verkaufszahlen, die andere Serien und Reihen heimsuchen, bringen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich erleichtert darauf hinweisen, dass auch Marianne Sydow (die, wenn auch thematisch aus einer ganz anderen Richtung kommend) die Arbeit bei PR wiederaufgenommen hat – und damit ein spezielles Publikum anspricht.«
Tatsächlich war Scheer nicht glücklich darüber, wie sich die Serie unter der Federführung von Willi Voltz entwickelt hatte, und hatte das in Gesprächen und Interviews auch zum Ausdruck gebracht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre Perry Rhodan in der laufenden Handlung immer noch Großadministrator des Solaren Imperiums gewesen. Nichtsdestotrotz nahm er die Arbeit an PERRY RHODAN auf, nicht ohne in seinem ersten neuen Roman nach zehnjähriger Abwesenheit eine neue Figur einzuführen, die an die alten Kämpen aus der Frühzeit der Serie erinnerte und auch aus dieser stammte: Clifton Callamon.
Mit ihr wollte Scheer dem Pazifismus, der in PERRY RHODAN mit Band 1000 ausgebrochen war, einen Antipoden entgegenstellen. In einem Interview, das Matthias Hofmann und Rüdiger Schäfer 1990 mit Scheer führten (K.H. Scheer Interview – Sonderbeilage zu COSMOS 5 – Ein Fanzine des PRC Ruf der Kosmokraten; 1991) meinte Scheer zum Thema MdI und Pazifismus: »Ihr vergesst immer wieder im Hinterstübchen, dass es hier um eine abenteuerlich gefärbte Science Fiction-Serie geht, die neben bei auch verkauft werden soll und Erfolg haben muss! Wie will ich beispielsweise einen Zyklus von nur 25 Bänden ausschließlich nach der total pazifistischen Richtung aufbauen, es muss doch auch einmal etwas passieren! Wir waren schon so weit, dass keiner sich mehr ein Bein brechen durfte. Das geht nicht. Wir haben hier eine kommerzielle Romanserie, die möglichst vielen Leuten gefallen soll. Wenn gar nichts mehr passiert, wenn die Leute auf fremden Planeten gelandet sind und nicht einmal ein Taschenmesser dabeihatten, weil das als verpönt galt, dann führt das zu weit. Das hat mich damals verleitet, dieses Uraltgeschöpf Clifton Callamon ins Spiel zu bringen.«
Die ersten Marktbereinigungen
Nachdem die siebziger Jahre von immer neuen Serienstarts geprägt gewesen waren, neigte sich jetzt zu Beginn der 80er Jahre der Boom beim Horror langsam, aber beständig seinem Ende entgegen. Zumindest bei Pabel-Moewig, das auch in diesem literarischen Segment eine Vormachtstellung innegehabt hatte, und das trotz der enormen Konkurrenz durch Zauberkreis und Bastei mit Dan Shockers LARRY BRENT und MACABROS bzw. JOHN SINCLAIR und dem GESPENSTER-KRIMI. Dazu kam noch, dass Pabel-Moewig mit anderen Objekten viel Geld verloren hatte. Deshalb wurden verlagsintern alle Reihen und Serien auf ihre Rentabilität geprüft. Und es stellte sich heraus, dass bei einigen die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr aufging.
So wurde die Heftreihe VAMPIR, die im September 1972 als erste Horror-Heftreihe in Deutschland auf den Markt gebracht worden war, im Oktober 1981 nach neunjähriger Existenz eingestellt. In VAMPIR hatte nicht nur die legendäre DÄMONENKILLER-Serie von Ernst Vlcek und Kurt Luif ihren Anfang genommen, es wurden hier auch zahlreiche andere Mini-Serien und Zyklen dem deutschen Leser präsentiert, wie die FRANKENSTEIN-Romane von Donald F. Glut, BARNABAS, DER VAMPIR von Marilyn Ross oder der ebenfalls von Ernst Vlcek und Kurt Luif als Nachfolgeserie des mittlerweile eingestellten DÄMONENKILLERS geplante HEXENHAMMER. An Einzeltiteln, hin und wieder auch mit wiederkehrenden Protagonisten, gab es neben Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen auch Grusel- und Horror-Romane bekannter deutscher Autoren, darunter Hugh Walker alias Hubert Straßl, Frank Sky alias Hans Gerd Franciskowsky, Earl Warren alias Walter Appel, James R. Burcette alias Kurt Luif und Hivar Kelasker alias Hans Kneifel. Die VAMPIR-Taschenbücher und die DÄMONENKILLER-Taschenbücher waren wegen Unrentabilität bereits im März bzw. Mai 1980 mit Band 81 bzw. 63 vom Markt genommen worden.
Auch die von Hugh Walker mustergültig herausgegebene TERRA FANTASY-Taschenbuchreihe blieb von dieser Marktbereinigung nicht verschont: Zwar erhielt die Erstauflage noch eine Schonfrist bis zum Frühjahr 1982, die 2. Auflage beendete aber bereits im Juli 1981 mit der Nr. 53 ihr Erscheinen.
Der Blick über den Tellerrand
Bei anderen Verlagen, die im Genre publizierten, sah es nicht viel anders aus. Kelter nahm die Reihe GEISTER-KRIMI, die seit 1974 gelaufen war und in der die Serienfiguren MARK TATE von W. A. Hary und RICK MASTERS von Andrew Hathaway (Richard Wunderer) ihre ersten Abenteuer erlebt hatten, mit Heft 405 aus dem Programm. In ihrer Blütezeit war die Reihe so erfolgreich gewesen, dass es auch gleichnamige Taschenbücher gab. Gegen Ende zu jedoch wurden viele der früheren Titel unter neuer Nummer nochmals aufgelegt. Bastei stellte die SF-Serie DIE TERRANAUTEN mit Heft 99 ein, führte die Geschichte aber in loser Folge im Taschenbuch weiter. Und Boje beendete die Publikation von SF-Jugendbüchern. Aber noch hatten generell die neuen Reihen und Serien das Übergewicht. Bastei startete im Taschenbuch den SF-Klassiker CAPTAIN FUTURE, der es bis zu seiner Einstellung 1984 auf immerhin fünfzehn Ausgaben brachte, sowie die Reihe BASTEI PHANTASTISCHE LITERATUR, in der angloamerikanische und deutsche Klassiker dem deutschen Leser ebenso vorgestellt wurden wie neuere Werke, so auch Thomas Zieglers erste, kurze Fassung seines späteren Romans »Die Stimmen der Nacht«, und erweiterte zudem sein SF-Programm noch durch die neue Reihe BASTEI SCIENCE FICTION ABENTEUER. »Hohenheim« startete im Hardcover die EDITION SF und Heyne die renommierte BIBLIOTHEK DER SCIENCE FICTION LITERATUR, in der bis zum Jahr 1995 Meilensteine dieser Literaturgattung in deutscher Erstveröffentlichung oder erstmals ungekürzt, zum Teil auch mit informativen Nachworten versehen, veröffentlicht wurden. Edmond Hamiltons CAPTAIN FUTURE erlebt seit 2011 eine Renaissance im Berliner Golkonda Verlag, wo eine komplette Ausgabe der Serie in 22 Paperbacks einschließlich der Illustrationen und Zusatztexte aus den Original-US-Magazinen geplant ist; bei Redaktionsschluss lagen bereits drei Bände vor.
Ein neuer SF-Preis wird vergeben
Eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr 1981 war die erstmalige Verleihung des Kurd-Laßwitz-Preises. Dieser undotierte Preis, der jährlich von professionell im Bereich der Science-Fiction arbeitenden, deutschsprachigen Personen vergeben wird, wurde 1980 nach dem Vorbild des amerikanischen Nebula Award ins Leben gerufen und nach dem deutschen Science-Fiction-Autor Kurd Laßwitz benannt. Ausgezeichnet wird jährlich die jeweils beste Produktion des Vorjahres. Damit sollen herausragende Leistungen vor allem im Bereich der deutschsprachigen Science Fiction geehrt werden, um die Preisträger und die deutschsprachige Science Fiction zu unterstützen.
Der Preis wurde zunächst in sechs Kategorien vergeben (»Roman«, »Erzählung«, »Kurzgeschichte«, »Übersetzer«, »Graphiker« sowie »Sonderpreis«); 1983 wurde die Kategorie »Bester ausländischer Roman« eingeführt. 1987 folgten die Kategorien »Hörspiel« und »Film«. Während die Kategorie »Hörspiel« seit 1993 eine eigene Jury besitzt, wurde die Kategorie »Film« 1996 in die Kategorie »Sonderpreis« integriert. 1997 wurden die Kategorien »Erzählung« und »Kurzgeschichte« zu einer zusammengefasst, und seit 2001 entscheidet in der Kategorie »Übersetzung« eine Fachjury.
Nominierung und Abstimmung erfolgt durch die im Bereich der Science Fiction professionell tätigen Autoren, Übersetzer, Grafiker, Lektoren, Verleger, Fachjournalisten und ehemaligen Preisträger.
Die ersten Preisträger waren Georg Zauner für den Roman »Die Enkel der Raketenbauer«, Thomas Ziegler für die Erzählung »Die sensitiven Jahre«, Ronald M. Hahn für die Kurzgeschichte »Auf dem großen Strom«, Horst Pukallus als bester Übersetzer und Thomas Franke als bester Grafiker, den Sonderpreis erhielten Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronals M. Hahn und Wolfgang Jeschke für die Herausgabe des »Lexikon der Science Fiction Literatur«.
Neues von den Planetenromanen
1981 erschienen wieder zwölf PERRY RHODAN-Taschenbücher, damals noch PLANETENROMANE genannt. (Nicht zu verwechseln mit den heutzutage (2012/2013) erscheinenden Taschenheften dieses Namens, in denen – und hier ist der Name Programm – ausgewählte Titel aus den Taschenbüchern nochmals aufgelegt werden.)
Den Reigen eröffnete der Walty-Klackton-Roman »Kosmischer Grenzfall« von Ernst Vlcek, in dem der ehemalige Schrecken der USO sein erstes Abenteuer in den Diensten Roi Dantons, des Königs der Freihändler, erlebte, gefolgt von »Der genetische Krieg« von H.G. Ewers, dem 4. Roman um Kyron Barrakun alias Computer-Kid, der diesmal herausfinden musste, wer für die ungeheuerlichen Mutationen auf Ertrus und Siga verantwortlich war, wo eine aus den Fugen geratene Biologie alles Leben bedrohte. Peter Griese war gleich mit zwei Bänden vertreten: In »Welt der Flibustier« trafen Orbiter und Menschen auf einem einsamen Planeten im Zentrum der Galaxis auf eine Wesenheit, die nach neuer Macht trachtete, und in »Findelkinder der Galaxis« begab sich Reginald Bull auf die Suche nach dem Heimatplaneten der rund zwölfhundert Xisrapenkinder, die im Babyalter auf verschiedenen Sauerstoffplaneten ausgesetzt worden waren. Hans Kneifel ließ in »Das Mittelmeer-Inferno« den Arkoniden Atlan eine neue Geschichte aus seiner Vergangenheit auf der Erde erzählen, während in Horst Hoffmanns »Tödliche Fracht für Terra« der Mausbiber Gucky wieder den Retter der Erde und des Vereinten Imperiums spielen durfte. Kurt Mahr schilderte in »Bote des Unsterblichen«, wie ES im Auftrag der Kosmokraten einen Boten in geheimer Mission ausschickt, der dafür sorgen soll, dass das Geheimnis der kosmischen Burgen gewahrt bleibt, und präsentierte mit »Eiswelt Cyrglar« den vierten Roman um Langlon Brak und sein Team vom Geheimdienst SOLEFT. In »Die Macht des Götzen« von Harvey Patton geriet Reginald Bull, der als Rhodans Stellvertreter einen Staatsbesuch absolvierte, in den Bann eines dunklen Götzen aus der Vergangenheit, Clark Darlton ließ in »Die andere Welt« Perry Rhodan und den Teleporter Ras Tschubai bei der Nutzung des Nullzeit-Deformators auf einer Alternativerde stranden, auf der die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat, H.G. Francis schilderte in »Der Waffenhändler« das vierte Abenteuer mit Ronald Tekener und Sinclair Marout Kennon, den Spezialisten der USO, und in Arndt Ellmers »Die Verschwundenen von Arkona« wurde Perry Rhodan entführt und sollte nur gegen Zahlung einer hohen Lösegeldes von seinem Entführer wieder freigelassen werden. Breit gefächert wie die Inhalte waren auch die Handlungszeiten der einzelnen Bände; die Bandbreite reichte vom Altertum bis zum Jahr 1 NGZ.
Bei den Titelbildern gab es eine Änderung: Johnny Bruck, sonst für alle Objekte mit PR-Bezug der Titelbildgestalter, lieferte für Band 217 sein für längere Zeit letztes Cover; von ihm stammte später nur mehr das Titelbild für das zu Zeiten Napoleons spielende Atlan-Abenteuer »Das Buch der Kriege« (Band 325). Ab Band 218 wurde er durch einen neuen Coverzeichner ersetzt, einen Künstler, der mit seinen vorgelegten Arbeiten begeistert hatte und der nach dem Tod von Bruck einer der regelmäßigen neuen Cover-Künstler werden sollte, die abwechselnd die Titelbilder der Hauptserie gestalten. Sein Name: Alfred Kelsner.
Kurzbiografie: Alfred Kelsner
Alfred Kelsner wurde am 24. Mai 1949 in Bünde, Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen, geboren. Schon früh begann er mit der Malerei; nach eigenen Angaben bereits im Vorschulalter. Während er sich als Kind vor allem für Ritterzeichnungen begeistern konnte, änderten sich Kelsners Vorlieben als Jugendlicher: Er kaufte sich Astronomie-Bücher und ein Teleskop, wurde begeisterter Hobby-Astronom, woraus sich seine Passion für die Science Fiction-Malerei entwickelte. Nach einer Lehre als Schilder- und Reklamemaler studierte Kelsner an der Fachhochschule Köln und wurde Grafik-Designer. Seit 1978 ist er als freischaffender Grafiker und Illustrator tätig. Ende der 70er Jahre hatte ihn ein PERRY RHODAN-Roman von William Voltz so begeistert, dass er dem PR-Chefautor einige Bilder schickte. Das Ergebnis war, dass er mit diesem gemeinsam den Bildband »Zeitsplitter« entwickelte, ein großformatiges Buch mit Bildern Kelsners, von denen sich Voltz zu Kurzgeschichten inspirieren ließ. Kelsner übernahm die PERRY RHODAN PLANETENROMANE, zu denen er von Band 218 bis Band 403 bis auf die Ausgaben 253, 254, 325, 336, 339 und 340 alle Cover gestaltete. Daneben schuf er noch Titelbilder für die ATLAN-Miniserien TRAVERSAN und CENTAURI, die AUTORENBIBLIOTHEK und MYTHOR und fertigte auch Innenillustrationen für die PERRY RHODAN- und die klassische ATLAN-Serie an. Seit Band 1800 ist Kelsner neben Swen Papenbrock, Ralph Voltz und Dirk Schultz einer der sich abwechselnden Titelbildkünstler der PERRY RHODAN-Heftserie.
Zeitsplitter – Gedankensplitter
Willi Voltz war von Kelsners Bildern begeistert, wie er in der Einführung zu dem aufwendig gestalteten Bildband »Zeitsplitter« anmerkte, der sich optisch an den PERRY RHODAN-Silberbänden orientierte und im September 1981 zur Auslieferung gelangte:
»Als ich zum ersten Mal Bilder von Alfred Kelsner sah (es waren drei winzige Fotos, die er zusammen mit einem Leserbrief an den Verlag geschickt hatte), war ich auf Anhieb davon überzeugt, dass der Welt der Science Fiction eine Entdeckung bevorstand. Und ebenso spontan packte mich die Idee, zusammen mit Alfred Kelsner diesen Band zu produzieren, den ersten Bildband dieser Art, den ein deutscher SF-Grafiker und ein deutscher SF-Autor zusammen geschaffen haben. Meine Helden, so sagt man mir gerne nach, sind melancholische Einzelgänger, und vielleicht beruht meine Begeisterung für die Bilder von Alfred Kelsner darin, dass diese Helden in ihnen eine grafische Entsprechung gefunden haben. Ein großer Teil dieser Bilder drückt sehr genau das aus, was ich im Umgang mit den hauptsächlichen Themen meiner Geschichten empfinde. Deshalb fiel es mir auch leicht, für diesen Band etwas zu tun, was ich in anderer Form eigentlich ablehne: Geschichten zu einer Bildvorlage zu schreiben. Natürlich liegt der Schwerpunkt dieses Buches auf seinem grafischen Teil; es gibt darin zwei in sich abgeschlossene Portfolios, bei denen ich mich auf die Zusammenstellung und den Titel zu den einzelnen Bildern beschränkte: VOM MYTHOS DES FLIEGENS und DIE ANDEREN. Zu achtzehn anderen Bildern habe ich sogenannte Short-Stories geschrieben, die ich (in Ableitung des Buchtitels) als Gedankensplitter bezeichnen möchte.«
Fünf Bilder aus diesem Prachtband fanden 1991 als Titelbilder für das neue fünfbändige Lexikon Verwendung. Und als die Storys im Rahmen der »Gesammelten Kurzgeschichten von William Voltz« in Band 60 der Reihe UTOPIA CLASSICS neu aufgelegt wurden, da zierte auch ein Bild aus »Zeitsplitter« das Cover.
Eine bahnbrechende Risszeichnung
Seit ihrem ersten Auftreten in PERRY RHODAN-Heft 192 sind die Risszeichnungen ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Perryversums, der sich von seinen Anfängen heraus bis heute immer weiter entwickelt hat und von einigen Generationen von Risszeichnern geprägt wurde. Zumeist folgten die in den PR-Heften vorgestellten Raumschiffe Vorgaben aus der Heftserie, bisweilen wurden aber auch eher ungewöhnliche Eigenkonstruktionen präsentiert. Die war beispielsweise der Fall bei dem in PERRY RHODAN Band 1059 »Fels der Einsamkeit« gezeigten »Abfangjäger der neuen REDHORSE-Baureihe«. Er entstammte dem Ideenreichtum und der Spontanität von Jürgen Rudig, der nur wenige seiner Kreationen im PERRY RHODAN MAGAZIN und in der Heftserie veröffentlichte, bevor er 1982 sein letztes Werk ablieferte. Nach Veröffentlichung der RZ des Redhorse-Jägers kam es zu massiver Kritik der Leser auf der LKS, wobei einige Fans bemängelten, dass die Zeichnung mit der freien Hand durchgeführt worden war, Worte wie ein »Fliegender Schrotthaufen« oder »Risszeichnung« als Beleidigung machten die Runde. Es war das erste Mal, dass die Leser sich derart kontrovers zu einer RZ äußerten. Rudigs Kollege Gregor Sedlag machte sich 2011 vor dem WeltCon in Mannheim auf die Spurensuche und wusste in seinem Internet-Blog über den Zeichner und seine so gemischt aufgenommene Eigenkreation Interessantes zu berichten:
Interview: Alles nur ein Spaß? 30 Jahre Redhorse-Jäger – Ein Interview mit Jürgen Rudig, geführt von Gregor Sedlag
Die beste RZ aller Zeiten? Terranische Raumschiffe: Abfangjäger der neuen »Redhorse«-Baureihe, Rudig 1981; Source: PR I, Band 1059 »Fels der Einsamkeit«
Als ich mir im Spätherbst 1981 an einem üblichen Dienstagmorgen vor Schulbeginn PERRY RHODAN 1. Auflage Band 1059 »Fels der Einsamkeit« am Kiosk kaufte, war ich wie alle vier Wochen insbesondere auf die neue Risszeichnung gespannt. Noch vor Ort schlug ich mit klopfenden Herzen die Heftmitte auf – und sofort wieder zu! Mein Leben war von diesem Augenblick an ein anderes. Noch nie in meinem Leben hatte ich etwas Seltsameres und Fremdartigeres gesehen als Jürgen Rudigs Abfangjäger der neuen »Redhorse«-Baureihe.
Zu dieser Zeit hatte ich schon erste Veröffentlichungen meiner eigenen Risszeichnungen als »Leser-RZ« erlebt, aber mir wurde in diesem Moment schlagartig klar, dass ich meinen Zeichenstil komplett würde umstellen müssen, um wirklich die Risszeichnungen anzufertigen, die ich mir bis dahin aber nur vage vorzustellen gewagt hatte.
Das ist jetzt beinahe 30 Jahre her, und im Zuge der Wiederbelebung dieses Blogs und des bevorstehenden WeltCons in Mannheim zum 50-jährigen Jubiläum der PERRY RHODAN-Serie hielt ich es für eine gute Idee, Kontakt mit Jürgen Rudig zu suchen, um ihn selber zu fragen, wie er das damals erlebt hat.
Wir haben kurz miteinander telefoniert und dann das folgende Interview per E-Mail geführt.
Jürgen Rudig ist Jahrgang 1958, verheiratet, hat zwei halbwegs erwachsene Kinder, ist seit fast 30 Jahren im öffentlichen Dienst, inzwischen Schulleiter einer weiterführenden Schule irgendwo im Hinterland von Aachen. Er hatte seit vielen Jahren kaum noch Kontakt mit PERRY RHODAN und dem SF-Fandom; umso mehr freut es mich, dass er hier Rede und Antwort stand.
Wie kam es zum »Redhorse-Jäger« – einer Risszeichnung, die auch im Vergleich zu deinen vorhergehenden Veröffentlichungen heraussticht?
Vor über 30 Jahren stand ich mitten im Studium in Aachen – Kunst und Deutsch – und wollte eventuell Lehrer werden. Mittelprächtig begabt, hatte ich neben dem Studium schon etliches verkaufen können und verdiente für einen Burschen von Anfang zwanzig gar nicht mal schlecht damit: Ölporträts nach Vorlage, Buchillustrationen für kleine regionale Verlage, Raumabwicklungen für Architekten, und – ja, klar – natürlich diese Risszeichnungen. Wie ich dazu kam, ein andermal. Es soll hier und heute ja vornehmlich um diesen vermaledeiten »Redhorse-Jäger« gehen, der wohl einigen Staub aufgewirbelt hat und mehr oder weniger das Ende meiner kurzen »Karriere« als Risszeichner einläutete.
Der »Redhorse-Jäger« war ja eine typische freie Arbeit, die mit dem »Perryversum« nur über die Namensgebung verbunden war, aber sie war nicht im luftleeren Raum entstanden.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass ich das Ding bei Jim Burns abgekupfert haben soll – oder zumindest davon motiviert gewesen wäre. Da ist sogar ein bisschen was dran, obwohl ich beim Zeichnen dieses Jägers – soweit ich das in der Erinnerung noch zusammenbekomme – schwer unter dem Eindruck von einer anderen illustren Größe der damaligen Zeit stand: Möbius.
Das nehme ich dir sofort ab. Die beiden verdutzten Piloten vorm Jäger könnten direkt aus der hermetischen Garage gesprungen sein!
Über die ersten Hefte von Metal Hurlant – »Schwermetall« – stolperte ich beim Stöbern im Katalog des Volksverlages, das muss 1979 gewesen sein. Die Möbius-Storys haben mich umgehauen – so locker, so dermaßen gekonnt, erkennbar mit einem Filzer hingeworfen … In einer Rezension las ich dann, dass Möbius angeblich einfach draufloszeichne, ohne konkreten Plan, ohne Vorzeichnung, eben einfach mit dem Filzer. Das wollte ich unbedingt auch versuchen, mit eigenen Comics, aber eben auch mit Risszeichnungen. Ich malte und zeichnete zu der Zeit sowieso sehr viel, probierte nun auch in dieser Richtung herum, entwarf großformatige Arbeiten – halb Comic, halb Risszeichnung –, kombinierte die Rotring-Feder mit dem Edding 3000. Die Ergebnisse waren eher zwiespältig und liegen zum Teil heute noch in meiner Sammlung vergraben.
Das ist eine gute Nachricht!
Ich nicht weiß, warum es eine gute Nachricht sei soll, dass ich noch alte RZs irgendwo vergraben habe. Ist es gut, dass die noch da sind? Oder ist es gut, dass sie so tief vergraben sind?
Spaß beiseite – ungefähr zur gleichen Zeit war ich dann mal wieder zu Besuch bei Willi Voltz zu Hause, um eine eher übliche Risszeichnung – ich weiß nicht mehr welche – abzuliefern, sauber eingerollt in eine Papprolle und fast 300 Kilometer im klapprigen Käfer meiner Freundin transportiert. Willi Voltz fand die RZ prima und nahm sie sofort, und dann schenkte er mir etwas: die beiden Bände »Mechanismo« und »Planeten Story« – beide Bücher habe ich heute noch.
Ich will nicht abstreiten, dass Jim Burns auf mich Eindruck machte (wie gesagt, ein bisschen was mag dran sein, dass der Gaussi-Jäger meinen »Redhorse« beeinflusste), aber – großes Aber! – siehe oben: Zu dem Zeitpunkt waren meine Ideen von halbschrottigen Raumschiffen, die von skurrilen Typen mehr improvisiert als geflogen wurden, von Raumfahrzeugen, denen man einen harten Arbeitsalltag ansah und die mit lockerer Hand eher hingeworfen als durchkonstruiert schienen, schon sehr weit gediehen.
OK, aber eine Risszeichnung ist zuerst einmal keine Comic-Illustration. Gewisse »Freiheiten« hattest du dir in deinen Arbeiten bis dahin immer herausgenommen, aber eben auch durch deine handwerklichen Qualitäten z. B. beim Setzen von Schraffuren so geschickt kaschiert, dass der Eindruck der technischen »Blaupause« immer erhalten geblieben ist. Beim »Redhorse-Jäger« hatte ich den Eindruck, dass du uns sagen wolltest: »Das mache ich jetzt extra schief und absurd!« Damit keiner mehr auf die Idee kommt, das Ding könnte es wirklich mal geben.
Ich war des von mir zumindest so empfundenen Bierernsts der Szene um die RHODAN-Serie eigentlich satt. Als begeisterter, kritischer Leser von Lem, den Strugatzkis u. a. hatte ich den Hype (so würde man heute wohl sagen) um diese Weltraumserie sowieso nie ganz begriffen. Auch wollte ich eigentlich weg von der ganzen Matrosen-Ästhetik mit »Decks«, »Geschützpforten«, »Kommandoständen«, »Außenschotts« etc. Ich war immer der Meinung, Raumschiffe – und die Typen, die sie fliegen – sehen in zweitausend Jahren ganz anders aus als für uns vorstellbar. Raumschiff Orion mit seiner ganz eigenen Ästhetik imponierte mir z.B. viel mehr als der ganze Star Wars-Kram.
Also, langer Rede kurzer Sinn: Es musste mal was Spaßiges, was anderes her, und zudem lebte ich in dem Gottvertrauen darauf, dass man mir auch »so was« im wahrsten Sinne des Wortes abkaufen würde, vielleicht sogar Verständnis dafür hätte, mich unterstützen würde … Ansonsten konnte ich ja noch genug alte Omas und Kommunionskinder in Öl produzieren.
Interessant, dass du doch deutlich in Distanz zu PERRY RHODAN gehst – gerade, wenn man deine urtypisch »rhodanesken« Arbeiten Shift und Korvette (Neukonstruktion) aus den PR-Sonderheften betrachtet.
Ich hatte meinen Adlatus Ralf, einem Freund aus der Abi-Zeit, der mir als verschworener RHODAN-Freak von Anfang an immer gerne die notwendigen Daten lieferte. So entwarf ich also an einem Nachmittag den »Redhorse- Jäger« (und ich meine ehrlich, ich hatte da den Gaussi- Jäger zumindest bewusst schon wieder vergessen oder verdrängt). Hatte ich bisher immer sorgfältig tagelang mit Bleistift vorgezeichnet und dann Stück um Stück mit Rotring nachgearbeitet, so warf ich jetzt nur die Perspektive und ungefähre Abmessungen Freihand mit Bleistift aufs A2-Papier, um dann sofort mit Rotring und Edding loszulegen. Wobei diese Kombination im Original nie besonders gut aussah, denn der Rotring trocknete tiefschwarz, der Edding eher matt und gräulich.
Schade, dass bei dieser »integrativen« Zeichentechnik im Gegensatz zur »klassischen« Methode mit dem Abtuschen auf Transparentpapier die oft sehr ausdrucksstarke Bleistiftvorzeichnung vernichtet wird.
Nun, wie dem auch sei: das Ding wurde sehr schnell fertig, sah im Original ulkig und gar nicht mal schlecht aus. Und Ralf konnte mich nur mit Mühe davon abhalten, noch mehr Blödsinn einzubauen. Er prophezeite mir weise vorausschauend, ein schlimmes (Risszeichner)-Ende. Aber ich war nicht mehr zu halten: Das Ding musste auf den Postweg, mal gucken wie der Verlag reagiert … Ich könnte ja auch gerne wieder, falls gewünscht, was »Normales« zeichnen, dachte ich ganz naiv damals.
Als ob deine anderen RZs jemals »normal« gewesen wären …
Tja, das »Ding« wurde dann tatsächlich also gedruckt, ohne vorher mal nachzufragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte, oder ohne das »Ding« einfach kommentarlos zurückzuschicken mit der freundlichen Bitte, mich erst mal gründlich auszuschlafen und dann noch mal anzurufen … Ich hätte es verstanden. Den Mut des nun Verantwortlichen in der Redaktion – ich habe heute keine Ahnung mehr, wer das war – bewundere ich ehrlich, die »etablierten« RHODAN- Leser mit dieser »ernstgemeinten Spaßnummer« von einem Raumvogel zu düpieren. Immerhin war ich bis dahin nur im PERRY RHODAN-Magazin gedruckt worden.
Also meines Wissens war Willi Voltz doch zu dieser Zeit der dafür Verantwortliche. Ich kann mich an ein Risszeichnertreffen im Oktober 1982 bei Willi in Heusenstamm erinnern – für mich damals ein Ritterschlag, dabei sein zu dürfen –, bei dem du auch gewesen bist und noch faszinierendere Arbeiten präsentiert hast.
Aber neben diesem Gag und all dem Spaß, den Ralf und ich damit hatten, bleibt für mich bis heute der durchaus ernst zu nehmende Hintergrund und Anlass für diese Zeichnung, das eigentliche Unvermögen, sich wirklich vorzustellen, wie solche Fahrzeuge in ein- oder zweitausend Jahren aussehen und funktionieren mögen. Wer sich einen Raumjäger als perfektionierten Düsenjäger vorstellt und einen Raumkreuzer als Weltkriegsschlachtschiff mit Laserkanonen und großen Heckflossen, begeht m. E. den gleichen Fehler wie die phantastischen Autoren des 18. bzw. 19. Jahrhunderts, die auch nur ihre Kenntnisse von Technik lediglich in die Zukunft umsetzten. Wobei Jules Verne der Sache noch am nächsten kam, aber letztlich ja auch der Ästhetik seiner Zeit verhaftet blieb.
In diese Kerbe haut auch das Leitmotiv dieses Blogs: »Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.« (Arthur C. Clarke)
Aber andere – und vielleicht bessere – Risszeichner als ich erkannten das ja auch, setzen diesen Gedanken aber vielleicht etwas »sozialverträglicher« (sprich »serienverträglicher«) um.
Jedenfalls war meine kurze Karriere als »Shooting-Star« der RZ-Szene (vom »technisch und zeichnerisch höchst begabten Leser«, siehe PERRY RHODAN-SONDERHEFT Nr. 1, hin zum Sündenfall der Szene mit anschließendem »Rauswurf«) damit im Großen und Ganzen beendet. Eine Zeichnung konnte ich noch – ohne großen Erfolg offensichtlich – unterbringen (»Raumschiff der Namenlosen«, PR 1123); der RZ-Zeichnerclub reagierte, soweit ich mich erinnere, gar nicht mehr auf mich bzw. ließ mich ab da links liegen … Dann war’s das für mich wohl gewesen mit PERRY RHODAN.
Ich kann nicht bestätigen, dass du wegen des »Redhorse-Jägers« auf eine schwarze Liste gekommen wärest. Im Übrigen war der der Konsens schon ab Mitte 1983, dass diese RZ ein wichtiger Meilenstein für das Genre gewesen ist – vielleicht vergleichbar mit dem Punk-Klassiker »Never Mind the Bollocks« der Sex Pistols.
Viel mehr bleibt nicht zu sagen – dass der gute alte »Redhorse-Jäger« offensichtlich eine sehr kontrovers geführte Diskussion auslöste, finde ich im Nachhinein – ich erfuhr erst Jahre später zufällig davon, als mich das alles längst nicht mehr interessierte – eigentlich gar nicht schlecht.
Irgendwann in diese Zeitspanne fiel – soweit ich es erinnere – der für mich und wohl auch viele andere unerwartete und sehr bedauerliche Tod meines Mentors Willi Voltz. Er war ein sehr sympathischer, zurückhaltender und intelligenter Mann, den ich damals sehr mochte und bewunderte.
Aber zu dem Zeitpunkt lockten schon ganz andere Aufträge und – im wahrsten Sinne – neue »Perspektiven«.
TERRA ASTRA – Die letzte Inkarnation
Im Laufe der Jahrzehnte hatte sich still und leise ein Wandel in der Grundkonzeption der TERRA-Reihen vollzogen. Die erste, die Original-TERRA-Reihe, war noch darauf konzentriert gewesen, zusammen mit dem später gestarteten TERRA SONDERBAND dem deutschen Leser neben günstigen Leihbuch-Nachdrucken oder Originalromanen deutschsprachiger Autoren die ganze Vielfalt der angloamerikanischen SF nahezubringen, was wegen der Umfangbegrenzung auf 64 bzw. 96 Seiten bei den ausländischen Titeln fast immer nur mit teilweise erheblichen Kürzungen möglich war. Der Siegeszug des Taschenbuchs brachte es dann in den 1960er Jahren mit sich, dass sich die Veröffentlichung fremdsprachiger Autoren mehr und mehr dorthin verlagerte, wo Texteingriffe, falls umfangmäßig erforderlich, in der Regel nicht so gravierend waren. Mit dem Start der Zusatzreihe TERRA EXTRA war dann eine Veröffentlichungsplattform für die früheren Romane deutscher Autoren, vor allem aus der Autorenriege von PERRY RHODAN, geschaffen worden, und als TERRA und TERRA EXTRA schließlich 1971 zu TERRA NOVA fusioniert wurden, vereinigte die neue TERRA-Inkarnation neben Neuherausgaben angloamerikanischer Titel beides: die Publikation sowohl früherer Texte deutscher Autoren als auch Romane und Kurzgeschichten von hoffnungsvollen Newcomern, die sich hier für »höhere Weihen«, also den Einstieg zunächst bei ATLAN als auch schließlich als krönenden Höhepunkt die Aufnahme ins Autorenteam von PERRY RHODAN, qualifizieren mussten. Und TERRA ASTRA als direkte Nachfolgerin von TERRA NOVA erfüllte genau den gleichen Zweck.
Dass das Taschenbuch den Heftroman als Massenpublikation ablöste, hatte einen dramatischen Einfluss auf die gesamte Marktsituation. Die Verkaufszahlen bei den Heftromanen gingen signifikant zurück, und das hatte zur Folge, dass in der Spannungsliteratur das große Romanheftsterben begann. Etliche Verlage verschwanden im Zuge dieser Marktbereinigung total von der Bildfläche, wie etwa der Kölner Marken-Verlag, andere verlegten sich darauf, kostengünstig immer wieder frühere Romane neu herauszubringen, oftmals unter Verwendung der alten Druckunterlagen, wie der Hamburger Kelter-Verlag, oder sie wurden von anderen Verlagen »geschluckt«, wie der ebenso wie Pabel-Moewig in Rastatt ansässige Zauberkreis Verlag.
Auch bei Pabel-Moewig blieben diese Vorgänge nicht ohne Wirkung. Im Verlauf der 80er Jahre mussten zahlreiche Objekte, die früher Stützen des Verlagsgeschäfts gewesen waren, aus kalkulatorischen Gründen vom Markt genommen werden, wie die Seefahrer-Serie SEEWÖLFE oder KOMMISSAR X und DIE SCHWARZE FLEDERMAUS, zwei Krimi-Klassiker mit Kultstatus. Zu Beginn der 80er Jahre jedenfalls war die Welt noch in Ordnung, zumindest was die SF-Hefte des Verlags betraf. Aber für TERRA ASTRA war 1981 das letzte Jahr, in dem noch Woche für Woche ein neuer Titel auf den Markt gebracht wurde. Mit Jahresbeginn 1982 musste auch hier den veränderten Marktbedingungen Rechnung getragen und die Reihe auf vierzehntägliches Erscheinen umgestellt werden.
In diesem letzten »normalen« Jahr wurde TERRA ASTRA eindeutig von Originalromanen und deutschen Erstveröffentlichungen dominiert. Neben zwölf neuen Romanen zur Serie ORION gab es 28 weitere neue Titel, 25 davon von deutschen Autoren. Die Nase vorne hatten der damals nur bei ATLAN mitschreibende Arndt Ellmer und Andreas Werning, Pseudonym von Andreas Brandhorst, der unter Andreas Weiler bei den TERRANAUTEN mitarbeitete und im neuen Jahrtausend zwei Romane zu den PR-Taschenbuch-Zyklen LEMURIA und PAN-THAU-RA beisteuerte, mit jeweils fünf Heften. Arndt Ellmer publizierte den »Louden«-Zweiteiler »Einsatz in Louden« und »Der Kaiser von Louden«, die Storysammlung »Die Osterinvasion« und die ersten beiden Romane seines STERNENKINDER-Zyklus: »Das Geheimnis der Taggari« und »Der Kopfjäger von Rykvar«. Andreas Werning publizierte die jeweils zusammengehörenden Hefte »Zwischen Gestern und Morgen« und »Leclerc, der Ketzer«, »Pfad in Nichts« und »Planeten-Odyssee« sowie den Einzelroman »Rendezvous mit der Hölle«. Jeweils drei Romane steuerten Falk-Ingo Klee und Wilfried Hary bei, jeweils zwei Titel stammten von Peter Griese und L.D. Palmer alias Uwe Anton, späterer PR-Autor und Expokrat. Mit einem Roman waren Wolfgang Sternbeck, Michael Sullivan, Iris Kruse, Michael Nagula und Peter Terrid (17. Roman um die TIME SQUAD) vertreten. Die Bestseller, die neu aufgelegt wurden, dominierte Ernst Vlcek mit nicht weniger als neun Bänden, einer stammte von H.G. Ewers. Auf den von Günter M. Schelwokat zusammengestellten Leserkontaktseiten, dem »Terra Astra Report«, fanden sich neben den vierwöchentlichen Vorschauen auf die kommenden SF-Publikationen Artikel von Falk-Ingo Klee, Michael Adrian, Peter Griese, Michael Nagula und Manfred Riepe, Rezensionen vom Chronisten dieses Bandes, der auch ein Autorenporträt von H. Kenneth Bulmer lieferte, und ein Bericht vom 19. SF-Filmfestival in Triest von Walter Ernsting. Arndt Ellmer stellte sich selbst in Wort und Bild vor, und William Voltz berichtete über den Start des neuen ATLAN-Zyklus DIE SOLANER.
Bei den nach wie vor von PERRY RHODAN-Autor H.G. Ewers exposémäßig gesteuerten ORION-Romanen, die seit Band 82 keine eigene Reihe mehr hatten und in vierwöchentlichem Rhythmus wieder in TERRA ASTRA liefen, war Horst Hoffmann für die Leserbetreuung zuständig. Er brachte auf seinen Report-Seiten nicht nur Leserbriefe – wobei er auch vor dem Abdruck von sehr kritischen Meinungen nicht zurückschreckte –, sondern auch den Kurzroman »Todesunternehmen Karo Acht« des Lesers Bernard Lohner um die Crew des Schnellen Raumkreuzers und einige auch von den ORION-Lesern hochgeschätzte Risszeichnungen, und zwar vom Großen Schiff der Dara, dem RUN-WAAGO der Anchorannies, einem Raumschiff der Vorthianer, von THORS HAMMER, dem SPACE CRUDE CARRIER (SCC) und vom Expeditionsraumschiff MAAGAN. Die Romane stammten ausschließlich von Autoren, die auch an ATLAN und/oder PERRY RHODAN mitschrieben, und zwar von H.G. Ewers, Harvey Patton, Hans Kneifel und Horst Hoffmann, der auch zwei Jugendabenteuer der Crew verfasste.
1 GMS = Abkürzung für Redakteur Günter M. Schelwokat
2 Siehe auch Kurzbiografie von Michael Nagula in Perry Rhodan-Chronik Band 1.