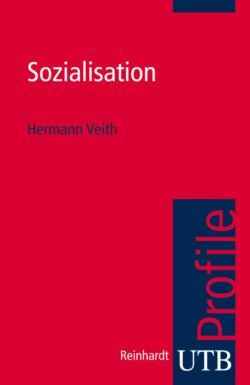Читать книгу Sozialisation - Herrmann Veith - Страница 7
Оглавление1
Warum sind wir zur Selbstbestimmung gezwungen?
Gesellschaften benötigen zu ihrer eigenen Stabilität und Erneuerung handlungsfähige Personen. Moderne Sozialsysteme sind dabei in besonderer Weise auf eigenständige, verantwortungsbewusst und reflexiv agierende Individuen angewiesen. Die zur Teilhabe am sozialen Leben wichtigen Kompetenzen können durch Sozialisation und Bildung erworben werden. Allerdings gibt es dafür keine Garantie.
Kernaussage
Auch unter günstigen äußeren Lebensumständen sind biografische Risikoentwicklungen möglich und umgekehrt können Menschen in schwierigen Verhältnissen durchaus alltagstaugliche Handlungsfähigkeiten und Subjektautonomie entwickeln. Dieses hängt unter anderem damit zusammen, dass der Sozialisationsprozess von den sich entwickelnden Subjekten selbst aktiv mitgestaltet wird.
Es gibt keine kausale Determination der Person durch die Umwelt. In fast allen einschlägigen Veröffentlichungen werden heute deshalb ausdrücklich die Eigenaktivitäten des Individuums bei der Aneignung kultureller Wissensbestände, sozialer Normen und alltagspraktischer Handlungsroutinen hervorgehoben (Geulen 2005, Grundmann 2006, Zimmermann 2006). Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die entsprechenden konzeptionellen Grundlagen der modernen Sozialisationsforschung. Ausgehend von einer begriffsgeschichtlich angelegten Problembeschreibung werden das Sozialisationskonzept konkretisiert und die wichtigsten Bezugstheorien genannt. Schließlich wird begründet, warum sozialisationstheoretisches Wissen praktisch nützlich ist.
Am Anfang war das Wort
Der Begriff „Sozialisation“ leitet sich wortgeschichtlich aus dem englischen Verb „to socialize“ ab. Dieses findet sich erstmals 1828 im Oxford Dictionary in der Bedeutung von „to render social, to make fit for living in society“ (Clausen 1968, 21). Da man Begriffe besser versteht, wenn man den Kontext kennt, in dem sie verwendet werden, soll zunächst kurz beschrieben werden, wie das Wort Sozialisation alltagssprachlich aufkam und in die wissenschaftliche Diskussion einsickerte.
1. Das Wort „Sozialisation“: Bekanntermaßen hat die Industrialisierung in England deutlich früher eingesetzt als in anderen Staaten. Mit der Auslagerung der gewerblichen Produktion aus den Hauswirtschaftsbetrieben entwickelten sich überall neue Formen der Arbeitsteilung. Im Räderwerk der dampfgetriebenen Maschinen und mechanisierten Fabrikanlagen wurden – bildlich gesprochen – die traditionellen Lebensordnungen der agrarständischen Welt zerrieben. Die moderne Zeitordnung war nicht mehr zyklisch wie das Kalenderjahr, sondern linear, zukunftsgewandt und fortschrittsorientiert. Dabei war es immer weniger möglich, die zur Lohnarbeit benötigten Kompetenzen im alltäglichen Miteinander zu erlernen. Um „fit“ zu werden, und das hieß ganz elementar, um die eigenen individuellen Existenzgrundlagen sichern zu können, war es auch im gesellschaftlichen Interesse erforderlich, dass die Einzelnen ihr Verhalten den veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen anpassten. Für den Erwerb entsprechend sozial verwertbarer und nützlicher Qualifikationen und Alltagspraktiken wurde das Verb „to socialize“ gebräuchlich.
Kernaussage
Um in der Gesellschaft einen Platz zu finden und etwas aus sich und seiner Persönlichkeit zu machen, war man als Individuum auf sich selbst gestellt, zur Selbstbestimmung gezwungen.
Statt einer Gemeinschaft qua Herkunft einfach anzugehören, sah man sich nun der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen sozialen Systemen, Organisationen und Gruppen gegenüber. Wer integriert sein wollte, musste lernen, wie man sich außerhalb der familiären Lebenswelt als Schüler in der Schule, als Erwerbstätiger im Betrieb, als Staatsbürger im politischen System oder als Nachbar im Wohnviertel zu verhalten hatte. Für diese Form des kontinuierlichen und auf immer unterschiedlichere normative Kontexte bezogenen biografischen Rollenlernens wurde es am Ende des 19. Jahrhunderts üblich, das Substantiv „socialization“ zu verwenden.
2. Der wissenschaftliche Begriff „Sozialisation“: Zur selben Zeit setzte sich in der wissenschaftlichen Diskussion die Auffassung durch, dass die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich durch die „gesellschaftlichen Verhältnisse“ beeinflusst wird (Marx/Engels 1845/46). Kurz vor der Jahrhundertwende erschienen fast zeitgleich mehrere Veröffentlichungen, in denen der Begriff „Sozialisation“ ausdrücklich vorkommt (Veith 2008). Das war kein Zufall. Tatsächlich sahen die Zeitgenossen, dass die industriegesellschaftlichen Konflikte und Verwerfungen – der Gegensatz zwischen Reichtum und Armut, die zunehmende Verstädterung und die Arbeitsmigration – nicht nur die Grundlagen der alten Ständeordnung, sondern das kapitalistische System selbst erschütterten.
Für den französischen Soziologen und Erziehungswissenschaftler Emile Durkheim (1858–1917) gab es keinen Zweifel, dass der Individualismus des modernen Industriezeitalters archaische psychische Willenskräfte mit ambivalenten sozialen Folgen entfesselte. Denn die Wirtschaftsgesellschaft weckte mit ihren verlockenden Angeboten ein schier unbändiges Verlangen nach immer neuen Glücksgütern. Da die breite Masse der Bevölkerung jedoch vom Konsum ausgeschlossen blieb, waren Klassenspannungen unvermeidbar. Beides, der gierige Eigennutz und die Zuspitzung der sozialen Frage, waren brandgefährlich, weil sie die ohnehin porösen lebensweltlichen Fundamente der Gesellschaft unterspülten. Durkheim war überzeugt, dass ohne gemeinsam geteilte Wertbindungen die Egomanie der Selbstsüchtigen alle sozialen Dämme durchbrechen würde. Die Ursache dafür sah er aber nicht, wie viele seiner Kollegen, in einem angeborenen Machttrieb oder einer vererbten Charakterschwäche und Verderbtheit, sondern ganz eindeutig im Autoritäts- und Geltungsverlust elementarer, das soziale Gemeinschaftsleben ordnender Institutionen (Durkheim 1893). Ohne Solidarität und verbindliche Konventionen – so sein Argument – fehlten die sozialen Triebkräfte zur Entwicklung fester innerer Werthaltungen.
Kernaussage
Das moralische Regelbewusstsein ist nicht angeboren, vielmehr entstehen und entwickeln sich die individuellen Normvorstellungen erst im Verlauf des Sozialisationsprozesses. Mit dieser Prämisse war die moderne sozialisationstheoretische Diskussion eröffnet.
3. Das theoretische Modell: Durkheim selbst konkretisierte diesen Grundgedanken mit Hilfe der Unterscheidung von individuellen und sozialen Ich-Strukturen. Während im „individuellen Ich“ die egoistischen und ihrer Natur nach asozialen Triebregungen angelegt sind, repräsentiert das „soziale Ich“ die gesellschaftlichen Normen (Durkheim 1897). Diese werden im Sozialisationsprozess verinnerlicht. Ein schwaches „soziales Ich“ wird von den asozialen Strebungen seines „individuellen“ Gegenspielers hinweggerissen. Einem gefestigten „sozialen Ich“ hingegen gelingt es, die inneren Triebimpulse zu disziplinieren und in gesellschaftlich akzeptierte Bahnen umzulenken.
Auch Durkheims Zeitgenossen arbeiteten mit ähnlichen Modellvorstellungen oder sprachen mit etwas anderer Akzentuierung von „Identität“ (Simmel 1908), vom „Spiegelselbst“ (Cooley 1902), vom „Über-Ich“ (Freud 1923) oder vom „Me“ (Mead 1934). Gemeinsam vertraten alle die Auffassung, dass sich niemand, und schon gar nicht die Heranwachsenden, den „Zwängen“ der gesellschaftlichen Umwelt entziehen können.
Kernaussage
Im Sozialisationsprozess werden soziale Normen und kulturelle Wissensbestände übertragen, angeeignet und verinnerlicht. Dort, wo diese Übertragung systematisch geplant und mit klaren pädagogischen Absichten organisiert wird, handelt es sich um „Erziehung“ – in Durkheims Worten: um „socialisation méthodique“ (Durkheim 1902/03).
Erst in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen lernen die Einzelnen, sich in ihrer Umgebung zu orientieren. Sie beginnen, die Welt durch die Brille ihrer Kulturgemeinschaft zu betrachten, und nach nur wenigen Jahren bewegen sie sich wie die anderen, sprechen deren Sprache, verfolgen dieselben Ziele und denken in den gleichen kognitiven, ethischen und ästhetischen Kategorien.
Sozialisation und Entwicklung
Nach der heute gängigen Definition des Bielefelder Sozialisationsforschers Klaus Hurrelmann bezeichnet der Begriff der Sozialisation „den Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und dinglich-materiellen Umwelt“ (Hurrelmann 2006, 70). Diese noch sehr allgemeine Bestimmung lässt sich in fünf Punkten konkretisieren:
• Sozialisationsprozesse basieren auf dem komplexen Zusammenwirken von sehr unterschiedlichen konstitutionellen, genetischen, physiologischen, psychischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Faktoren. Die wesentlichen Triebkräfte der Individualentwicklung sind die tätigkeitsgebundenen Erlebnisse und Erfahrungen, die ihren Ausdruck und Niederschlag in den sich bildenden Handlungsfähigkeiten und den auf Selbstreflexion angelegten Persönlichkeitsstrukturen finden (Fend 2003).
• Sozialisation ist ein das ganze Leben andauernder Prozess. In der Sozialisationsforschung war es lange Zeit üblich, die besondere Bedeutung der Lernerfahrungen im frühen Kindes- und Jugendalter durch die Unterscheidung zwischen einer „primären“ und „sekundären“ Sozialisationsphase hervorzuheben (Berger/Luckmann 1969). Dabei wurde angenommen, dass sich die grundlegenden, die weitere biografische Entwicklung bestimmenden Kompetenzen und Charakterstrukturen schon in den ersten Lebensjahren herausbilden. Allerdings entspricht die damit assoziierte Vorstellung, dass mit dem Erwachsenenalter ein relativ stabiler Reifezustand erreicht wird, nicht mehr den heutigen Lebenserfahrungen. Darum wird der Sozialisationsprozess nunmehr mit Blick auf die gesamte Lebensspanne und die jeweils dominanten „altersspezifischen“ Probleme und Entwicklungsaufgaben thematisiert (Elder 2000).
• Sozialisationsprozesse sind immer in historisch vermittelte, kulturund sprachgemeinschaftliche Kontexte eingebettet. Durch die Einbeziehung in unterschiedliche Sozialsysteme, Institutionen und Interaktionszusammenhänge lernen die Einzelnen, ihre praktischen und kommunikativen Aktivitäten auf die verschiedenen Erwartungen und Sprachgewohnheiten ihrer Bezugspersonen, Gruppen und Sozialmilieus einzustellen (Grundmann 2006).
• Die individuellen Handlungsfähigkeiten entwickeln sich im Sozialisationsprozess auf der Grundlage der subjektiven Auseinandersetzung des Einzelnen mit den vorgefundenen Umweltbedingungen. Dabei wird angenommen, dass der Umgang mit Dingen und anderen Menschen, aber auch das Verhältnis zur eigenen Person stets von den individuellen Vorerfahrungen abhängig ist. Das heißt, dass die Art und Weise, wie eine Situation erlebt wird, nicht allein von den „objektiven“ Gegebenheiten, sondern von der persönlichen Wertigkeit und Erwartungshaltung abhängt (Mansel/Hurrelmann 2003).
• Im Zentrum der sozialisationstheoretischen Diskussionen steht die Erklärung der Entwicklung von Subjektautonomie und alltagstauglichen Handlungsfähigkeiten (Hurrelmann 2006). In dem Maße, in dem Gesellschaften Individualisierungsprozesse ermöglichen und erfordern, können und müssen die Einzelnen ihr Leben in Eigenregie in die Hand nehmen und lernen, kompetent, verantwortungsbewusst und autonom zu handeln (Zinnecker 2000, Bauer 2002). Insofern sind wir auch heute, wenngleich in veränderten gesellschaftlichen Konstellationen, ganz entschieden zur Selbstbestimmung gezwungen.
Theorien der Sozialisation
Die moderne sozialisationstheoretische Diskussion wurde von sehr unterschiedlichen Wissenschaftlern beeinflusst und geprägt. Bis heute gibt es keine allgemein akzeptierte Theorie, dafür aber eine Vielzahl von einzelnen Erklärungsansätzen. Diese werden in der Literatur häufig unter disziplinären Gesichtspunkten als soziologische und psychologische Basiskonzepte vorgestellt (Faulstich-Wieland 2000). Zieht man die verschiedenen theoriehistorischen Arbeiten heran (Geulen 1980, 1991; Veith 1996, 2001), schält sich ein relativ stabiler Korpus von Erklärungsansätzen und Autoren heraus (Tabelle 1). Nur wenige der genannten Konzepte sind, wie die Theorie des Rollenlernens von Talcott Parsons, ausdrücklich als Sozialisationstheorien formuliert worden, und viele der namentlich aufgelisteten Wissenschaftler wurden erst sehr viel später als Sozialisationstheoretiker entdeckt. Dieses gilt insbesondere für George Herbert Mead, Alfred Schütz und Jean Piaget. Wissenschaftlich durchgesetzt hat sich das Sozialisationskonzept im deutschen Sprachraum in den 1970er Jahren im Kontext der Bildungsreformdebatte und der Diskussion über herkunftsbedingte Benachteiligungen.
Warum ist sozialisationstheoretisches Wissen wichtig?
Falls Sie sich jetzt fragen, wozu diese konzeptionellen Erläuterungen und diese vielen Theorien in der Praxis nützlich sein sollen, stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie selbst hätten Kinder. Welche pädagogischen Angebote würden Sie sich wünschen? Ganz sicherlich wären Sie froh, wenn es in Ihrer Nachbarschaft Spielplätze und Sportvereine gäbe. Noch besser wäre es, wenn gute Kindergärten und Schulen, vielleicht auch noch Elterncafés und Beratungseinrichtungen vor Ort wären. Vor allem aber würde es Sie beruhigen, zu wissen, dass diejenigen, denen Sie Ihre Kinder anvertrauen, professionell arbeiten, d. h. konkret: über ein fundiertes fachliches Wissen in ihren jeweiligen Spezialgebieten verfügen, methodisches Geschick zeigen, diagnostischen Sachverstand besitzen, Einfühlungsvermögen haben und ihre eigene Tätigkeit selbstkritisch reflektieren. Solche Erwartungen sind legitim. Gerade im Erziehungs-und Bildungsbereich müssen die Fachkräfte heute sehr hohen theoretischen und praktischen Kompetenzansprüchen genügen:
• Von Erziehern wird erwartet, dass sie hinreichende Kenntnisse über die vielschichtigen Bedürfnisse von Kleinkindern mitbringen. Sie sollten in der Lage sein, über Pflege- und Betreuungsleistungen hinausgehend eine pädagogisch anregende, ja sogar bildungswirksame Atmosphäre herzustellen. Außerdem sollten sie ihre eigene Rolle als besondere Bezugs- und Bindungspersonen entwicklungssensibel hinterfragen (Tietze et al. 2005).
• Von Lehrern wird verlangt, dass sie gleichzeitig unterrichten, erziehen, beurteilen und aktiv ihre Schule entwickeln. Dabei arbeiten sie mit Kindern und Jugendlichen zusammen, die bereits früh unter Leistungsdruck gestellt, noch ganz am Anfang ihrer biografischen Entwicklung stehen. All das erfordert neben schulfachbezogenen Kompetenzen ein hohes Maß an psychosozialem Feingefühl, praktischer Perspektivenübernahmefähigkeit und selbstkritischer Reflexion (Beutel et al. 2006).
• Sozialpädagogen und Sozialarbeiter sind Experten im Umgang mit verhaltensauffälligen Personen. Sie beschäftigen sich mit Fällen von körperlicher und seelischer Gewalt, von sexuellem Missbrauch, Vernachlässigung oder Verwahrlosung. Dabei wird von ihnen erwartet, dass sie in der Lage sind, psychosoziale Gefährdungslagen zu erkennen und hilfebedürftige Menschen bei der Bewältigung ihrer Probleme oder beim Aufbau neuer Handlungsfähigkeiten zu unterstützen (Böhnisch 2005).
• Berater sehen sich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert.
Ob Ehekonflikte, Erziehungsschwierigkeiten, Schulprobleme oder Drogenmissbrauch, immer hängt der Beratungserfolg entscheidend davon ab, wie es ihnen gelingt, gemeinsam mit ihren Klienten alltagstaugliche, auf die konkreten Personen und deren Lebenssituation zugeschnittene Handlungsperspektiven zu entwickeln (Nussbeck 2006).
Tabelle 1: Sozialisationstheoretische Konzepte
Kernaussage
Alle diese Berufe setzen ein hohes Maß an körperlicher und psychischer Belastungsfähigkeit voraus. Vor allem aber erfordern sie theoriegeleitetes Wissen über den menschlichen Sozialisationsprozess.
Wer professionell pädagogisch arbeiten will, sollte in der Lage sein, individuelle Entwicklungsstände zu erkennen. Zum Verständnis der Lebenssituation einer Person ist es außerdem wichtig, zu wissen, wodurch sich die Interaktionspraktiken in den verschiedenen Sozialisationsinstanzen unterscheiden. Dazu gehören ganz konkrete Kenntnisse über die sozialisatorischen Funktionen von Bezugspersonen, Gruppen und Organisationen. Vor allem aber benötigt man Wissen über die Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung. Gerade in der pädagogischen Praxis steht man immer wieder vor der Frage, was noch „normal“ und was bereits abweichendes Verhalten ist. Wer sich hier auf seinen gesunden Menschenverstand verlässt, stößt sehr schnell auf Widerstände und Grenzen. Häufig wird dann die Arbeit, die man mit viel Idealismus angefangen hat, zu einer überfordernden Belastung.
Literatur
Grusec, J.E., Hastings, P.D. (Hrsg.) (2007). Handbook of Socialization. Theory and Research.
Im Mittelpunkt des amerikanischen Handbuchs steht die Familie als zentrale Sozialisationsinstanz. Neben den gesellschaftlichen Bedingungen liegen weitere Schwerpunkte in der Darstellung der biologischen Entwicklungsbedingungen und der interkulturellen Aspekte von Sozialisation und Erziehung.
Hurrelmann, K., Grundmann, M., Walper, S. (Hrsg.) (2008): Handbuch Sozialisationsforschung.
In dem umfangreichen Herausgeberband wird in zahlreichen Einzelbeiträgen das Gegenstandsfeld der Sozialisationsforschung in seiner ganzen Breite dargestellt. Neben den theoretischen, historischen und konzeptionellen Grundlagen werden die verschiedenen Sozialisationskontexte sowie die unterschiedlichen Dimensionen der Persönlichkeitsentwicklung behandelt.
Internet
http://www.juventa.de/zeitschriften/zse/
Unter dieser Webadresse findet man sowohl das Gesamtregister der „Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation“ (ZSE) als auch die Inhaltsverzeichnisse der vierteljährig erscheinenden Ausgaben des aktuellen Jahrgangs. Die Zeitschrift gibt es seit 1981. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet und versteht sich als Forum für Theoriediskussionen und Plattform zur Darstellung aktueller Forschungsergebnisse.
http://www.bildungsserver.de/
Der Deutsche Bildungsserver bietet vielfältige Informationen zu aktuellen pädagogischen und sozialisationsrelevanten Themen und Tagungen sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Literaturrecherche.