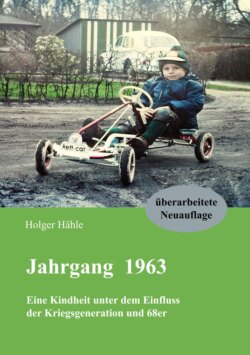Читать книгу Jahrgang 1963 - Holger Hähle - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, lass das sein
ОглавлениеImmer wieder hatte ich den Eindruck, ich kann nichts. Zu selten gelang mir etwas so, wie ich es wollte. Meine Unfähigkeit wurde mir zu einer beinahe täglichen Erfahrung.
Besonders dramatisch empfand ich das, als ein Junge eine Zauneidechse gefangen hatte. Jedes Kind durfte das Tier in die Hand nehmen und streicheln. Obwohl das Tier so glänzte, war es ganz trocken. Beim Darüberstreichen, so sagten sie, wirke die Haut wie fein gewebt. Also wollte ich auch mal probieren. Als man mir die Eidechse vorsichtig in die Hand gab, konnte ich nur einen Moment ruhig schauen. Dann bewegte sich das Tier. Spontan drückte ich fester zu. Trotzdem entwich das Tier. Auf dem Boden liegend hinterließ es seinen zappelnden Schwanz. Der Junge, der es gefangen hatte heulte, weil ich seine Eidechse kaputt gemacht hatte. Die anderen Kinder warfen mir böse Blicke zu. Ein Mädchen rief vorwurfsvoll: „Wie konntest du das nur meinem Bruder antun?“
Der Tag war gelaufen. Unter tausend Entschuldigungen verließ ich traurig die Szene. Ich fühlte mich unendlich schuldig. Diesmal war meine Schuld besonders groß, denn ich hatte ein Tier schwer verletzt. Wieder dachte ich, warum war das keinem von den anderen Kindern passiert? Warum passierten Unglücke immer nur mir? Und ich stand nicht alleine da mit dieser Meinung. Die Reaktion der anderen Kinder mit ihren schockierten Blicken bewies das.
Selbst meine Eltern dachten so. Sonst gäbe es zu Hause doch nicht ständig wegen meines Versagens so viel Ärger. Meine Eltern waren besonders genervt, von den vielen Brillen, die ich zerstörte. Und natürlich vergaß ich in der Schule regelmäßig während der großen Pausen, die Brille im Klassenraum zurückzulassen. Und hatte ich daran gedacht, dann hatte ich sie nicht ins Hartschalen-Etui gesteckt. Mein Hartschalen-Etui war aus Metall, nachdem ich eines aus Plastik zerbrochen hatte.
„Wie schafft man das“, war die ungläubige Frage meiner Mutter.
Naja, ich wusste es selber nicht. Es war einfach passiert.
Meine Eltern waren froh, dass ich nachmit- tags viel im Wald spielte, weil ich da nichts kaputtmachen konnte. Aber auch da fiel mir beim Klettern eine Brille vom Baum. Dass ich sie gefunden hatte, merkte ich, als ich drauftrat. Wieder mal war der Fall eindeutig. Wie konnte das passieren? Wieder mal reagierten alle Erwachsenen mit kopfschüttelnder Fassungslosigkeit. Ich ertrug mein Schicksal. Es war nun mal so wie es war. Zu sehr war ich mittlerweile daran gewöhnt. Ein sich wiederholendes Schicksal härtet ab. Es half, wenn man sein Los akzeptierte. Das nahm dem Schmerz die Spitzen. Dass es schwierig war, die kleine Brille auf dem mit Laub und Geäst bedeckten Waldboden zu finden, wertete ich deswegen nicht als entlastend. Das einzige, was ich zu meiner Entschuldigung beitragen konnte war, dass ich meine Fehler nicht schönredete.
Immer wieder hieß es von Lehrern und Eltern kopfschüttelnd: „Wieso kannst du das nicht so wie alle andern auch machen?“
Es war auch schwierig, entspannt zu lernen, wenn bei jedem Fehler ungeduldig interveniert wurde. So konnte ich mich nicht ausprobieren. Ich war der Meinung, dass gerade in einer Schule Fehler erlaubt sein sollten. Es half mir, wenn ich Zeit hatte, Unstimmigkeiten selbst als Fehler zu erkennen. Vor allem half es, wenn ich Ruhe vor dem offenen Erwartungsdruck der Erwachsenen und den belustigten Blicken der Mitschüler hatte.
Als die Lehrerin eine Mathearbeit zurückgab, hatte nur ein einziger Schüler alle Aufgaben falsch gerechnet. Das war natürlich ich, wer sonst. Es gab das übliche Gelächter von den Kindern über <Blödie> und endlose Kritik, erst von der Lehrerin und später von meinen Eltern. Wie konnte es sein, dass ich nicht einmal eine einzige Aufgabe richtig gerechnet hatte. Dafür gab es nur verständnisloses Kopfschütteln.
Zufällig sah mein Vater, dass ich einen Block zu weit angefangen hatte die Aufgaben zu lösen. Berücksichtigte man das, dann waren die ins Heft für Klassenarbeiten übertragenen Ergebnisse alle richtig. So gesehen hatte ich null Fehler. Das hatte auch kein anderes Kind geschafft. Mein Entschuldigung, dass das Versehen entstanden war, weil immer alles viel zu schnell erklärt wurde, wollte er aber nicht gelten lassen. Wenn die anderen den richtigen Anfang finden konnten, dann musste ich das eben auch können. Die kollektive Enttäuschung über mich blieb also bestehen. Nur ich hatte plötzlich Hoffnung. Wenn ich alle Aufgaben richtig rechnen konnte, dann konnte es nicht so schlecht um mich bestellt sein. Naja, und an der anderen Sache mit der richtigen Aufmerksamkeit, die hätte verhindern können, dass ich beim falschen Block beginne, musste ich halt noch arbeiten. Ich war doch noch jung. Schade dass kein Erwachsener diese Option sah um mich zu motivieren, denn dieser hoffnungsvolle Blick war bei mir eher eine Ausnahme. Meistens sah auch ich mich als hoffnungslosen Idioten.
Durch die viele Kritik, die mir zuteil wurde, lernte ich, den eigenen Überlegungen zu miss- trauen. Ich riet einfach nur noch, was die Lehrer hören wollten. So war es auch im Musikunterricht. Wenn wir Blockflöte spielten, dann schaute ich nicht auf die Noten. Obwohl ich die Noten kannte, fühlte ich mich sicherer, wenn ich permanent auf die Fingerhaltung des Nachbarn schaute. Der machte doch bestimmt weniger Fehler als ich.
Mein Versagen nervte die anderen. Es provozierte und machte Leute wütend. Nicht selten wurde mir wegen meines kopflosen Verhaltens Absicht unterstellt. Aber was nützte es, mich zu schelten? Mir war meine Unfähigkeit doch selbst am peinlichsten.
Das Meckern der Erwachsenen, zu Recht oder zu Unrecht, half keine Spur. Es beruhigte nur ihre Nerven. Die ständige Kritik machte alles schlimmer. Sie gab mir das Gefühl, nicht normal zu sein und darüber hinaus unfähig jeder Besserung.
Je größer die Enttäuschung meiner Eltern wurde, desto mehr glaubte ich, ihre Liebe nicht zu verdienen. Bei einem Einkauferlebnis in einer benachbarten Großstadt, klebte ich an meinen Eltern wie eine Klette. Ich hatte Angst sie im Menschengewimmel zu verlieren und allein nicht nach Hause zu finden. Ich glaubte einfach nicht, dass sie nach einem Kind wie mir suchen würden.
Hatte man mir gegenüber dem Ärger ausreichend Luft gemacht, hatte ich wieder meine Ruhe. Praktische Ansätze oder Ideen zu einem Umgang mit mir, die Besserung versprachen, hatten sie nicht. Die meisten Erwachsenen hatten wenig Zeit und Geduld und standen oft selber unter Strom.
Resigniert habe ich trotzdem nicht. Im Gegenteil wurde mein Ehrgeiz entfacht, als wir in der Adventszeit Weihnachtslieder auf der Blockflöte übten. Ich wollte unbedingt am Heiligabend meinen Eltern vorspielen. Der Erfolg war bescheiden. Mein Vortrag war voller Verspieler. Ich fühlte aber, dass es schlechter hätte sein können. Ich merkte, das Üben half und dass ein Volltrottel wie ich eben etwas mehr üben musste, um weniger zu scheitern. Tatsächlich übte ich weiter, auch über Weihnachten hinaus. Ich wurde immer besser. Als ich fast fehlerlos war, wollte ich das Weihnachtslied nochmal vorspielen. Da meine Eltern bei der Arbeit waren, ging ich zu meiner Oma. Die wollte das Lied aber nicht mehr hören. Es war mittlerweile Anfang Februar. Da spielte man keine Weihnachtslieder mehr. Also spielte ich das Lied mir selbst feierlich vor. Ich ging dazu ins Wohnzimmer und stellte mich an den Platz, wo der Weihnachtsbaum vor Monaten gestanden hatte. Ich war zufrieden mit meinem Vortrag. Die Arbeit hatte sich gelohnt. Das Prinzip stimmte: Ohne Fleiß kein Preis. Erstmals spürte ich eine realistische Aussicht Großes zu schaffen. Ich musste nur stur dranbleiben.
Die ständige Kritik und die Häme der anderen Kinder, die permanent belustigt waren durch meine Missgeschicke, härteten mich allmählich ab, auch wenn ich im täglichen Konkurrenzkampf mit ihnen nur am <loosen> war. Abhärtung war mein erster Schritt zur Gegenwehr. Abhärtung schützte davor, dass die Traurigkeit endlos wurde. Ja, ich konnte das nicht. Ja, ich schaffte das nicht. Und ja, ich ließ es trotzdem nicht sein. Ein Sprichwort, das ich irgendwo aufgeschnappt hatte, schien mir diesen Ansatz zu bestätigen. „Ist der Ruf erst mal lädiert, dann probiert es sich ganz ungeniert“.
Die Anwendung dieses Prinzips wurde ein wichtiger Schritt. Wenn der Fall ins Bodenlose durch Abhärtung gestoppt war, dann musste aus dem letzten Funken Glauben an mich selbst die Hoffnung entspringen, die zu den Taten führte, die aus meinem Dilemma herausführten.
Der Glaube, oder besser noch die Erkenntnis, die eigene Bedeutung erst noch finden zu müssen, waren Ansporn für Taten. Sie nährten die Sehnsucht, das Jammertal zu verlassen. Ich fand mich plötzlich zu jung, und mein Leben war noch viel zu lang, um mich jetzt schon mit meinem Schicksal abzufinden.
In meinem Fall hieß das, ich musste üben, üben und nochmals üben. Üben war oft eine entmutigende und schier endlose Angelegenheit. Aber das war der Weg. Einen anderen gab es nicht. Zumindest sah ich keinen anderen Weg. Vielleicht würden sich in Zukunft weitere Wege ebnen, aber jetzt erst mal blieb mir nichts anderes übrig?
Das monotone Üben fühlte sich aber recht bald ganz anders an. Kleine Erfolge wie beim Flötenspiel trainierten meine Geduld und Beharrlichkeit. Mit der Disziplin zum Üben wuchs dann die Lust am Üben. So wurde der Weg zum Ziel neben dem eigentlichen Ziel zu einer zweiten Quelle von Spaß und Freude.
Noch weitere Erkenntnisse offenbarte dieser Weg im Laufe der Zeit. Je mehr man sich ausprobiert, desto mehr findet man sich. Ich konnte mehr, als ich selbst glauben mochte. Aber ich konnte auch nicht alles. Probieren kann aber jeder alles.
Wenn ich dann scheiterte, so war das ein willkommener Anlass, sich neu auszurichten. Manch neuer Traum findet sich erst, wenn man Ballast abgeworfen hat. In einem Nachrichtenmagazin, stieß ich beim Lesen eines Interviews auf das Zitat: <Wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren>. Dieses Zitat würde mich noch viel beschäftigen bei meinen Selbstgesprächen auf den Baumkronen im Lingener Staatsforst. Es wurde mir zur Rationale, um nach Erfolg zu ringen und zur Maxime, um Niederlagen hinzu- nehmen. Mir wurde dieses Zitat gerade im Scheitern Ansporn nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, solange das Ziel es lohnt.
Mit der Zeit lernte ich immer neue Wege zu finden, um an meinen Schwächen zu arbeiten. Ich merkte, dass es schon half, allein über Probleme und Wünsche zu sprechen, denn oft kamen Ideen und Anregungen von anderen. Ich fing an, immer weniger die Hindernisse zu sehen, die Probleme zementierten, weil mein Glaube an Lösungswege durch erste Erfolge wuchs. Wenn ich mir Ritterburgen ansah, dann mochte ich nie glauben, dass die von Belagerern eingenommen worden waren. Sie sahen einfach zu wehrhaft aus. Wer sich auf Probleme fokussiert, kann nicht die Lösungen sehen, die das Erobern einer Burg manchmal genial einfach machen. Odysseus Trick mit dem Pferd in Troja, ist da nur ein Beispiel. Bedenken verengen unseren Blickwinkel. Wenn ich aber wild drauflos träumte, dann fand ich die abgefahrensten Lösungen. Es waren aber auch immer einige praktikable Wege dabei.
Alle diese Fortschritte halfen mir, aus Schwächen langsam Stärken zu entwickeln. Heute bedeutet das für mich in der adoleszenten Konsequenz dieser Erfahrungen, dass ich Schwächen nicht verstecke, sondern kultiviere. Ich bin überzeugt, dass hinter vielen großen Leistungen Kreativität und Ehrgeiz stecken, mit einer Schwäche umzugehen.