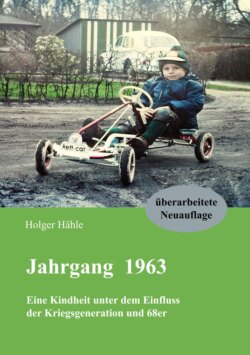Читать книгу Jahrgang 1963 - Holger Hähle - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Herr Lühn und die alten Männer
ОглавлениеWenn ich gegen Mittag aus dem Kindergarten kam, traf ich oft den Postboten. Schon von weitem konnte ich erkennen, wenn Herr Lühn das Postwägelchen schob. Er trug seinen linken Arm immer so geknickt, als hätte er gerade den Unterarm gebrochen. Tatsächlich trug er aber keinen Gips. Auch ohne Gips hielt er den Unterarm immer angewinkelt. Das ging bei ihm nicht anders. Ganz im Gegensatz zu einem eingegipsten Arm, ging die Behinderung auch nicht wieder weg. Die Armhaltung war die Folge einer Kriegsverletzung.
Viele Leute hatten damals körperliche Behinderungen. Dem Kioskbesitzer, bei dem ich mein Eis kaufte, fehlte sogar ein ganzes Bein. Meinem Opa fehlte nur der kleine Finger, aber das war ein anderer Krieg.
„Jede Generation hat ihren Krieg“, meinte dazu eine Tante zu mir: „Das wirst du noch erleben.“
Wenn Herr Lühn nicht seine Post verteilte, sah ich ihn meistens in seinem Garten gegen- über von unserem Haus. Dann war er der freundlichste alte Mann, den ich kannte. Er meckerte selten. Meist hatte er nur Vorschläge, wie wir besser spielen sollten. Wenn er sich tatsächlich mal ärgerte, dann wussten wir, dass wir es wirklich zu arg getrieben hatten. Selbst wenn er sauer war, drohte er nie. Auch dann hatte er für uns einen Plan B, der uns wirklich eine Alternative war. Wieso war er so anders als die anderen alten Männer? Vielleicht lag das daran, dass er der jüngste von den Alten war.
Freundlichkeit unter alten Männern schien mir eine Ausnahme zu sein. Herr Lühn war auch der einzige, der nie vom Krieg sprach. Wurde er angesprochen, was selten genug passierte, dann sprach er schlecht vom Krieg. Die anderen alten Männer sprachen öfter über ihren Krieg. Herr Lühn war auch der einzige von den alten Leuten, der nicht immer mal zwischendurch <Armes Deutschland> sagte. Viele alte Leute taten das. Sie waren enttäuscht über die aktuelle Situation Deutschlands. Laute Kritik übten aber nur die Männer. Dann hörte ich, dass die Welt gegen Deutschland sei. Dass man Deutschland betrogen habe. Die Rede war von einem zweiten Versailles. Sie müssten ausbaden als brave und anständige Bürger, was andere zu verantworten hätten. Mit brav und anständig meinten sie, dass sie immer nur ihre Pflicht getan und dafür so manches Joch auf sich genommen hatten.
„Nicht nur die Juden haben unter den Umständen gelitten“, sagte jemand auf dem Schützenfest an der Schwedenschanze. Ein einhelliges „Das ist wohl wahr“ war die Antwort der Gruppe im Festzelt.
Rechtfertigungen waren das Gesprächsmotiv einer kleineren Gruppe der Veteranen. Die große Mehrheit wollte sich am liebsten gar nicht mehr erinnern.
„Wieso erinnern und immer wieder in alten Wunden stochern“, kritisierte einer von ihnen die Rechtfertiger.
Die meist schweigende Mehrheit fühlte sich von Erinnerungen aufgewühlt. Wieso nicht abhaken, was man sowieso nicht rückgängig machen konnte? Warum nicht endlich Ruhe und Frieden im Vergessen finden, gerade weil das alles mit dem Krieg so schwer und unangenehm war. Das Leben musste doch weitergehen.
Diese unzufriedenen alten Männer haben uns Kindern das Spielen auf der Straße immer wieder vermiest. Angeblich waren wir ständig zu laut. Wir würden die Straße kaputtmachen, wenn wir nach einem Regen in den Pfützen spielten. Mein Gott, die Straße war eine mit Schlaglöchern übersäte Schotterpiste.
Samstags konnte es schon mal besonders kritisch werden. Dann hatten sie fürs Wochen- ende vor ihren Hecken geharkt. Weh dem, der dann erwischt wurde, wie er die sauber gezogenen Rillen mit Fußspuren zerstörte, weil er versuchte einen verschlagenen Federball aus einem Vorgarten zu angeln. Natürlich verwischten wir unsere Spuren und zogen mit den Fingernägeln die unterbrochenen Rillen der Harkenspur nach. Kritisch war auch Fußball. Wir mussten gut überlegen, wo wir kickten. Nicht immer bekamen wir unseren Ball zurück, wenn er in bestimmte Gärten flog.
Als mein Drachen in den falschen Garten abstürzte, fragte ich deswegen nicht extra, ob ich ihn mir wiederholen darf. Ohne zu zögern schlich ich mich in den Garten. Leider wurde ich von der Gartenlaube aus entdeckt. Mit dem Drachen in der Hand rannte ich so schnell ich konnte, denn der Gartenbesitzer konnte von der Laube aus auf kurzer Distanz meinen Fluchtweg kreuzen. Ich verlor das ungleiche Rennen und wurde am Kragen gepackt.
Als er auf mich eindreschen wollte, rief plötzlich vom Grundstück nebenan der große Nachbarsohn, der gerade von seiner Lehrstelle nach Hause kam: „Lassen sie das Kind in Ruh. Schlagen sie gefälligst ihre eigenen Kinder.“
In der nächsten Sekunde war ich los und sprang über die Hecke. Der alte Mann brüllte zurück: „Werden sie erst mal älter und kümmern sich um ihre Angelegenheiten“.
So war ich davongekommen, aber statt meiner musste jetzt mein Drachen büßen. Für meine Kumpels und mich gut sichtbar zerbrach er den Drachen, warf ihn über die Hecke und sagte abschätzig grinsend: „Lasst euch das eine Lehre sein.“
Ich war mir sofort sicher. Das war keine pädagogische Maßnahme. Dazu stand ihm die Genugtuung zu sehr ins Gesicht geschrieben.
Dies war schon ein heftigeres Intermezzo. Meist kam man mit einfachem <an-den-Ohren- ziehen> weg. Das war genauso wie bei Wilhelm Buschs <Max und Moritz>. Immer waren es quengelnde alte Männer, nie junge Männer, nie Frauen, die uns traktierten.
Als ich an einer nahegelegenen Hauptstraße mit meinem Roller den Bürgersteig entlangfuhr, wurde ich von einem dieser alten Männer ohne Ansprache oder sonstige Vorwarnung einfach mit dem Ellenbogen zur Seite gedrängt. Der Stoß kam so unerwartet und mit massiver Wucht, dass ich stürzte.
„Hoffentlich hat es wehgetan. Sonst lernt ihr Bengel ja nicht“, war der Kommentar des Fremden ohne weitere Erklärung.
Herr Thole, einer von den wenigen Netten, deswegen sei er hier lobend erwähnt, der ein Stück weiter wohnte, tröstete mich in seiner Schusterwerkstatt, wo es immer so berauschend nach Kleber roch. Er erklärte, dass der Bürgersteig mit einem weißen Strich zweigeteilt war. Nur die eine Hälfte ist ein Radweg. Aber auch er habe gedacht, dass ein Roller auf beiden Seiten fahren darf.
Damit hatte er tatsächlich recht. Die Straßenverkehrsordnung erlaubte damals wie heute, dass es Kindern unter zwölf Jahren erlaubt ist, den Gehweg mit Rollern und Fahrrädern zu befahren.
Als mein Freund Uwe beim Straßenfußball einen Ball verschoss, klingelte er doch wirklich bei dem berüchtigten Anlieger und wollte fragen, ob er den Ball zurückholen dürfte. Wir wollten ihn wegen der Aussichtslosigkeit seines Anliegens davon abhalten, aber er sagte uns: „Ich muss ihm doch eine Chance geben.“
Dann ging er zur Haustür. Wie vorhergesagt, wurde sein Wunsch lautstark abgelehnt.
„Na siehste“, sagten wir dem Rückkehrer vorwurfsvoll und trollten uns.
Als wir am nächsten Tag nach der Schule wieder an der Haustür vorbeikamen, ging Uwe plötzlich wortlos auf die Türe zu. Er öffnete die Hose und kniete so, dass er seinen Pimmel in den Briefschlitz stecken konnte. Nach weiteren 45 Sekunden war seine Blase entleert. Mit Genugtuung sagte er, als er zurückkam: „Für mich ist der Fall damit erledigt.“
Als es einige Zeit später zu einem zufälligen Treffen der beiden an einer Kreuzung kam, versuchte auch dieser Alte meinen Freund zu fangen. Der konnte entkommen. Wütend wurde ihm hinterher gerufen: <Lumpenpack>. Diese Verunglimpfung war sein Schimpfwort für <volksdeutsche> Rabauken. Jugoslawische Kids und Italiener kamen in der Regel mit <Judenpack> oder <Zigeuner> davon. Zu mehr Schimpfwörtern reichte heute die Puste noch nicht. Aus sicherer Entfernung antwortete Uwe: „Woher wollen sie wissen, dass ich es war? Haben sie probiert?“
Für den Mann war die Sache damit noch nicht erledigt. Leider halfen ihm dabei zwei Tatzeugen aus unserer Fußballmannschaft, die allzu leicht ihr Indianerehrenwort brachen.
Uwe ertrug sein Schicksal wie ein Apache den Marterpfahl, als die Strafe nach einem eingehenden Gespräch zwischen dem bösen Mann und Uwes Eltern folgte. Für mich war er ein Held, weil er nicht klein beigab. Er nahm die Konsequenzen in Kauf, weil es unvermeidbar war. Das hatte er vorher schon entschieden. Natürlich würde er sich bei einem nächsten Mal genauso wieder verhalten. Der alte Idiot hat es doch nicht anders verdient.
Hier ging es nicht nur um eine kleine Meinungsverschiedenheit, die man wohlwollend und sachlich mit gegenseitigem Respekt aus der Welt schaffen konnte. Manchmal müssen auch Kinder speziellen Erwachsenen die Grenzen zeigen, die sie nicht überschreiten dürfen. Das pädagogisch fragwürdige Verhalten in diesem und in vielen anderen Fällen, konnte keine Einsicht in eigenes Fehlverhalten fördern. Es fehlten der Respekt und eine erklärende Rationale. Solches Verhalten von den alten Männern waren Provokationen, die verletzen sollten. Einigen der verbitterten Alten war das Labsal für uns unbekannte Wunden. Man konnte sie fürchten, aber beileibe nicht ernst nehmen.
Wenn diese alten Männer sich trafen, dann erzählten sie von ihren jungen Tagen. Dann redeten die, die meist Landser, Eisenbahner oder Amtspersonen waren, auf Rentnerbänken und in Gartenlauben von Gefechten, besonderen Verordnungen und speziellen Transporten, die sie zu verantworten hatten. So bekamen meine Vermutungen ein Gesicht. Uns wollten sie quälen, weil sie sonst niemand mehr zu quälen hatten. Deswegen die Lust. So wurde mir aus dringendem Tatverdacht Gewissheit, auch wenn sie im Schwang der Erinnerungen sicher übertrieben und nicht Offiziere waren.
Keine Reue und kein Bedauern trübten ihre Ausführungen. So wurden sie nach einer nachdenklichen Deutschstunde mit Paul Celans Todesfuge für mich die Meister aus Deutschland, die den Tod in die Häuser ihrer Nachbarn und in die Welt hinaus getragen hatten.
Wenn sie tratschten, das war allerdings selten, dann prahlten sie. Nannten Schlachten und Generäle, unter deren Kommando sie gedient hatten oder deren Fahrer oder Adjutant sie angeblich waren.
Zwischendurch wurde immer wieder betont, man habe stets nur seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Anständigkeit sei eben Bürgerpflicht. Das habe der Pastor auch schon so bestätigt.
„Bei aller Kritik von den Sozis und den Besserwissern, die nicht dabei waren“, sagte ein Nachbar: „Das hatte so schon alles seinen Sinn.“ Worauf in der Gartenlaube zustimmend ergänzt wurde: „Auch Strafexpeditionen dienten letztlich nur der eigenen Sicherheit. Ich sag doch nicht nein, wenn es darum geht meine Kameraden zu verteidigen vor den hinterhältigen Anschlägen von Chaoten.“
Mit Chaoten, so vermute ich, waren irreguläre Truppen gemeint, wie Partisanen und Widerstandskämpfer. Ansonsten wurde der Begriff Chaot meist ideologisch für sogenannte linke <Berufsdemonstranten> verwendet, die hinterrücks wieder zum Dolchstoß ansetzten.
Die Dolchstoßlegende kannte ich noch nicht. Es war eine Verschwörungstheorie konservativ denkender Menschen, die den Sozialdemokraten und Kommunisten die Schuld am verlorenen Ersten Weltkrieg gaben.
Die Emotionen allein, mit denen gesprochen wurde, machten mir klar, auch wenn ich die meisten Zusammenhänge gar nicht verstand, sie sahen ein Unrecht, das ihnen widerfahren war. Sie nannten z.B. den Unterschied zwischen einem braven Soldaten und gemeinen Mördern und Terroristen.
„Den Unterschied würden auch die Amerikaner kennen, denn sonst müssten sie die Todesstrafe abschaffen“, sagte einer von ihnen dazu: „Aber die seien aus ganz anderen Motiven gegen Deutschland.“
„Ja“, ergänzte ein anderer Mann: „Die Amis sind den Juden auf den Leim gegangen.“
War den alten Männern der Opportunismus ihrer sogenannten Anständigkeit nicht bewusst? Ist es nicht merkwürdig, wenn ein Schulkind den Eindruck bei diesen Erzählungen gewann, dass da was nicht stimmte?
„Verstößt Töten nicht auch gegen das erste Gebot, wenn es offiziell von einem Staat für Soldaten legitimiert ist“, fragte ich daraufhin eine Nachbarin, von der ich glaubte, sie sei besonders fromm.
„Vielleicht“, meinte sie: „Jedenfalls ist Gottes Zorn ungleich größer als der von uns Menschen. Was passiert, wenn wir wirklich mal einen Fehler machen, kennst du ja aus dem Alten Testament von der Geschichte um Sodom und Gomorra. Da starb eine Stadt mit Kind und Kegel, egal ob schuldig oder nicht schuldig.“
„Na dann“, so schließe ich für mich die Frage: „blieb uns im Zweiten Weltkrieg ja das Schlimmste erspart.“
Mit einem wortlosen Lächeln werde ich fortgeschickt.
Von Mut sprachen die alten Männer nur wenig. Meist war von Pflicht die Rede. Mit der Betonung der Pflicht, bemühten sie ihr Verhalten nach außen zu rechtfertigen. Dabei stellte ich mir vor, dass es viel Mut brauchte, in den Krieg zu ziehen. Oder brauchte es mehr Mut, nicht in den Krieg zu ziehen? Wer in den Krieg zog, konnte darin umkommen. Wer nicht in den Krieg zog, wurde gehängt? War der Mut im Kampf ein Mut der Verzweiflung, weil man keinen anderen Ausweg vor den Offizieren und Kameraden sah? Machte die Angst, vom Feind getroffen zu werden mutig nach dem Motto, lieber der als ich? Waren Helden eigentlich Feiglinge, wenn ihr Erfolg im Kampf mit dem Gegner der Angst ums eigene Leben geschuldet war, die sie erst zu übermenschlichen- und unmenschlichen Leistungen antrieb?