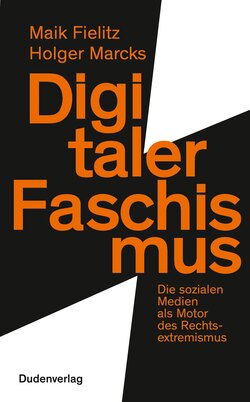Читать книгу Digitaler Faschismus - Holger Marcks - Страница 6
Оглавление1 It’s a Match!
Über die Liaison von Rechtsextremismus und sozialen Medien
Es sei die »größte Propagandamaschine der Geschichte«, die da eine Handvoll Internetkonzerne mit den sozialen Medien in die Welt gesetzt hätten. Das behauptete der britische Komiker Sacha Baron Cohen Ende 2019 in einer Rede vor der Anti-Defamation League (ADL), einer US-amerikanischen Organisation, die sich gegen Antisemitismus engagiert.1 Diese Worte waren keineswegs spaßhaft gemeint, wie man es von den Auftritten Baron Cohens gewohnt ist. Vielmehr trat er vor der ADL als besorgter Zeitdiagnostiker auf, dessen Botschaften es in sich hatten. »Hätte es Facebook in den 1930er-Jahren gegeben«, so eine weitere Aussage, »hätte es Hitler für seine Lösung der Judenfrage werben lassen.« Das klingt nach einer steilen These, die man intuitiv als Übertreibung wahrnimmt, kommt sie doch aus dem Munde einer Person, die gerne solch überzeichnete Kunstfiguren wie Borat oder Brüno mimt. Hält man sich aber die – noch im Juni 2020 bekräftigte – Position von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor Augen, dass soziale Medien »nicht die Schiedsrichter der Wahrheit« seien, sich also aus dem politischen Wettstreit heraushalten sollten, dann kommt man nicht umhin festzustellen: Der Komiker hat recht. Denn nichts anderes bedeutet es, wenn die größte Interaktionsplattform aller Zeiten sich zu Problemen des politischen Wettstreits quasi prinzipienlos verhält: Dann dürfen eben auch die größten Manipulatoren ungehindert ihre Technologie zur Massenkommunikation nutzen.
Vor wenigen Jahren hätte Baron Cohens viel beachtete Rede sicherlich noch als böse Polemik gegolten. Heute aber trifft sie den Nerv eines Unbehagens, das viele Demokraten teilen. Denn während das Internet noch in den 1990er-Jahren als Instrument zur Erweiterung der Meinungsfreiheit empfunden wurde, gilt es heute als Hort von Hass und Hetze, der offene Gesellschaften auf eine Belastungsprobe stellt. An vorderster Linie mit dabei: rechtsextreme Einpeitscher. Sie machen besonders eifrig Gebrauch von der Freiheit, die sich durch die Nichteinmischung eines Zuckerbergs bietet, und preschen mit unlauteren Mitteln voran, um ihre krumme Version der Wahrheit im politischen Wettstreit durchzusetzen. Zwar nutzen rechtsextreme Akteure digitale Technologien schon, seit es diese gibt, doch blieb die Wirkung ihrer Online-Handlungen lange überschaubar. Erst mit der Verbreitung der sozialen Medien, die ganz neue Interaktionselemente boten – kombiniert mit der Möglichkeit der Massenkommunikation –, konnten sie in eine neue Phase erfolgreicher Mobilisierung eintreten. Dabei nutzen sie die erweiterte Meinungsfreiheit nicht nur, um ihre illiberalen Ansichten zu streuen, sondern auch, um sich besser zu koordinieren. Inzwischen lässt sich immer klarer sehen, dass die sozialen Medien einen Resonanz- und Vernetzungsraum darstellen, von dem die extreme Rechte in besonderem Maße profitiert. Und immer stärker regt sich sogar der Verdacht, dass sie den Rechtsextremismus erst so richtig in Fahrt bringen.
Tatsächlich eilte die extreme Rechte im vergangenen Jahrzehnt von Erfolg zu Erfolg. Nicht nur hierzulande. In vielen Ländern hat sie bei regionalen und nationalen Wahlen deutlich zugelegt. In manchen – wie Ungarn, Brasilien und Italien – spielt sie sogar eine machtpolitische Rolle. Auch haben rechtsextreme Gewalttaten vielerorts stark zugenommen, sodass manche Konfliktforscher sogar schon von einer »neuen Welle des Rechtsterrorismus« sprechen.2 Die Gefahr, die für die Demokratie in Deutschland von rechts ausgeht, hat spätestens mit den Anschlägen von Halle und Hanau auch offiziell den Islamismus als »größte Bedrohung in unserem Land« abgelöst, wie Innenminister Horst Seehofer Anfang 2020 verlauten ließ.3 Das zeigt sich auch in einer wachsenden Zahl von Studien, Büchern und Forschungsprojekten, die sich mit rechter Radikalisierung und Gewalt befassen. Gleichzeitig haben auch die zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen Rechtsextremismus zugenommen, so wie auch die Sicherheitsbehörden in diesem Bereich aufrüsten. Und stets dabei im Brennpunkt: das Internet und die sozialen Medien. Diese sind so nicht nur zu einem politischen Kampffeld geworden, in das Demokraten »digitale Bürgerrechtler« und Verfassungsschützer »virtuelle Agenten« entsenden, sondern auch zum Angelpunkt von politischen Debatten über Digitalisierung und Demokratie.
Doch was ist überhaupt gemeint, wenn von »Rechtsextremismus« die Rede ist? Im Detail gehen da die Meinungen zweifellos auseinander. Im weitesten Sinne können darunter aber Einstellungen gefasst werden, die andere Personengruppen konsequent abwerten, weil diese nicht in die Vorstellung von einer homogenen Nation passen, vor allem wegen ihrer Hautfarbe oder vermeintlichen Herkunft, aber auch wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Glaubens. Das von Rechtsextremisten anvisierte Ziel einer »ethnokulturell« reinen Gemeinschaft steht notwendigerweise im Konflikt mit demokratischen Grundsätzen, die den Schutz von Minderheiten und das Menschenrecht auf Gleichheit betonen, und ist in letzter Konsequenz auch gegen die demokratische Ordnung selbst durchzusetzen. Entsprechend sind in der extremen Rechten Gedanken der sozialen und politischen Exklusion oder gar Säuberung besonders wirkungsmächtig, auch wenn sie sich in ihren konkreten ideologischen Ausprägungen und organisatorischen Formen unterscheidet. Am deutlichsten zeigt sie sich freilich da, wo sie aktiv an den Grundfesten der offenen Gesellschaft rüttelt und demokratische Errungenschaften attackiert, ja sogar autoritäre Regierungsformen begrüßt.
Wo Rechtsextremismus genau beginnt, lässt sich hingegen nicht so einfach sagen. Allein schon, weil Einstellungen und Verhaltensweisen ebenso häufig auseinandergehen wie die Eigen- und die Fremdwahrnehmung. Es bezeichnet sich ja heute kaum jemand als rechtsextrem. Das gilt auch für die Organisationen und Alternativmedien der extremen Rechten, die sich wahlweise als nationalkonservativ, patriotisch, nationale Opposition oder Widerständler verstehen. Als weitverzweigtes Netzwerk, zu dem sie mittlerweile geworden ist, bietet die extreme Rechte für viele Menschen eben auch ganz unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Diese Ambivalenz, in der sich bürgerliche Töne mit rechtsextremem Rhythmus mischen, ist es womöglich auch, die viele Medien davor zurückschrecken lässt, Akteure wie die Alternative für Deutschland (AfD) als rechtsextrem einzustufen. Offenbar um eine mögliche Dramatisierung zu vermeiden, wird die Partei bevorzugt als »rechtspopulistisch« bezeichnet. Genau diese Verlegenheitslösung tendiert umgekehrt aber zur Verharmlosung, zumal sich der Populismus-Begriff auch stets so lesen lässt, als vertrete die AfD populäre Positionen. Tatsächlich aber steht die AfD für ein Bündnis aus konservativen Wutbürgern, neurechten Ideologen und überzeugten Neonazis, das seinen gemeinsamen Nenner in einer Rhetorik der Ungleichwertigkeit und Diskriminierung findet. Spätestens seit sie die Gesellschaft mit ihrer Abwertung von Migranten dauerbeschallt, stößt die einst »eurokritische« Partei fast schon monothematisch in das Horn des Rechtsextremismus.
Dass die »bürgerliche« Fassade, hinter der sich rassistische und illiberale Vorstellungen versammeln, an manchen Stellen öfter durchbricht, macht es umso dringlicher, den Rechtsextremismus nicht nur an den militanten Rändern zu suchen, sondern seinen dynamischen Resonanzraum einzubeziehen. Wenn etwa massenhaft Flüchtlingsunterkünfte angegriffen werden, auch motiviert durch AfD-Propaganda, dann sind viele vermeintlich normale Menschen womöglich nicht mehr so normal, als dass sie die Normen einer modernen Demokratie teilen. Es mögen keine Mehrheiten sein, die sich da in Bewegung gesetzt haben, aber es handelt sich eben doch um eine merkliche Masse, die in den Bann oder zumindest den Dunstkreis des Rechtsextremismus gezogen wurde. Obwohl die Corona-Krise gezeigt hat, dass die extreme Rechte – auch wenn sie weitere Potenziale im verschwörungstheoretischen Segment aktivieren konnte – immer noch ein Wackelkandidat im machtrelevanten Parteienspektrum ist, stellt sich die Frage, was ihre Raumgewinne, die sich global ja zeitgleich beobachten lassen, ermöglicht hat. Denn selbst wenn sich das Ganze nur als zeitweiliger Hype erweisen sollte – wovon, Stand jetzt, nicht auszugehen ist –, sind die rechtsextremen Erfolge doch allemal erstaunlich und erklärungsbedürftig.
Eine der zentralen Fragen, die auch dem vorliegenden Buch zugrunde liegen, lautet daher, inwieweit die rechtsextremen Erfolge mit der Digitalisierung und den sozialen Medien in Verbindung stehen. So ist »Online-Radikalisierung« ein derzeit beliebter Begriff, unter dem rechtsextreme Dynamiken diskutiert werden. Aber wann vollziehen sich politische Einflüsse online und wann offline? Immerhin sind etwa die sozialen Medien mittlerweile so in den Alltag verflochten, dass sich analytisch kaum zwischen virtuellen und »realen« Faktoren trennen lässt. Wenn sich jemand radikalisiert, dann mag das über sein Online-Verhalten nachvollziehbar sein; man weiß aber nicht, ob nicht doch Gespräche am Stammtisch maßgeblicher dafür waren. Umgekehrt sind die Menschen am Stammtisch ja auch von Informationen beeinflusst, die man online sammelt. Soziale Medien sind eben ein integraler Bestandteil der Öffentlichkeit geworden, die zuvor überwiegend von den herkömmlichen Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen hergestellt wurde. Bezeichnenderweise sprach da auch niemand von einer Print- oder Funk-Radikalisierung.
Wir halten es daher für lohnender, danach zu fragen, welche Informationen eigentlich durch die Digitalisierung stärker in Umlauf gekommen sind und so eine veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit möglich machen. Insofern interessiert uns weniger das Verhältnis von Online- und Offline-Welten, sondern vielmehr der Wandel von Öffentlichkeit, in dessen Verlauf die sozialen Medien mit großem Einfluss an die Seite der herkömmlichen Medien getreten sind. Auf diesen Wandel werden wir noch häufiger zu sprechen kommen, da er die Voraussetzungen demokratischer Diskurse radikal verändert. Als Erstes fällt bei ihm ins Auge, dass die extreme Rechte mithilfe der sozialen Medien ein regelrechtes Nachrichten- und Propagandasystem installieren konnte, über das sie ihre alternativen Erzählungen von der Wirklichkeit sehr wirkungsvoll verbreitet. Diese Erzählungen handeln von Verschwörung und Verrat, vor allem aber von einer Bedrohung der Nation. Die dramatische Geschichte von einem drohenden Untergang der eigenen »Rasse« beziehungsweise Kultur ist dabei zur verbindenden Erzählung der extremen Rechten geworden – und zwar global.
Ob sie nun von »Volkstod« oder von einem »weißen Genozid« sprechen, die verschiedenen, mehr oder weniger dramatischen Varianten eines »Bevölkerungsaustauschs« sind das dominierende Thema im Rechtsextremismus der Gegenwart. Derlei Erzählungen treiben nicht nur »besorgte Bürger« auf die Straßen und vor Flüchtlingsunterkünfte, sie motivieren auch militante Neonazis zu Attentaten und Massakern. Wie wir in diesem Buch zeigen werden, versucht die extreme Rechte insgesamt, ihre Agenda eines nationalen Erwachens mit Mythen der nationalen Bedrohung zu rechtfertigen. Sie sind zentral im Legitimationsmuster sowohl von Rechtsterroristen als auch von Parteien wie der AfD. Beide begründen ihre Ablehnung der Migration und des bestehenden politischen Systems damit, dass es notwendig sei, eine existenzielle Bedrohung abzuwehren – wenngleich sie unterschiedliche Konsequenzen daraus ziehen. Sie bilden einen übergreifenden Diskurszusammenhang, in dem sich Neonazis, aber auch »normale« Menschen ermutigt oder gar verpflichtet fühlen können, ihre Gemeinschaft vor vermeintlichen Invasoren und Verrätern zu schützen – notfalls mit antidemokratischen Mitteln oder gar Gewalt.
Die Logik, wonach eine derart existenzielle Bedrohung auch drastische Maßnahmen rechtfertigt, findet sich bereits im klassischen Faschismus, der dieselbe Mär vom nationalen Untergang erzählte. Wie die Forschung herausgearbeitet hat, schöpfte der Faschismus der Zwischenkriegszeit seine Dynamik vor allem aus Opfermythen, mit denen sich eine kompromisslose Politik rechtfertigen ließ. Insofern ist es für die faschistische Logik zentral, einen Ausnahmezustand zu konstruieren, der dann außerordentliche Kraftanstrengungen verlangt, damit die Nation sich von feindlichen und schädlichen Elementen befreit. Wir sind überzeugt: Wer die Erfolge des gegenwärtigen Rechtsextremismus verstehen will, muss nachvollziehen, wie sich diese Logik heute in den und durch die sozialen Medien verbreitet. Denn offenbar gelingt es der extremen Rechten im digitalen Kontext besonders gut, abermals erfolgreich Politik mit Erzählungen von nationalem Untergang und Erwachen zu betreiben. Es ist diese spezifische Dynamik, die wir als »digitalen Faschismus« verstanden wissen wollen. Wie sich dieser genau ausbuchstabieren lässt und warum die sozialen Medien eine offene Flanke im demokratischen Gefüge bieten, werden wir gleich im nächsten Kapitel darlegen.
Um die Eckpfeiler des digitalen Faschismus herauszuarbeiten, zeigen wir sodann in den Kapiteln 3 bis 5, wie die Aktivitäten der extremen Rechten in den sozialen Medien mit den Strukturen der sozialen Medien selbst korrespondieren. Dabei stellen wir jeweils eine Manipulationstechnik der extremen Rechten vor, die der digitale Kontext nicht nur ermöglicht, sondern auch verstärkt. Konkret meint das zum einen ihre dramatischen Erzählungen, die durch die digitale Vermittlung von Angst begünstigt werden, zum anderen ihr verwirrendes Spiel mit der Wahrheit, das durch die digitale Konjunktur des Postfaktischen angekurbelt wird, und schließlich ihre Verzerrung des Volkswillens, die durch die digitale Interaktionsökonomie erleichtert wird. Im Zusammenspiel dieser Techniken und Mechanismen nimmt, wie wir in Kapitel 6 zeigen, der digitale Faschismus Form an. Dieser kreist, anders als der klassische Faschismus, nicht um hierarchische Organisationen, sondern mehr um informelle Schwärme, in deren Sog die rechtsextreme Agitation in die breitere Öffentlichkeit überschwappt.
Im abschließenden Kapitel 7 diskutieren wir, welche Herausforderungen eine solche Variante des Faschismus für die offene Gesellschaft mit sich bringt. Diese steht erkennbar vor einem Dilemma, wenn sich faschistische Dynamiken nicht aus formalen Massenorganisationen, sondern aus digitalen (Hass-) Kulturen in den sozialen Medien speisen. Dann schöpft die Intoleranz nämlich ausgerechnet aus Strukturen neue Stärke, mit denen die Meinungsfreiheit erweitert wurde. Um die Intoleranz nicht zu tolerieren, wie es schon der Philosoph Karl Popper mit seinem »Paradox der Toleranz« von wehrhaften Demokratien einforderte,4 scheint in diesem Fall eine politische Regulierung der sozialen Medien fast schon zwingend geboten.
Mit diesem Buch soll keinesfalls der Teufel an die Wand gemalt werden. Es ist nicht so, als machten sich überall Nazis breit und als stünde ein neues 1933 vor der Tür. Unsere Analyse zeigt allerdings, wie die faschistische Logik auch von Strukturen gestärkt werden kann, die ihrerseits nicht als rechtsextrem gelten können. Sie zeigt außerdem, dass es – zumindest hierzulande – nur eine Minderheit ist, die dieser Logik verfallen ist, eine Minderheit freilich, die lautstark demokratische Normen relativiert. Indem wir Faschismus als soziales Phänomen begreifen – als eine illiberale Dynamik, die aus der Verbreitung von nationalen Opfermythen folgt –, wollen wir die Aufmerksamkeit auf Erzählungen (und ihre Verbreitungsweisen) lenken, mit denen offene Gesellschaften gespalten werden. Dabei wirft das Verhältnis von Digitalisierung und Rechtsruck auch grundsätzliche Fragen zur Bedeutung von digitalen Medien in der Demokratie auf. Immerhin wirken diese Medien nun maßgeblich an der Herstellung von Öffentlichkeit mit – und beeinflussen so, ob politische Diskurse verständigungsorientiert oder polarisierend verlaufen. Insofern schildert dieses Buch nicht nur, wie Rechtsextremismus im digitalen Zeitalter funktioniert. Es handelt auch von dem Problem, dass die Regeln, nach denen Massen miteinander kommunizieren, über Wohl und Wehe von Demokratien entscheiden.