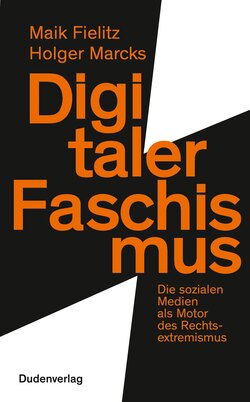Читать книгу Digitaler Faschismus - Holger Marcks - Страница 7
Оглавление2 Das Comeback der Ultranationalen
Ein Wegweiser zum digitalen Faschismus
Das Wort »Faschismus« ist wieder in aller Munde. Die vergangenen Jahre boten immerhin genug Anlässe, um über die Aktualität des Begriffs nachzudenken. Erinnert sei hier nur an die wachsende Schar von sogenannten Reichsbürgern, die sich der Rechtsordnung der Bundesrepublik zu entziehen versuchen; an die zu Hunderten untergetauchten Rechtsextremisten, gegen die ein nicht vollstreckbarer Haftbefehl vorliegt; an die aufgedeckten (und nicht aufgedeckten) rechten Netzwerke inner- und außerhalb der Bundeswehr, die sich auf einen Bürgerkrieg vorbereiten; und nicht zuletzt an die Serie rechtsextremer Terrorakte, die nach dem Ableben des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Diese Erscheinungen, die sich noch als besonders fehlgeleiteter Rand der extremen Rechten abtun lassen, wurden wiederum begleitet von einer Welle an Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte, der Gründung einer Reihe von Bürgerwehren, Hetzjagden auf vermeintliche Ausländer wie in Chemnitz und Aufmärschen von sogenannten Wutbürgern, die ihre Gegner »in den Graben« werfen und diesen dann zuschütten wollen, wie es der Pegida-Gründer Lutz Bachmann formuliert hat.1 Spätestens hier haben wir es nicht mehr mit einer abnormen Randerscheinung zu tun. Es sind tatsächlich ganz gewöhnliche Menschen, die sich damit in die faschistische Tradition stellen, eine Gesellschaft von ihren »Volksschädlingen« befreien zu wollen.
Ja, die extreme Rechte hat Konjunktur. Das zeigt sich nicht nur in neuen Jugendkulturen wie der Identitären Bewegung, welche dem Aufruf von Vordenkern der Neuen Rechten folgt, die Menschen bereits im »vorpolitischen Raum« für sich zu gewinnen. Es zeigt sich auch und vor allem in den weltweiten Wahlerfolgen rechter Parteien und Politiker, die sich entweder direkte Reminiszenzen an faschistische Episoden erlauben oder zumindest einen Politikstil pflegen, der an die Propaganda- und Manipulationsmethoden der historischen Faschisten erinnert. Im Schlepptau haben sie eine aufgepeitschte Wählerschaft, die die gewählten Repräsentanten der Demokratie als »Volksverräter« bezichtigt und mit dem »Establishment« aufräumen will. So auch die AfD, die – als Partei, die sich selbst und ihre Wählerschaft zunehmend radikalisiert hat – den globalen Rechtsruck hierzulande repräsentiert. Aussagen ihrer Vertreter, in denen Fantasien von einer Säuberung durchscheinen und der Nationalsozialismus relativiert wird, sind ebenso zahlreich wie ihre Versuche, das Vertrauen in demokratische Institutionen und Normen zu schwächen.
Sinnbildlich für diese Polarisierungsversuche steht die Regierungskrise in Thüringen vom Februar 2020. Nachdem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ein politisches Tabu gebrochen hatte und sich mit Stimmen der AfD ins Amt des Ministerpräsidenten wählen ließ, war in vielen Zeitungen zu lesen, das Ganze verströme einen »Hauch von Weimar«. Der Vergleich mit Weimar, das als Synonym für den Aufstieg des Nationalsozialismus gilt, drängt sich nicht nur auf, weil die AfD sich (insbesondere im Osten) so stark verankert hat, dass es die demokratischen Parteien wie einst in der Weimarer Republik zuweilen schwer haben, stabile Regierungen zu bilden. Nah liegt der Vergleich auch deswegen, weil der Chef ihres Thüringer Landesverbandes, Björn Höcke, tatsächlich vielen als Faschist gilt, der die Grenzen des demokratischen Diskurses willentlich überschreite. Dabei mögen manche den Begriff »Faschist« eher polemisch mit Blick auf das Gebaren verwenden, das der Kopf des offiziell aufgelösten, aber faktisch immer noch einflussreichen »Flügels« – eines dezidiert völkisch-nationalistischen Netzwerks in der AfD – an den Tag legt. Fast schon wie eine Parodie auf den Faschismus wirkt nämlich sein narzisstisches Bemühen, sich der Nation als uomo virtuoso zu empfehlen, der als strengväterlicher Herrscher die Nation wieder auf Vordermann bringen werde. Für andere ist der ehemalige Geschichtslehrer auch nach wissenschaftlichen Kriterien ein Faschist, worin sie sich durch ein Gerichtsurteil bestätigt sehen dürfen, das es für zulässig erklärte, Höcke als solchen zu bezeichnen. Zu deutlich in der Tradition faschistischer Denkweisen stehen seine Herrschaftsvorstellungen, die der Möchtegernführer unter anderem in einem 2018 erschienenen Gesprächsband bemerkenswert offen darlegte.2
Obwohl also der Begriff des Faschisten im politischen Diskurs mittlerweile häufiger fällt, findet es mancher dennoch unangebracht, in Konsequenz auch von einem Faschismus zu sprechen. Als stellte man damit einen übertriebenen historischen Vergleich her, ja, als wäre der Begriff ganz generell aus der Zeit gefallen. Häufig wird der Faschismus nämlich als eine Epoche verstanden, die mit dem Zweiten Weltkrieg endete. Um heute von Faschismus sprechen zu können, müsse dieser demnach genauso in Erscheinung treten wie damals in der Zwischenkriegszeit. Auf diese Weise wird der Faschismus sozusagen eingefroren, während man anderen politischen Erscheinungen grundsätzlich zugesteht, dass sie sich ihrer Zeit anpassen können. Denn wo sie es nicht tun, gehen sie selbstverständlich unter. Der Liberalismus hat sich ebenso häufig gewandelt wie der Kapitalismus, die Sozialdemokratie ist heute nicht mehr die eines August Bebel, so wie auch kommunistische oder anarchistische Strömungen ihren Ursprüngen nicht ewig gleichen. Der Faschismus bildet da keine Ausnahme. Davon abgesehen, dass faschistische Bewegungen auch nach 1945 im globalen Maßstab fortlebten – man denke nur an die internationalen Netzwerke, die Nationalsozialisten Unterschlupf gewährten und ein faschistisches Revival anstrebten –, tauchten deren Praktiken vielerorts unter anderer Fahne wieder auf. Genau das aber gerät aus dem Blick, wenn der Faschismus als abgeschlossener Fall, als fait accompli, verstanden wird, wie der Historiker Louie Dean Valencia-García zu kritisieren weiß.3 Wenn eventuelle Kontinuitäten des Faschismus stets hinter der Betonung des Neuen zurücktreten müssen, besteht zugleich die Gefahr einer Verharmlosung heutiger Akteure (zum Beispiel des sogenannten Rechtspopulismus).
Die Sonderstellung, die auf diese Weise dem Faschismus im Kabinett der politischen Phänomene zugewiesen wird, liegt ganz gewiss auch in seiner assoziativen Verbindung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust begründet. Schließlich ist der industrielle Massenmord an den europäischen Juden historisch einzigartig und sollte nur mit Vorsicht für Vergleiche herangezogen werden. Mit dieser Zurückhaltung beim Faschismusbegriff beugt man zwar einerseits einer Verharmlosung von Antisemitismus effektiv vor, verstärkt andererseits aber den Eindruck, der Faschismus sei ausschließlich an die Gräuel des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts gebunden. Zumindest dann, wenn unter Faschismus vor allem seine deutsche Ausprägung, also die des Nationalsozialismus, verstanden wird. Der Faschismus war jedoch immer schon ein internationales Phänomen. Und als solches kannte er durchaus verschiedene Varianten, die sich zum Teil deutlich in der Intensität unterschieden, mit der gesellschaftliche Gruppen ausgeschlossen und physische Säuberungen durchgeführt wurden. Die Frage ist daher vielmehr, worin der gemeinsame Nenner besteht, der dieses Gemisch diverser nationalistischer Bewegungen als faschistische Familie erscheinen ließ. Denn von der Bestimmung dieses Kernmerkmals hängt ab, welche Varianten eines sich wandelnden Faschismus überhaupt denkbar sind.
Eine solche Bestimmung steht stets vor dem Problem, dass der Begriff nicht unbedingt dem Selbstverständnis der Bewegungen entsprach, die gemeinhin als faschistisch bezeichnet werden. Selbst der italienische Faschismus, der den Begriff – als dessen Urheber – tatsächlich auf sich selbst anwendete, konnte die eigene Ideologie nur bedingt erklären. Nicht von ungefähr ließ Benito Mussolini, der ein konkretes Programm als Bremse revolutionärer Energien empfand, einst Wissenschaftler noch lange nach der faschistischen Machtergreifung an einer Doktrin des Faschismus arbeiten. Dass der Begriff dennoch eine breite Anwendung fand, verweist darauf, dass hier ein soziales Phänomen entstanden war, das bei allen regionalen Unterschieden doch sehr auffällige Gemeinsamkeiten aufwies, die nach einem eigenen Namen verlangten. In jedem Fall handelt es sich beim Faschismus weniger um eine ausbuchstabierte Ideologie, die von programmatischen Vordenkern als solche propagiert wird, sondern eher um ein Denkmuster, das sich in Rhetorik und Praxis seiner Akteure zeigt. Ähnlich wie der Kapitalismus lässt sich Faschismus als ein aus sozialen Praktiken hervorgegangenes Phänomen begreifen, dem eine bestimmte Logik innewohnt. Diese Logik gilt es zu entschlüsseln, wenn man verstehen möchte, was den Faschismus als Bewegung in seinem Kern auszeichnet – und ob ein solches Kernmerkmal nicht unter neuen Gewändern weiterlebt.
Damit rückt insbesondere die politische Kommunikation der extremen Rechten in den Fokus, die sich auf ihre Logik hin analysieren lässt. Und hier können wir, um es vorwegzunehmen, zweifelsfrei große Gemeinsamkeiten mit der Propaganda faschistischer Akteure von einst feststellen. Heute wie damals beschwört man Szenarien des nationalen Niedergangs oder gar Untergangs, um sich als Retter der bedrohten Nation inszenieren zu können. Der Sozialtheoretiker Theodor W. Adorno sprach in diesem Zusammenhang einmal von einem »unbewußten Wunsch nach Unheil«,4 der insofern zentral für faschistische Akteure ist, als sie aus der beschworenen Katastrophe überhaupt erst ihre Existenzberechtigung ziehen. Diese besteht eben darin, eine Antwort auf den nationalen Verfall zu haben: einen Ultranationalismus, der als soziales Interesse nur noch das gelten lässt, was dem Wiedererstarken der Nation nutzt. Und das wiederum wird von denen definiert, die sich als Einzige der angeblichen Bedrohung entgegenstemmen, sich also als wahre Beschützer des Volkes erweisen. Der Feuilletonist Jens-Christian Rabe nennt das »die Monopolisierung des vermeintlich Volkseigenen, um alle Gegner als Feinde des Volkes erscheinen zu lassen«.5
Die Frage, wie ultranationale Kräfte es schaffen, eine Realität zu konstruieren, die Menschen an die Notwendigkeit eines nationalen Erwachens glauben lässt, ist also entscheidend für das Verständnis faschistischer Dynamiken. Um sie beantworten zu können, müssen wir uns vor allem die technologischen Strukturen ansehen, die dafür sorgen, dass die faschistische Propaganda den Weg in die Köpfe findet. Denn grundsätzlich eröffnen neue Medien auch stets neue Möglichkeiten der politischen Manipulation. Nicht von ungefähr fiel der Aufstieg des Faschismus im frühen 20. Jahrhundert in eine mediale Zeitenwende; und nicht umsonst mussten die Demokratien Regeln für den Umgang mit Medien finden, die die Realitätswahrnehmung der potenziell manipulierbaren Massen prägen. Der klassische Faschismus gehörte jedenfalls zu den eifrigsten Nutzern neuer Technologien wie Massenpresse, Film und Radio. Und auch heute ist es unverkennbar, dass sich die extreme Rechte digitale Medientechnologien wie die sozialen Medien, Messenger-Dienste und bildbasierten Foren gezielt zunutze macht, um ihre Mythen der nationalen Bedrohung zu verbreiten und sich gegenseitig in ihnen zu bestärken. Mehr noch: Es zeigt sich sogar, dass die medialen Möglichkeiten, mit denen diese Mythen die größte Wirkungsmacht entfalten können, auch die Organisationsform des Faschismus bestimmen.
Wie sich das im Detail in einen digitalen Faschismus übersetzt, möchten wir in diesem Buch nachvollziehen. Doch bevor wir uns den konkreten Praktiken dieser Variante des Faschismus widmen, gilt es zu klären, welche Schwachstellen sich mit der Digitalisierung im demokratischen Gefüge aufgetan haben, in die rechtsextreme Akteure derzeit erfolgreich stoßen. Daran anschließend erläutern wir genauer, warum gerade Bedrohungsmythen wichtig sind, um faschistische Dynamiken zu verstehen – ganz allgemein und speziell im digitalen Kontext. Um die Herausforderungen zu diskutieren, die einer Konfrontation mit dem digitalen Faschismus innewohnen, müssen wir daher einerseits ermitteln, was Faschismus als soziales Phänomen ausmacht, und andererseits, wie er sich mit den sozialen Bedingungen verträgt, die etwa durch die sozialen Medien geschaffen wurden. Beides zusammengenommen bietet den Rahmen für unsere Überlegungen dazu, wie gegenwärtige Erscheinungsformen des Faschismus durch eine digitalisierte Welt bedingt sind.
Das Netz, die Demokratie und die extreme Rechte
Es steht mittlerweile außer Frage, dass die Digitalisierung liberale Demokratien vor große Herausforderungen stellt. Neue Probleme ergeben sich etwa als Folge der Automatisierung des Arbeitslebens und der Anhäufung privater Daten, aber auch mit der Möglichkeit von Cyberangriffen und Maßnahmen zur Wählerbeeinflussung aus dem Ausland. Und eben nicht zuletzt mit der digitalen Propaganda durch Gegner der offenen Gesellschaft. Immerhin bietet das Internet auch für Extremisten ein kostengünstiges Werkzeug, mit dem sie ihren politischen Vorstellungen eine größere Reichweite verschaffen können. Sowohl der zwischenzeitliche Hype um den Islamischen Staat als auch das Wiedererstarken rechtsextremer Bewegungen wären ohne die politische Tragweite der sozialen Medien nicht denkbar gewesen. Vorbei ist es mit der einstigen Illusion, das Internet sei seinem Wesen nach ein Mittel der Demokratisierung und des gesellschaftlichen Fortschritts. Wie der Politikwissenschaftler Thorsten Thiel treffend schreibt, ist es bereits zu einem »Kanon unserer Zeit« geworden, »dass man sich im ersten Abschnitt eines Textes zu Internet und Digitalisierung von [solchen] naiven Utopien zu verabschieden habe«.6 Wie konnte es dazu kommen?
Zunächst einmal besitzen neue Kommunikationstechnologien immer das Potenzial, die politische Kultur einer Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Denn mit ihnen wandelt sich die »gesamte Daseinsweise der menschlichen Kollektiva«, wie der Sozialtheoretiker Walter Benjamin einst schrieb.7 Die digitale Revolution steht für eine solche Veränderung, die die Menschen in neue Beziehungen zueinander und zur Welt setzt. Sie reiht sich ein in eine historische Abfolge von bahnbrechenden Medieninnovationen: Buchdruck, Massenpresse, Radio, Fernsehen – und nun eben das Internet. Letzteres bot dabei zunächst durchaus Anlass für progressive Hoffnungen, ließ die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe global miteinander austauschen zu können, doch viele von einer freieren, kreativeren und inklusiveren Gesellschaft träumen. Gerade freie Rede und Meinungsvielfalt waren seit der Jahrtausendwende gern gehörte Versprechungen der Digitalisierung, von denen man sich eine Stärkung demokratischer Debattenkultur erhoffte. Beflügelt wurden diese Hoffnungen etwa durch die Tatsache, dass bis dahin marginalisierte Gruppen nun ein Sprachrohr hatten, um ihre Belange mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen. Zugleich schienen die Bürger gegenüber dem Staat gestärkt, der sich kein Unrecht mehr erlauben sollte, ohne dass es im Netz dokumentiert würde.
Ein weiterer Grund für den anfänglichen technologischen Enthusiasmus in Bezug auf das Internet lag in der vermeintlichen Befreiung des Wissens, das nun für jeden Einzelnen zugänglicher ist. Heute braucht es nur wenige Mausklicks oder Swipes, um Informationen über die gesamte Geschichte der Menschheit jederzeit und überall abzurufen. Offen zugängliche Enzyklopädien wie Wikipedia haben dabei nicht nur die Art revolutioniert, wie wir Wissen aufnehmen, sondern auch, wie sich dieses Wissen weiterentwickelt. Beispielsweise kann dort potenziell jeder an der kollaborativen Erstellung von Artikeln mitwirken, über Inhalte debattieren oder eigene Einträge vorschlagen. Ein ausgeklügeltes System von Evaluationsprozessen sichert dabei die Qualität der Inhalte und soll garantieren, dass keine politischen Interessen in die Wissensproduktion eingreifen. Das Beispiel Wikipedia zeigt, wie sich zentrale Elemente von Bildung, Unterhaltung und Kultur aus den Händen professioneller Unternehmen und staatlicher Institutionen in die partizipativen Formate verlagern können, die das Internet für die Selbstorganisation von Nutzern bereithält.
Unter dem Gesichtspunkt der Selbstorganisation muss auch der gegenwärtige Wandel der Medienlandschaft verstanden werden. Immerhin ist es durch die digitalen Technologien zu einer neuen Norm geworden, dass man Inhalte jederzeit und überall selbst veröffentlichen kann, ohne einer Kontrolle durch Dritte zu unterliegen. Mit dieser Freiheit, sich ohne große Voraussetzungen einer Öffentlichkeit mitteilen zu können, stieg natürlich die Menge an zugänglichen Informationen ebenso wie die Zahl ihrer Sender, die in verschiedensten Formaten um die Aufmerksamkeit der Nutzer buhlen. Der Medientheoretiker Clay Shirky hat diese Popularisierung von Informationstechnologien schon früh als »massenhafte Amateurisierung des Publizierens« bezeichnet.8 Sie erfuhr noch einmal einen deutlichen Schub mit der Einführung des Web 2.0, das mit seinen interaktiven Elementen die medialen Ausdrucksmöglichkeiten stark erweiterte. Seitdem setzen Tech-Unternehmen darauf, aus Konsumenten Produzenten zu machen, die die Kultur der Plattformen mitgestalten. »Broadcast Yourself« war der Slogan, mit dem etwa YouTube eine ganze Generation köderte. Dieses Versprechen digitalen Ruhms, gepaart mit monetären Anreizen, brachte schließlich die berüchtigten Influencer hervor, die zunächst Schleichwerbung für Firmen und später mitunter auch für politische Parteien und Bewegungen machten.
Die Plattformen waren aber auch eine Einladung, Teil einer globalen Community zu werden, die das digitale Interaktionsangebot für Aufrufe, Absprachen und Antworten in sozialen Fragen nutzt. Es dauerte nicht lange, bis diese Möglichkeiten von vielen wahrgenommen wurden, um sich politisch zu organisieren und Prozesse der gesellschaftlichen Veränderung anzustoßen. Insbesondere die Protestbewegungen, die sich Ende der 2000er-Jahre rund um den Globus formierten, wären hier zu nennen. Man denke etwa an die Occupy-Bewegung in den USA oder an die Platzbesetzungen in Spanien und Griechenland, deren Mobilisierungsdynamik vor allem durch die sozialen Medien ermöglicht wurde. Mit den verschiedenen Aufständen in der islamischen Welt wurden manche Plattformbetreiber gar zu Geburtshelfern von Revolutionen erklärt. So wurden die Proteste 2009/10 im Iran als »Facebook-Revolution« und die Revolution in Tunesien 2010/11 als »Twitter-Revolution« bezeichnet. Insgesamt gilt der Arabische Frühling, der mit den tunesischen Ereignissen ausgelöst wurde, als Beleg dafür, wie die Kraft der Plattformen demokratische Impulse in autoritären Staaten fördern kann.
Doch sehr bald schon erhielt die Romanze zwischen Demokratie und sozialen Medien einen Dämpfer. Nicht nur weil die digital organisierten Proteste und Aufstände Gegenreaktionen hervorriefen, die demokratische Perspektiven erstickten, sondern auch weil autoritäre Kräfte, wo sie nicht die sozialen Medien ohnehin beschränkten, sich diese zunutze machten, um gegen demokratischen Widerstand vorzugehen. Infolge der Gezi-Proteste 2013 in der Türkei etwa wurde es üblich, Oppositionelle über Mitteilungen in den sozialen Medien zu identifizieren und zu verfolgen. Zugleich gelangten seither vielerorts autoritäre Politiker in höchste Staatsämter – beispielsweise Donald Trump in den USA oder Jair Bolsonaro in Brasilien –, deren Wahlerfolge ohne finanzstarke Kampagnen in den sozialen Medien ebenso wenig denkbar gewesen wären wie die Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich. Das Zusammenspiel aus Beschleunigung, Personalisierung und Emotionalisierung der öffentlichen Kommunikation hilft offenbar jenen Kräften, die einfache und schnelle Antworten auf komplexe Probleme liefern, während die neuen Möglichkeiten der Desinformation es zugleich einfacher machen, der Öffentlichkeit Sündenböcke für ebendiese Probleme zu präsentieren. Ein besonders trauriges Beispiel hierfür ist der Völkermord an den Rohingya in Myanmar 2017, an dem die gezielte Verbreitung von Hass und Hetze in den sozialen Medien einen entscheidenden Anteil hatte.
Aber auch ein weiterer »Strukturwandel der Öffentlichkeit«, wie es der Philosoph Jürgen Habermas nennt,9 folgte der Digitalisierung auf dem Fuß. Denn die zunehmende Konzentrierung von Internetnutzern auf bestimmte Plattformen führte dazu, dass sich neue Teilöffentlichkeiten bildeten, die nach den Regeln der Tech-Unternehmen funktionieren. So sind gerade die sozialen Medien darauf ausgerichtet, Reaktionen hervorzurufen, die eine Positionierung verlangen. Plattformen wie Facebook geben gar einen Katalog aus Emotionen vor, mit denen Nutzer auf Inhalte reagieren können und sollen: Liebe, Lachen, Überraschung, Traurigkeit und Wut sind neben dem Like-Button Indikatoren für Akzeptanz, Beliebtheit oder Ablehnung. Die öffentliche Relevanz von Themen und Statements leitet sich nicht selten aus dieser ständigen Vermessung von Inhalten ab. Zugleich werden Nutzerdaten so aufbereitet, dass sie sowohl von Unternehmen als auch politischen Parteien dazu genutzt werden können, Zielgruppen mit maßgeschneiderten Informationen zu beeinflussen. Die Folge eines solchen Mikrotargetings, bei dem Nutzer scheinbar individuell angesprochen werden, ist eine besonders drastische Fragmentierung von Öffentlichkeit. Sie untergräbt eine wichtige Grundlage der Demokratie, nämlich die, dass die Bürger möglichst gleich und ausgewogen informiert werden, um in freiem Willen eine rationale Entscheidung zu treffen.
Generell gehört es zu den Interaktionsdynamiken sozialer Medien, dass sich Nutzer Gemeinschaften suchen, deren Ansichten und Werte sie grundsätzlich teilen. Dieses Phänomen, das häufig mit dem – umstrittenen – Begriff der »Filterblase« in Verbindung gebracht wird, ist nicht unbedingt neu. Auch vor dem Internet haben es Menschen vorgezogen, an Orten ihre Zeit zu verbringen, wo sie sich respektiert fühlen und Interessen mit anderen teilen. In den Gruppen und Newsfeeds sozialer Medien wird allerdings die selektive Wahrnehmung des Weltgeschehens dermaßen durch Algorithmen mitgesteuert, dass zwei Menschen, die in derselben Nachbarschaft leben, ihre Umgebung völlig anders wahrnehmen können, weil sie unterschiedlichen Informationssystemen ausgesetzt sind. Andererseits kommen Menschen über die sozialen Medien eher mit Ideen in Kontakt, von denen sie in einer analogen Welt vielleicht nie gehört hätten. Denn über die leicht zu produzierenden und konsumierenden Publikationsformate können zuvor randständige Akteure – wie nicht zuletzt auch die extreme Rechte – leicht ein großes Publikum erreichen. Mit der richtigen Facebook-Story einen Nerv zu treffen oder mit einem viralen Hashtag eine Debatte auszulösen, sind so auch zentrale Motive politischen Handelns geworden. Um in diesem beschleunigten Informationsfluss jedoch mithalten zu können, ist Sichtbarkeit der entscheidende Faktor, weswegen politische Akteure zunehmend mit spektakulären Inszenierungen um die Aufmerksamkeit der Nutzer kämpfen. Die prinzipielle Zugänglichkeit der Informationen findet am Ende dort ihre Grenzen, wo ihre Dramatik nicht mehr ausreicht, um in die jeweilige »Echokammer« der potenziellen Rezipienten vorzudringen.
Kein Wunder also, dass sich nicht nur faktenbasierte Informationen im politischen Segment der sozialen Medien gut verbreiten. Politische Halbwahrheiten, Falschmeldungen, Desinformationen und Hassbotschaften sind zu einem bedeutenden Teil der digitalen Kommunikation geworden, auch weil das Geschäftsmodell der sozialen Medien sie nicht nur zulässt, sondern regelrecht danach verlangt. Denn den Betreibern der Plattformen, deren Kapital aus dem Traffic von Informationen erzeugt wird, geht es primär darum, dass Inhalte – egal welcher Art – möglichst schnell und weit Verbreitung finden, ohne auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft zu werden. Dank der beschleunigten Verbreitung spektakulärer Inhalte können daher auch Akteure mit extremen oder bizarren Weltanschauungen ihre Inhalte viral gehen lassen, indem sie diese nur hartnäckig genug wiederholen. Was zuvor aus der medial vermittelten Öffentlichkeit ausgegrenzt wurde, weil es journalistischen und wissenschaftlichen Standards nicht genügte, findet somit nun doch ein größeres Publikum. Die sozialen Medien sind insofern für weltanschauliche Richtungen, deren Annahmen mit den Prinzipien einer aufgeklärten Gesellschaft kollidieren, eine unverhoffte Gelegenheit, um einen antiaufklärerischen »Informationskrieg« wieder aufleben zu lassen, wie es die extreme Rechte nennt.
Das eigentliche Problem ist dabei nicht, dass falsche Dinge behauptet werden. Auch aufgeklärte Zeitgenossen können sich irren. Und im Grunde dürfte es kaum einen politischen Akteur geben, der nicht schon mal Abstriche an der Wahrheit gemacht hätte – sei es nun aus Opportunismus oder gerade auch aus Verantwortungsbewusstsein. Denn Wahrheit ist in einer komplexen Welt auch immer eine Frage der Vermittelbarkeit, nicht zuletzt, weil demokratische Akteure das Mandat der Massen benötigen, um aufgeklärte Politik machen zu können. Da kann es durchaus im Sinne einer solchen Politik sein, eine komplexe Wahrheit, die nicht verstanden würde, durch zumindest eine einfachere Wahrheit zu ersetzen. Ob man sich damit bereits im Bereich der Lüge bewegt, ist objektiv ebenso schwer zu sagen, wie es unmöglich ist, Wahrheiten endgültig zu bestimmen. Was die sozialen Medien aber über dieses Grauzonenproblem hinaus plagt, ist die schiere Masse an zweifelhaften Inhalten, die nicht nur dazu beitragen, sondern deren Zweck es teilweise sogar ist, das, was als Wahrheit gilt, vollständig zu relativieren. Damit ihre kontrafaktischen Behauptungen verfangen können, benötigen gerade rechtsextreme Akteure ein »postfaktisches« Klima – so das deutsche Wort des Jahres 2016, in welchem Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway die »alternativen Fakten« erfand. Mithilfe der sozialen Medien können sie nun gezielt Lügen streuen, um genau solch eine Kultur des »Bullshits« zu fördern. Mit »Bullshit« bezeichnet der Philosoph Harry G. Frankfurt eine substanzlose Geisteshaltung, welcher der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge grundsätzlich egal sei – und die deshalb eine größere Gefahr für die Wahrheit darstelle als die Lüge selbst.10
Wo Wahrheit beliebig wird, wo sie allein als Frage der subjektiven Meinung empfunden wird, geht das verloren, was der Sozialanthropologe Richard Reich als eine »extrakonstitutionelle Voraussetzung« der Demokratie erkannt hat.11 Diese steht und fällt mit der Fähigkeit zur gegenseitigen Verständigung und lebt somit von gemeinsam geteilten Wahrheiten, zumindest aber von gemeinsamen Kriterien der Wahrheitsfindung. Andernfalls droht das Band der sozialen Übereinkunft von den Fliehkräften der Polarisierung zerrissen zu werden. Wohl wissend, dass es ein Leichtes ist, dieses Band zu strapazieren, verbreiten extremistische Akteure zweifelhafte Informationen im Dauerfeuer, um demokratische Prozesse per se zu delegitimieren. Das ließ sich besonders gut zu Beginn der Corona-Krise beobachten, als sich Teile der extremen Rechten als Retter des Grundgesetzes aufspielten – wobei sie mit ihren Parolen doch deutlich machten, dass sie die dort verbrieften Rechte wohl kaum jemandem außerhalb der eigenen Denkweise zugestehen. Denn frei – und damit schützenswert – ist für sie stets nur die eigene Meinung, während andere Ansichten Teil der Meinungsdiktatur seien. Verstärkt wurden solche Tendenzen dadurch, dass sich viele Menschen über die sozialen Medien ihr eigenes Expertenwissen über das Virus zusammenreimten. Nicht selten war dieses »Wissen« dann von den dort kursierenden Verschwörungstheorien zur Pandemie beeinflusst, wie die Digitalexpertin Katharina Nocun und die Psychologin Pia Lamberty in ihrem viel beachteten Buch Fake Facts genauer aufzeigen.12
Die postfaktischen Informationen, die sich über die digitale Vernetzung breitmachen, wirken also toxisch auf den demokratischen Zusammenhalt. Insofern hat gerade das digitale Zeitalter, das als Krönung der Informationsgesellschaft angekündigt wurde, eine »epistemische Krise« der Demokratie hervorgerufen.13 Immerhin hat es selbst Verschwörungstheorien Auftrieb gegeben, die wie im Fall der »Theorie« der flachen Erde geradezu mittelalterlich erscheinen. Indem sie in der Regel die Welt in Gut und Böse einteilen, leisten sie der gesellschaftlichen Polarisierung Vorschub. Dabei werden die eigenen Meinungen und Weltanschauungen zum Maßstab für die Überprüfung von Fakten erhoben, während alles, was die »gefühlten Wahrheiten« nicht bestätigt, als Verschwörung gegen den »gesunden Menschenverstand« empfunden wird. Eine solche Grundhaltung, die Widersprüche nicht mehr reflektiert, verbindet die hermetisch geschlossenen Weltbilder von Verschwörungstheoretikern seit jeher mit denen der extremen Rechten. In beiden Denkweisen braucht es nämlich Sündenböcke, mit denen sich erklären lässt, warum die Welt nicht so funktioniert, wie man meint, dass sie es sollte. Oder wie es der Amerikanist Michael Butter zusammenfasst: »Alles ist geplant« und »nichts ist, wie es scheint«.14
Damit haben wir nun ausgewählte Aspekte der digitalen Transformation benannt, vor deren Hintergrund sich ein politischer Kulturwandel vollzieht. Sie finden in unterschiedlichem Maße Beachtung in der mittlerweile breit gefächerten Literatur zu der Frage, wie die sozialen Medien die Demokratie verändern und zur Radikalisierung beitragen. Insbesondere die Forschung zur extremen Rechten – einem offensichtlichen Profiteur der Digitalisierung – sieht sich mit der Frage konfrontiert, inwiefern die virtuellen Formen politischen Engagements den Gegnern der offenen Gesellschaft nutzen. Dabei machen rechtsextreme Akteure nicht erst seit gestern von digitalen Mitteln Gebrauch, um ihre politische Botschaft zu verbreiten und neue Anhänger zu rekrutieren. Tatsächlich gehörten sie zu den Ersten, die mit Webseiten, Foren und Diskussionsplattformen technologisch versierte Aktivisten hervorbrachten. Aus diesen zunächst randständigen Communities sollten sie schon bald ausbrechen, um sich die »partizipative Architektur des Internets« zunutze zu machen.15 Sie verzichteten dabei – zumindest nach außen hin – häufig auf das einschlägige, von Rassismus und Ultranationalismus getränkte Vokabular und machten so rechtsextreme Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich.
Diesen Imagewandel darf man sich allerdings nicht als einen von oben gesteuerten Prozess vorstellen. Denn nicht nur veränderte die extreme Rechte mit dem Marsch durch die Plattformen die Diskussionskultur im Internet; die inhärente Logik der Online-Kommunikation veränderte auch den Rechtsextremismus selbst. Als Bewegung, die sich zunehmend globalisierte, schließt sie nun schon eine Weile verschiedene Sprachmuster und kulturelle Milieus ein, deren Dynamiken sich nicht einfach von formalen Organisationen kanalisieren lassen. Vielmehr haben diese digitalen Subkulturen neue Gegenöffentlichkeiten hervorgebracht, die nicht nach der hergebrachten Logik rechtsextremer Organisationen funktionieren. Sie bilden einen Flickenteppich an Überzeugungen, die in der niedrigschwelligen Propaganda von rechts außen einen gemeinsamen Nenner finden, und erweitern durch ihr interaktives Wirken in den digitalen Netzwerken den Resonanzraum auch für rechtsextreme Organisationen. Insofern sind die Erneuerung des Rechtsextremismus und seine Raumgewinne nicht ohne die Bedeutung der sozialen Medien zu verstehen.
Ein erstes Gespür für dieses Verhältnis bekommen wir, wenn wir die digitalen Aneignungsstrategien des Rechtsextremismus betrachten. So wies die Soziologin Jessie Daniels bereits 2009 darauf hin, dass sich das Internet zum wichtigsten Betätigungsfeld der extremen Rechten entwickle, die das Ziel verfolge, dort einen Meinungsumschwung in rechtsextremen Kernfragen – etwa im Umgang mit Minderheiten – zu bewirken. Dieser »Cyberrassismus« verschleierte schon damals seine eigentliche Agenda hinter einer ambivalenten Rhetorik und modernen Darstellungsformen, mit denen sich rechtsextreme Propaganda ansprechend präsentieren ließ.16 Dazu zählte auch, unverdächtige Pseudonyme zu verwenden, mit denen man in Foren die politische Ideologie als persönliche Meinung tarnte. Jedenfalls fand die extreme Rechte im Internet eine neue Möglichkeit des Aktivismus, mit dem sich Menschen aus ihrer Lebenswelt abholen und schrittweise an die rechtsextreme Denkweise heranführen lassen. Diese unverblümt auszudrücken, war wiederum den Szeneforen vorbehalten, in denen man sich offen über Gewaltfantasien und rassistische Verschwörungstheorien austauschte. Das berüchtigte Internetforum Stormfront etwa wurde im Jahr 1995 gegründet und dient seither militanten Rechtsextremen als globaler Umschlagplatz für Informationen und Materialien.
Tatsächlich haben viele Rechtsextreme schon bald das Potenzial eines digitalen Aktivismus erkannt. Insbesondere US-amerikanische Neonazis zogen sich deswegen nach dem Jahrtausendwechsel zunehmend aus »realen« politischen Gruppen zurück, um sich in der virtuellen Parallelwelt neu zusammenzufinden. Die Möglichkeiten, die sie dort vorfanden, waren vielfältig. Wie die Journalistin Karolin Schwarz ausführlich beschreibt, bauten sich auch deutsche Rechtsextreme schon früh ein eigenes System von Webseiten, Online-Versandhandel und Diskussionsforen auf, das nicht nur dem Zusammenhalt und der internationalen Vernetzung diente, sondern auch der Planung von Angriffen auf politische Gegner.17 Mit dem Siegeszug sozialer Medien erreichten die Hassbotschaften aus diesen randständigen Foren dann schlagartig ein größeres Publikum, konnten sie doch jetzt durch Verlinkungen in digitalen Öffentlichkeiten weithin sichtbar gemacht werden. Zugleich ergriff der Rechtsextremismus die Möglichkeit, seine zuvor von den Medien ausgeschlossenen Botschaften ungefiltert in der Öffentlichkeit verbreiten zu können. Indem er nun mit eigenen Nachrichtenformaten eine Gegenöffentlichkeit zu den verhassten »Systemmedien« aufzubauen versuchte, erfand er sich gar als Medienaktivismus neu. Rechtsextreme von heute inszenieren sich daher häufig als politische Influencer, die sich der Verbreitungslogik aller ihnen zugänglichen Plattformen anpassen, um politisch sichtbar und attraktiv zu werden.
Ein weiterer Aspekt im Verhältnis des Rechtsextremismus zu den sozialen Medien ist seine Verschmelzung mit digitalen Gaming- und Trolling-Kulturen. Sie machen es zunehmend schwierig, zwischen kollektivem und individuellem Handeln, zwischen privater Äußerung und politischer Botschaft, zwischen Spaß und Ernst zu unterscheiden. Hier trifft eine Netzkultur, die rassistisch, homophob und antifeministisch geprägt ist, auf politische Vorstellungen von kultureller Überlegenheit und autoritären Sozialstrukturen, die nun in spielerischer Weise neu formuliert werden. Aus diesem politisch-kulturellen Amalgam ging etwa die US-amerikanische Alt-Right-Bewegung hervor, die weltweit Einfluss auf die extreme Rechte nahm. Als wichtigste Zutat in ihrem Erfolgsrezept kann, wie der Journalist David Neiwert betont, insbesondere das profane Mittel der Ironie gelten.18 Damit konnte sie die Öffentlichkeit lange an der Nase herumführen, etwa wenn sie Gewaltfantasien als schlechte Scherze tarnte. Erst seit den Anschlägen von Christchurch, El Paso und Halle, die als gewaltsame Konsequenz dieser digitalen Kulturen nicht mehr zu leugnen sind, wird diese amorphe Form des rechtsextremen Aktivismus ernst genommen. Dabei zeigt sich an den jeweiligen Täterprofilen, dass rechtsextreme Organisationen für den heutigen Rechtsterrorismus kaum mehr eine Rolle spielen. Vielmehr geraten nun Foren wie das bildbasierte Forum 4Chan in den Fokus, die ein Eigenleben als Orte der Radikalisierung entwickelt haben.
Was diese digitalen Kulturen aber mit den formalen Organisationen des Rechtsextremismus teilen, sind ähnliche Erzählungen von Untergang, Verschwörung und Verrat. Sie mögen in verschiedenen Online-Angeboten, die eine Vielzahl von Milieus abdecken, variieren, unterscheiden sich aber oftmals nur in ihren Handlungsperspektiven. Im deutschen Kontext gibt in diesem Konzert mittlerweile die AfD den Ton an, die einen Großteil ihrer Kapazitäten auf die politische Kommunikation in den sozialen Medien verwendet. Zugleich sind ihre Mitglieder dazu angehalten, durch Online-Aktivitäten die Stimmungsmache der Partei zu unterstützen. Im Ergebnis kann keine Partei in Deutschland mit den Interaktionsraten mithalten, welche die AfD etwa auf Facebook erzielt. Und da viele ihrer Mitglieder, Anhänger und Sympathisanten, die fleißig für die Sache interagieren, auch in digitalen Subkulturen unterwegs sind, verbinden sich ihre Erzählungen häufig mit extremeren oder absurderen Elementen aus randständigen Foren. Dabei werden sie in der digitalen Öffentlichkeit durch Schwarmaktivitäten unterstützt, die in jenen Subkulturen vorbereitet werden.
Die Extremismusforscherin Julia Ebner beschreibt in ihrem Buch Radikalisierungsmaschinen zum Beispiel plastisch, wie sich rechtsextreme Online-Netzwerke zur fünften Kolonne des AfD-Wahlkampfs in der Bundestagswahl 2017 aufspielten.19 Ähnlich hatte bereits die Alt-Right bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen von 2016 einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Trumps Prominenz in den digitalen Medien beträchtlich wuchs und sich seine Botschaften in Windeseile verbreiteten. Wie Vertreter der Alt-Right selbst bekräftigen, geht es rechtsextremen Online-Aktivisten wie ihnen nicht nur darum, die Öffentlichkeit digital zu manipulieren, sondern auch darum, das Bewusstsein von breiteren Massen langfristig zu beeinflussen.
Auch in der Fachliteratur zum Rechtsextremismus häufen sich Darstellungen darüber, wie rechtsextreme Akteure erfolgreich im Netz vorgehen. Die Frage, warum sie damit so erfolgreich sind, bleibt jedoch weitgehend ausgespart. Es ist ja nicht einfach Cleverness, die ihren digitalen Erfolg begründet – als machten sie sich die neuen Gelegenheiten nur besser zunutze als andere. Im Gegenteil steht zu vermuten, dass die extreme Rechte sich sogar weniger als andere politische Richtungen an die digitale Umwelt anpassen muss, um in dieser Raumgewinne zu erzielen. Wie bereits angesprochen, verändern neue Medientechnologien stets auch die menschliche Daseinsweise, da sie, wie Benjamin sagt, eine neue »Organisation der Wahrnehmung« hervorbringen.20 Der daraus resultierenden Erleuchtung muss allerdings nichts Kluges folgen. Schon im späten Mittelalter hatte etwa die Druckpresse zur Folge, dass viele Menschen angesichts all der Informationen, die nun eine Welt jenseits des eigenen Dorfes erfahrbar machten, ihren emotionalen Kompass verloren. Bezeichnenderweise war dies die Stunde der »Wutbauern«, die ein neues »großflächiges Wir« gegen das damalige »Establishment« von Kirche und Adel beschworen, wie der Kulturwissenschaftler Sebastian Dümling es beschreibt.21 Entsteht der gegenwärtige rechtsextreme Tumult also womöglich gerade aus der neuen Wahrnehmungsorganisation, die die sozialen Medien mit sich bringen?
So ließe sich zumindest ein Argument des Historikers Antoine Acker ausdeuten. Ihm zufolge gründen illiberale Entwicklungen im digitalen Zeitalter mehr darauf, dass sich die Massen über die sozialen Medien selbst manipulieren – und weniger auf den Propagandatechniken einer autoritären Partei.22 Dieses Argument, das Acker vor dem Hintergrund der Massenunterstützung Bolsonaros in Brasilien entwickelt hat, spiegelt nicht nur die Vorstellung wider, dass die sozialen Medien für rechtsextreme Bewegungen besonders vorteilhaft sind. Es geht auch davon aus, dass aus neuen Kommunikationsstrukturen faschistische Entwicklungen resultieren können. Immerhin kommt den Medien in Demokratien die Funktion zu, zwischen den komplexen Anforderungen der Politik und der begrenzten Urteilsfähigkeit der Masse zu vermitteln – basierend auf gemeinsamen Standards der Realitätsabbildung. Die Tatsache, dass die Masse ihre Medien als Folge der Digitalisierung nun selbst organisiert und rechtsextreme Akteure sie unmittelbar mit postfaktischen Inhalten beeinflussen können, stellt indes ein Einfallstor für faschistische Dynamiken dar, die stets auf der Manipulation der Realität basieren.
Rechtsextreme Bedrohungsmythen im digitalen Kontext
Der Begriff des Faschismus ist freilich selbst Gegenstand von Kontroversen. Immerhin handelt es sich dabei um einen Kampfbegriff par excellence, der links wie rechts verwendet wird, um politische Gegner als Feinde der Freiheit zu stigmatisieren. Ja, tatsächlich auch von rechts. Diese merkwürdige Karriere des Begriffs lässt sich gut an einem Zitat des Schriftstellers Ignazio Silone verdeutlichen: »Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ›Ich bin der Faschismus.‹ Nein, er wird sagen: ›Ich bin der Antifaschismus.‹ « Der angeblich 1944 in die Welt gesetzte Lehrspruch des italienischen Sozialisten erfreut sich heute großer Beliebtheit in rechten Kreisen. Dort führt man ihn gerne an, um antifaschistische Aktivitäten, insbesondere »der Antifa«, als freiheitsfeindlich zu entlarven und sich selbst so als wahrer Antifaschismus zu gerieren. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich in dieser rechten Instrumentalisierung des Zitats genau jene perfide Wendung zeigt, vor der das Zitat warnte.23 Hier soll uns der Umgang damit aber vor allem als Beispiel dafür dienen, welch widersprüchliche Lesarten dem Begriff anhaften.
Vor dem Hintergrund ebendieser Widersprüche ist immer wieder zu hören, dass der Begriff des Faschismus für sachliche Debatten nutzlos geworden sei. Denn dass er polemisch genutzt wird, um zwischen politischen Gegnern und historischen Ereignissen irreführende Parallelen zu ziehen, scheint eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Zumindest aber wird er häufig unpräzise verwendet. Auch Acker ist davon nicht ganz frei, wenn er den Eindruck erweckt, unter Faschismus seien allgemein illiberale oder rechtsextreme Entwicklungen zu fassen. Genauer nehmen es da schon Definitionen aus der Faschismusforschung, wenngleich sich auch hier tiefe Gräben zwischen unterschiedlichen Denkschulen feststellen lassen. Da wäre etwa die marxistische Perspektive, die Faschismus vorwiegend als eine Herrschaftstechnik zur Unterdrückung der Arbeiterklasse analysiert. Andere Betrachtungsweisen machen das Phänomen an ideologischen Merkmalen fest oder definieren es anhand seiner politischen Kultur und seiner sozialen Praktiken.
Die zahlreichen Definitionen von Faschismus stehen nicht unbedingt im Widerspruch zueinander, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte, die sich nicht alle ins Gleichgewicht bringen lassen. Da sie verschiedenen Theorien folgen, interessiert sie jeweils etwas anderes an dem Phänomen. Entsprechend lässt sich nur schwer eine Bedeutung von Faschismus finden, die von allen Seiten als analytisch hilfreich angesehen wird. Der Faschismusforscher Roger Griffin beispielsweise hat sich Anfang der 1990er-Jahre an solch einer »konsensualen« Definition versucht, die auf Basis einer eingehenden Analyse faschistischer Grundlagentexte eine möglichst große Schnittmenge der verschiedenen Sichtweisen bieten soll.24 Seinen Vorschlag, Faschismus als eine revolutionäre Form des Nationalismus zu begreifen, lehnen einige Forscher jedoch ab. Sie erkennen darin eine zu starke Ausrichtung auf ideologische Merkmale, die man ihrer Meinung nach – je nach Schwerpunkt – um diskursive, kulturelle oder psychologische Aspekte erweitern müsste. Insofern besteht auch in der Wissenschaft nach wie vor kein einheitliches Verständnis von Faschismus.
Die Vielgestaltigkeit des Faschismusbegriffs macht diesen aber nicht automatisch nutzlos. Entscheidend ist allerdings, deutlich zu machen, in welchem Sinne man ihn verwendet. Und das hängt wiederum vom konkreten Erkenntnisinteresse ab. In unserem Falle kreist dieses darum, wie die sozialen Medien politische Praktiken fördern, die der Dynamik des Rechtsextremismus zugutekommen. Für diesen Zweck bietet sich ein Verständnis an, das vom Faschismusforscher Robert Paxton entwickelt wurde. Er untersuchte verschiedene Bewegungen der Zwischenkriegszeit, die gemeinhin als faschistisch angesehen werden, und leitete aus ihren Gemeinsamkeiten drei Merkmale des Faschismus ab. Auf zwei davon werden wir später noch zu sprechen kommen. Hier ist zunächst einmal jenes von Interesse, das Paxton als Hauptmerkmal der untersuchten Bewegungen ausmachte: ein politisches Verhalten, »das sich durch eine obsessive Beschäftigung mit dem Niedergang, der Demütigung oder Viktimisierung der Gemeinschaft […] auszeichnet« und diesen wahrgenommenen Zustand durch einen »Kult von Einheit, Stärke und Reinheit« zu kompensieren versucht.25
Paxton beschreibt damit keine spezifische Ideologie, sondern ein Muster der Selbstrechtfertigung, in dem sich die Psychologie, die Kultur und die Politik des Faschismus bewegen. Zentral dafür ist demnach, dass dieser seinen überbordenden Nationalismus aus der Wahrnehmung einer nationalen Bedrohung heraus begründet. Ebendieses Muster hatte auch schon Griffin als bedeutenden Wesenszug des Faschismus ausgemacht. Er spricht von einem »palingenetischen Ultranationalismus«, der vom Mythos einer Nation lebt, die im Untergang begriffen sei und ihre Wiedergeburt (Palingenese) durch außergewöhnliche Anstrengungen erzwingen müsse.26 An anderer Stelle bezeichnet Griffin dieses Muster auch als das »faschistische Minimum«, was bedeutet: Faschismus kann noch andere Merkmale aufweisen, aber ohne das Leitbild vom Erwachen einer bedrohten Nation gibt es keinen Faschismus.27 Diesem Muster, das wir als faschistische Logik bezeichnen möchten, soll im Folgenden unsere Aufmerksamkeit gelten. Denn wenn die wahrgenommene Bedrohung der Nation als Herzstück faschistischer Dynamiken dient, dann stellt sich heute die Frage, wie entsprechende Mythen im digitalen Kontext Verbreitung finden, sodass illiberale oder autoritäre Perspektiven um sich greifen können.
Wir verstehen Faschismus demnach nicht einfach als etwas, das sich auf das Programm politischer Akteure reduzieren ließe, sondern vielmehr als soziales Phänomen. Es besteht in der Wahrnehmung einer nationalen Bedrohung, die von Menschen geteilt wird und in gemeinschaftsbildenden Handlungen zum Ausdruck kommt. Gleichzeitig verstehen wir Faschismus als wandelbares Phänomen, das sich ebenso wie andere politische Erscheinungen zu modernisieren vermag. Oder wie es der italienische Holocaustüberlebende Primo Levi bereits 1974 formulierte: »Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Faschismus.«28 Paxtons aus der Geschichte abgeleitetes Verständnis von Faschismus begreifen wir als Idealtyp, in dessen Zentrum das Kernmerkmal der faschistischen Logik steht: die Beschwörung eines nationalen Untergangs zur Rechtfertigung autoritärer und illiberaler Praktiken. Davon ausgehend sind, wie es der Philosoph Ludwig Wittgenstein nannte, »familienähnliche« Varianten des Faschismus denkbar, in denen zwar das faschistische Minimum erhalten ist, die sich aber in anderen Merkmalen vom klassischen Faschismus unterscheiden.29 Der digitale Faschismus ist eine solche Variante.
Insofern lässt sich der Rechtsextremismus auch nicht pauschal als faschistisch beschreiben. Entscheidend ist vielmehr, welche Wahrnehmungen er transportiert, die für das faschistische Minimum grundlegend sind. Gerade der klassische Faschismus, der sich in der Zwischenkriegszeit entfaltete, war ja augenfällig darum bemüht, im öffentlichen Diskurs eine nationale Krise zu konstruieren. In Deutschland etwa behauptete er einen Überlebenskampf des deutschen Volkes: erniedrigt vom Ausland, geknechtet vom Judentum und verraten durch »Dolchstoß«. Auf diese Weise sollte ein Ausnahmezustand herbeigeredet werden, der nach autoritären und illiberalen Maßnahmen verlangt. Dieses Verhalten – die Philosophin Hannah Arendt nannte es »organisiertes Lügen«30 – ist im Zusammenhang mit dem zweiten Merkmal zu sehen, das Paxton dem Faschismus zuschreibt: ein radikaler Pragmatismus, der sich nicht an »ethische oder rechtliche Beschränkungen« gebunden fühlt, wenn es um das Erreichen politischer Ziele geht.31 Die Wahrheit kann demzufolge jederzeit gebeugt werden, wenn man damit Einfluss und Macht erlangen kann. Inwiefern dieses faschistische Merkmal im heutigen Rechtsextremismus fortwirkt, wird später noch genauer zu sehen sein.
Das faschistische Minimum war im Rechtsextremismus jedenfalls nie wirklich verschwunden. Immerhin versuchte er über Jahrzehnte Ängste vor dem Fremden und Anderen zu schüren, um für ein nationalistisches Revival zu trommeln. Doch zweifellos haben in Zeiten sozialer Medien und globaler Migrationsbewegungen solche Bemühungen zugenommen, die von der Politikwissenschaftlerin Ruth Wodak als »Politik der Angst« bezeichnet werden.32 Damit setzt der Rechtsextremismus verstärkt auf eine emotionale Ressource, deren Wirkmacht einst Mussolini zu seiner Wandlung vom Sozialisten zum Faschisten bewogen haben soll. Denn Angst, so soll er erkannt haben, sei eben ein effektiveres Mittel der Politik als Hoffnung. Was das heute konkret bedeutet, zeigt sich beispielsweise in den Erzählungen, die der globale Rechtsextremismus im Kontext von Migrationsfragen verbreitet. Seine Aktivisten bringen insbesondere den Mythos in Umlauf, die jeweilige Nation sei Opfer eines »großen Austauschs«, wie es etwa die Identitären formulieren, auf die sich auch der Attentäter von Christchurch berief. Dass sich die extreme Rechte in vielen Ländern erfolgreich als Schutz- und Ordnungsmacht empfehlen konnte – dafür stehen ihre Erfolge auf den Straßen und an den Wahlurnen –, basiert nicht unwesentlich auf diesem Mythos, den sie in verschiedenen Erzählvarianten in die Köpfe zu bringen versucht.
Während unter rechtsextremen Aktivisten in den USA vor allem von einem »weißen Genozid« die Rede ist, spricht die extreme Rechte in Deutschland von »Bevölkerungsaustausch«, »Umvolkung« oder gar »Volkstod«. Diese Vorstellungen stammen aus der Mottenkiste der alten völkischen Bewegungen, überlebten in den Nischen des militanten Rechtextremismus und wurden mit der Flüchtlingskrise 2015 aufgefrischt und popularisiert, vor allem durch sogenannte Rechtspopulisten. Oft kleiden sie sich in Parolen über eine »Islamisierung des Abendlands« oder die »Abschaffung Deutschlands«, durch die sie ihren Weg in die breitere Öffentlichkeit finden. Die Rede vom »besorgten Bürger«, der den Verlust seiner Kultur fürchte, zeugt von dieser Normalisierung, die nicht selten mit Verschwörungstheorien einhergeht. So zum Beispiel, wenn die AfD behauptet, der Migrationspakt der Vereinten Nationen – eine unverbindliche Erklärung für einen global einheitlichen Umgang mit Migration – sei ein »verstecktes Umsiedlungsprogramm«.33 Oder wenn der »Posterboy der modernen Rechten« – wie der identitäre Aktivist Martin Sellner häufiger genannt wird – hinter jenem Pakt einen »heimtückischen« Plan vermutet, der »den Untergang der europäischen Völker« besiegele. In jedem Fall aber wird der »Lügenpresse« und dem »linksgrünversifften Establishment« vorgeworfen, die Bedrohung zu verschweigen und Einwanderung gegen den Willen des Volkes zuzulassen.
Solche Narrative bilden die kognitive Grundlage für das, was Griffin »palingenetische Fantasien« nennt.34 Denn in ihrer logischen Konsequenz verlangen sie nach Helden, die die Geschichte hin zu einem nationalen Happy End fortschreiben. Wo auf den Staat kein Verlass mehr ist, gilt es, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um die Gemeinschaft vor den Eindringlingen zu schützen und mit Verrätern aufzuräumen. Dafür stehen nicht nur Drohungen gegen Journalisten und Angriffe auf Kommunalpolitiker, sondern auch die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke, der aufgrund flüchtlingsfreundlicher Äußerungen auf etlichen Todes- und Feindeslisten der extremen Rechten stand. Auch die jüngste Welle des Rechtsterrorismus muss unbedingt in diesem Kontext gesehen werden. Ob Christchurch oder El Paso, ob Halle oder Hanau – all diesen Terrorakten ist gemeinsam, dass die Täter davon überzeugt waren, ihre Gemeinschaft stünde vor dem Untergang. Ähnliches lässt sich auch über die Welle von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte oder die Gründung von Bürgerwehren sagen, an der auffällig viele Menschen ohne typische rechtsextreme Biografie beteiligt sind. Die Bedrohungssituation, die der »besorgte Bürger« als Tatsache betrachtet, mag objektiv gar nicht gegeben sein, ist eben aber – wie das berühmte Thomas-Theorem besagt – »in ihren Konsequenzen real«.35 Diese Grundannahme der Soziologie geht davon aus, dass Menschen nämlich nicht auf Grundlage objektiver Gegebenheiten handeln, sondern je nachdem, wie sie diese Gegebenheiten subjektiv wahrnehmen.
Gerade mit Blick auf die wachsende Bereitschaft vermeintlich normaler Bürger, Gewalt gegen Fremde und Andersdenkende anzuwenden, wurde die Rolle des Internets bereits vielfach diskutiert. In der Regel ist dann von dem Hass die Rede, den rechtsextreme Akteure in den sozialen Medien verbreiten. Er zeige sich in einer Verrohung und Enthemmung der Sprache, die sich schließlich in eine physische Brutalität übersetze. Nun ist es zwar plausibel, davon auszugehen, dass das rhetorische Klima zur Gewaltbereitschaft beiträgt, allein schon, weil sich Einzelne dadurch ermuntert fühlen können, den vermeintlichen Volkszorn auszuleben. Als Erklärung für den rechten Terror, der zumeist als Vigilantismus – also Gewalt durch selbst ernannte Beschützer und Ordnungshüter – in Erscheinung tritt, greift Hassrede aber zu kurz. Sie mag zwar häufig mit Gewaltaufrufen einhergehen, liefert aber für sich genommen keine überzeugende Begründung für die Anwendung von Gewalt. Die Juristin Susan Benesch verweist stattdessen auf die Bedeutung von »gefährlicher Rede«, um den Wirkungszusammenhang von behaupteten Bedrohungen und Gewaltlegitimation zu erklären.
Gefährliche Rede findet insbesondere dann statt, wenn einer Gruppe schlimme Grausamkeiten zugeschrieben werden. Wo dieser etwa unterstellt wird, sie bedrohe die Existenz der eigenen Gruppe, scheint es opportun zu sein, drastisch gegen sie vorzugehen. Immerhin geht es ums eigene Überleben. Und Notwehr ist bekanntermaßen der einzige Grund, der es unbestritten erlaubt zu töten: Wer anderen das Leben nehmen will, darf dieser Norm zufolge unschädlich gemacht werden. Für die Legitimation von Gewalt eignet sich daher kaum etwas besser als der »Spiegelungsvorwurf«: Indem man einer Gruppe unmenschliche Eigenschaften zuschreibt, lassen sich ihre Menschenrechte suspendieren. Die Entmenschlichung des Anderen rechtfertigt also die eigene Brutalisierung. Explizite Gewaltaufrufe sind dafür gar nicht nötig. Im Gegenteil, gerade die Selbstdarstellung als Opfer, das zivilisatorisch überlegen sei, verleiht dem Narrativ der Bedrohung Glaubwürdigkeit und weckt Verständnis für diejenigen, die irgendwann – und sozusagen notgedrungen – zu drastischen Mitteln der Selbstverteidigung greifen. Bisher steht die gefährliche Rede im Schatten der viel zitierten Hassrede, obwohl sie – auch ohne Gewaltrhetorik – wohl grundlegender für Gewalt ist als etwa unverblümte Hetze. Denn schließlich ist es laut Benesch gerade das Gerede von einer »tödlichen Bedrohung durch eine verhasste […] Gruppe, das Gewalt nicht nur angemessen, sondern notwendig erscheinen lässt«.36 Das macht die Rede von der Gefahr so gefährlich.
Insofern kann die gefährliche Rede als entscheidend für faschistische Dynamiken angesehen werden. Die kompromisslose Kraftanstrengung, die die Nation für ihre Wiedergeburt vollziehen soll, ist schließlich in besonderem Maße rechtfertigungsbedürftig, verlangt sie von den Massen doch sowohl grausam als auch moralisch überlegen zu sein. Bedrohungsmythen sind das geeignete Instrument für diesen Spagat – und daher zentral in der faschistischen Logik. Nahezu in Reinform lässt sich diese etwa beim AfD-Rechtsaußen Björn Höcke nachvollziehen, dessen Fantasien von einer nationalen Wiedergeburt besonders weit fortgeschritten sind. So fordert er in dem bereits erwähnten Gesprächsband angesichts des drohenden »Volkstods durch Bevölkerungsaustausch« eine Säuberung Deutschlands von »kulturfremden« Menschen. Dabei müsse »eine neue politische Führung« – natürlich ein alleinherrschender »Zuchtmeister« – »Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen«. Denn: »Existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln«, wobei die Verantwortung für diese »Politik der wohltemperierten Grausamkeit« letztlich bei denen liege, »die die Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben«. Auch ein »Aderlass« sei dafür nötig, da »wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind«.37
Dass es sich bei Höcke um einen Faschisten handelt, ist nicht bloß eine Behauptung, die sich auch ohne Gerichtsbeschluss kaum als Polemik abtun lässt, sondern dem Politikwissenschaftler Hajo Funke zufolge »nachzulesen in seinen eigenen Worten«.38 In diesen Worten zeigt sich genau jene krude Dialektik, die bereits in Paxtons und Griffins Beschreibungen der faschistischen Logik aufschien: Eine überlegene Kultur, die barbarischen Kräften zu weichen droht, soll sich barbarisieren, um ihre Überlegenheit zu bewahren. Diese Gleichzeitigkeit von Opfer- und Täterschaft spiegelt sich auch heute in der eigentümlichen Mischung aus Jammern und Hetzen wider, die in der extremen Rechten zu beobachten ist. Obwohl scheinbar ein Widerspruch, lässt sich gerade das Wechselspiel beider Aspekte als Treibstoff der palingenetischen Fantasien verstehen. Paxton spricht in diesem Kontext von Leidenschaften, die Faschisten antreiben. Diese lehnen rationale Entscheidungsfindungen ab und nehmen große Opfer in Kauf, um einer höheren Sache zu dienen – einschließlich des Selbstbetrugs. Denn wie einst Adorno erkannte, können gerade Überzeugungen, die »durch die objektive Situation nicht mehr recht substantiell sind«, große Leidenschaften hervorrufen. Ihr zweifelhafter Gehalt verlange nämlich danach, diesen »zu überspielen, damit man ihn sich selbst und anderen gleichsam einredet«.39
Während also der palingenetische Ultranationalismus im rechtsextremen Denken sehr lebendig ist, scheint sich jedoch die Rolle rechtsextremer Organisationen bei seiner Entfesselung verändert zu haben. Laut Paxtons drittem Merkmal zumindest zeichnete sich der klassische Faschismus durch eine »massenbasierte Partei engagierter nationalistischer Militanter« aus, üblicherweise hierarchisch und zentralistisch organisiert.40 Ihr und ihren Nebenarmen kam die Aufgabe zu, die faschistische Logik in den Massen zu verankern, etwa indem sie manipulative Propaganda verbreitete und gemeinschaftsbildende Praktiken wie Aufmärsche und Kulturevents, aber auch Saal- und Straßenschlachten organisierte. Natürlich gibt es heute immer noch rechtsextreme Organisationen, die auf diese Weise funktionieren. Die Goldene Morgenröte (Chrysi Avgi) in Griechenland oder die slowakischen Kotlebianer (L’SNS) wären hier als Beispiele zu nennen. Dennoch lässt sich beobachten, dass eine große Zahl von Rechtsextremisten die organisierte Szene verlassen hat, um soziale Stigmatisierung zu vermeiden. Stattdessen sind sie nun in Online-Foren aktiv, wo sie, wie der Extremismusforscher Mark Potok schreibt, »ihre Meinungen anonym darbieten und leicht andere finden können, die ihnen zustimmen«, und das »ohne die Probleme, Kosten und schlechten Anweisungen, die in den meisten Gruppen mit einer Mitgliedschaft verbunden sind«.41
Allerdings bietet die digitale Sphäre der extremen Rechten nicht nur bequemere Möglichkeiten des Aktivismus, sondern auch der organisatorischen Erneuerung. War sie organisatorisch in der analogen Welt lange Zeit gescheitert, kann sie sich mit der Politur des Digitalen neuen Glanz verleihen. Insbesondere die amerikanische Alt-Right steht für so eine erfolgreiche Erneuerung. Obwohl – oder gerade weil – sich diese im digitalen Kontext entstandene Bewegung durch einen Mangel an ideologischer Kohärenz, strategischer Führung und materieller Kooperation auszeichnet, ist es ihr gelungen, faschistische Traditionen salonfähig zu machen. Vor allem wandte sie sich Internetkulturen zu, die darauf aus sind, Menschen größtmöglichen Schaden zuzufügen. So verbanden sich Online-Subkulturen mit Lust auf Provokation mit rechtsextremen Online-Aktivisten, die eine informellere und weniger hierarchische Form politischen Engagements befürworteten. Die Alt-Right unterscheidet sich daher – ebenso wie verwandte Erscheinungen der globalen Neuen Rechten – deutlich vom Faschismus der Zwischenkriegszeit. Das gilt nicht nur in Bezug auf ihre Organisationsstrukturen, sondern auch für die Art und Weise, wie sie mit ihren Vorstellungen die Gesellschaft strategisch durchdringt.
Diese Wandlung wirft die Frage auf, wie genau das Revival der faschistischen Logik durch die Digitalisierung bedingt ist. Generell müssen wir natürlich im digitalen Zeitalter aufs Neue darüber nachdenken, wie soziale Interaktionen funktionieren – einschließlich der Manipulation von Massen. Digitale Plattformen sind zu einem zentralen Marktplatz nicht nur für Handelsgüter, sondern auch für Ideen geworden. Sie stellen damit eine Arena des politischen Wettbewerbs und Konflikts dar, die kollektives Handeln – darunter die Protest- und Organisationsweisen sozialer Bewegungen – grundlegend verändert hat. So haben sie die Netzwerkfähigkeit politischer Akteure, ihre Mobilisierungsreichweite und die Geschwindigkeit des transnationalen Austauschs erhöht. Neue Formen der Artikulation von politischen Forderungen machen zudem eine Unterscheidung zwischen Online- und Offline-Politik hinfällig. Politische Akteure passen ihr Verhalten zunehmend an die Funktionsweise digitaler Plattformen an, wobei sie, wie der Bewegungsforscher Paolo Gerbaudo schreibt, »die Logik von Unternehmen wie Facebook und Amazon [nachahmen] und die datengesteuerte Logik sozialer Netzwerke in [ihre] eigentliche Entscheidungsstruktur integrieren«.42
Diese Verschiebungen haben nicht nur den organisatorischen Kern des Rechtsextremismus verändert, sondern auch dessen Umfeld: also seine Anhängerschaft und das potenziell interessierte Publikum. Während ein Teil der extremen Rechten bereits im vordigitalen Zeitalter den vom US-Neonazi Louis Beam ausgerufenen »führerlosen Widerstand« im Bereich des bewaffneten Kampfes propagierte, wurde diese Vorstellung mit den rechtsextremen Online-Kulturen ganz allgemein zur politischen Realität. Heute bringt sich die Bewegung viel stärker als virtuelle Gemeinschaft zum Ausdruck, in der die Grenzen zwischen organisierten Aktivisten und individuellen Unterstützern verschwimmen. Bei diesen vernetzten Bewegungen verlieren Organisationen ihre ordnende Rolle. Genauer gesagt lässt sich nunmehr schwer bestimmen, was und wer eigentlich organisiert ist oder nicht. Sie stellen unser Verständnis von individuellem und kollektivem Handeln grundsätzlich infrage, da alle Mitglieder in diesen Netzwerken in einer direkten Beziehung zueinander stehen. Auf der anderen Seite jedoch, so stellt die Internetsoziologin Zeynep Tufekci fest, bemühen sich organisierte Gruppen sehr wohl darum, »die Führerlosen zu führen«.43 Indem etwa rechtsextreme Akteure manipulativ und lenkend auf den Schwarm einwirken, geben sie dem scheinbar verstreuten Zorn, der die verschiedenen Ebenen der sozialen Medien überflutet, eine Richtung. Dabei mögen sich die Mitglieder dieser »digitalen Hasskulturen«, wie sie der Medienforscher Bharath Ganesh nennt, nicht einmal bewusst sein, dass sie Teil einer faschistischen Dynamik sind.44
Damit stellt sich aber auch die Frage, inwieweit diese Dynamik von rechtsextremen Akteuren strategisch vorangetrieben wird und inwiefern sie das Ergebnis von Impulsen ist, die durch die sozialen Medien selbst gesetzt werden. Zwar ist es offensichtlich – und durch zahlreiche Studien belegt –, dass die extreme Rechte unter den digitalen Bedingungen gedeiht. Doch es ist längst nicht klar, warum genau sie dermaßen von den sozialen Medien profitiert. Eine erste Hypothese wäre, dass die Funktionsweisen sozialer Medien die Wahrnehmung von Bedrohungen und damit genau jene kognitive Grundlage verstärken, auf der die faschistische Logik aufbaut. Für diese Vermutung gibt es unterschiedliche Erklärungen. Sie hängen aber definitiv alle mit der Tatsache zusammen, dass sich die Art, wie Informationen zugeteilt und ausgewählt werden, in Zeiten sozialer Medien radikal verändert hat. Dabei spielt auch hinein, dass die digitalen Plattformen zu einer Erosion gemeinsam geteilter Wahrheiten beigetragen haben. Der Raum für manipulative Informationen und sogenannte postfaktische Inhalte hat sich dadurch erweitert. Und dieser Umstand scheint sich wiederum gut mit dem radikalen Pragmatismus des Faschismus zu vertragen, der mit Wahrheit auf höchst instrumentelle Weise umgeht.
An dieser Stelle setzen unsere Überlegungen zum digitalen Faschismus an. Sie folgen dem theoretischen Argument, dass die gegenwärtige Konjunktur des Rechtsextremismus als soziales Phänomen zu verstehen ist, das zwar durch das strategische Handeln des organisierten Rechtsextremismus gelenkt wird, seine Dynamik aber aus Wahrnehmungen speist, die durch die sozialen Medien gefördert werden. Wie bereits dargelegt, sind Mythen der nationalen Bedrohung der Treibstoff für die palingenetischen Fantasien, die faschistische Dynamiken auszeichnen. Im klassischen Faschismus war es die Aufgabe einer autoritär geführten Partei, die Massen an einen drohenden Untergang der Nation glauben zu lassen. In Zeiten der sozialen Medien aber manipulieren sich die für Bedrohungsmythen empfänglichen Massen in ihrer Wahrnehmung viel stärker selbst, sodass faschistische Parteien als treibende Kraft faschistischer Dynamiken zumindest teilweise obsolet werden. Um herauszufinden, inwieweit die sozialen Medien nun als neuer Motor dieser Dynamiken fungieren, werden wir uns im Folgenden genauer anschauen, wie rechtsextreme Akteure online agieren und wie ihre Handlungen mit den Strukturen sozialer Medien zusammenwirken. Wo diese nämlich dazu beitragen, dass rechtsextreme Bedrohungsmythen besser verfangen, nimmt der digitale Faschismus Gestalt an.