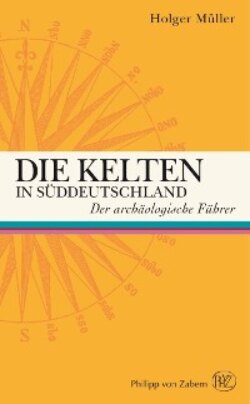Читать книгу Die Kelten in Süddeutschland - Holger Müller - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Oppida
ОглавлениеZu den wohl bedeutendsten oder zumindest auffälligsten keltischen Bodendenkmälern gehören die Oppida (die Bezeichnung selbst geht auf Iulius Caesar zurück). Insgesamt wurden bisher ca. 200 Oppida in neun Ländern gefunden. Die Forschung um diese oft als ersten Städte nördlich der Alpen bezeichneten Anlagen beginnt mit den Grabungen Joseph Déchelettes am Mont Beuvray, auf dem das antike Bibracte lag (1867–1907). Zwar wurden bereits vorher einige Oppida ergraben (u.a. im Auftrag von Napoleon III.), doch entwickelte Déchelette das Konzept der „oppida-Zivilisation“. Doch erst der Archäologe Wolfgang Dehn schlug eine genauere Definition der Oppida vor. So musste nach Dehn ein Oppidum eine Mindestgröße von 30 ha haben, mit einer lückenlosen Mauer befestigt sein und idealerweise auf einer Anhöhe liegen. Außerdem musste sich diese befestigte Siedlung auf das 2./1. Jahrhundert v. Chr. datieren lassen. Diese Definition ist bis heute noch gültig, auch wenn die Größe der befestigten Fläche herabgesetzt wurde (auf 15 ha). Dass die Oppida allerdings fälschlich als älteste Städte bezeichnet werden, zeigt unter anderem das Beispiel der Heuneburg, einer Anlage, die aufgrund ihrer Größe und ihres Aufbaus sicher als Stadt zu titulieren ist, die aber wesentlich älter als die Oppida ist (s. Abb. 1).
Die möglichen Gründe für die Entstehung der Oppida (deren Datierung regional äußerst unterschiedlich sein kann) sind vielfältig und in der Forschung viel diskutiert. Dabei spielt das Schutzbedürfnis ebenso eine Rolle, wie die Intensivierung des Fernhandels (wobei letzteres bereits bei der Entstehung der Fürstensitze eine wesentliche Rolle spielte). Denn für Letzteren benötigten Händler feste und vor allem sichere Anlaufpunkte. Weiterhin war eine gesellschaftliche Stabilität eine wesentliche Voraussetzung. Somit kann die Entstehung der Oppida als Indiz für einen gesellschaftlichen Wandel angesehen werden. Lange Zeit wurden in der Forschung mediterrane Einflüsse bei der Entstehung von Oppida postuliert. Vor allem keltische Söldner sollen das Wissen um das mediterrane Städtewesen in die Heimat getragen haben. Doch ist diese Argumentation eher fraglich. Auch wenn man mediterrane Einflüsse nicht gänzlich ausschließen kann, dürfen sie zumindest nicht überbewertet werden. Auffällig ist, dass die meisten Oppida in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. ihre Funktion verloren und zu großen Teilen verlassen wurden. Bis zu dieser Zeit sind die Oppida aber ein Zeichen für einen hohen Zentralisierungsgrad der einzelnen Gebiete der stark strukturierten Keltiké. Doch muss festgehalten werden, dass Oppida ohne irgendwie geartete Vorgängersiedlungstypen nicht möglich wären. Diese können sowohl befestigt gewesen sein (dann ist an die Fürstensitze zu denken, wobei zwischen dem Verschwinden dieser Siedlungstypen und dem Auftauchen der Oppida auch 250 Jahre liegen, doch lassen sich Übergangstypen festmachen) oder unbefestigt. Allerdings hat die Forschung gezeigt, dass ein Oppidum nicht zwangsweise aus einer Vorsiedlung hervorgehen musste, sondern dass es oftmals tatsächliche Neugründungen waren. Somit kann man ein Bedürfnis nach einem Zentralort postulieren und damit auch eine Zentralisierung, auch wenn die tatsächlichen Gründe für die meisten Gründungen im Dunkeln bleiben. Kann man im westlichen Europa das Eindringen der Römer für das Verschwinden der Oppida als Grund nennen (diese forcierten die Neugründung von Städten in Ebenen und Tälern auch aus taktischen Gründen), sind die Gründe für das östliche Mitteleuropa noch unbekannt. Doch ist die Voraussetzung für ein Stadtleben eine funktionierende Geldwirtschaft.