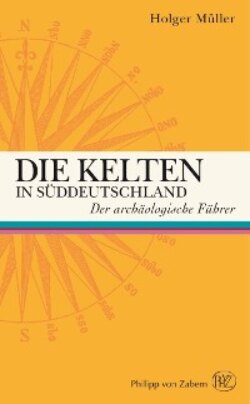Читать книгу Die Kelten in Süddeutschland - Holger Müller - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wirtschaft
ОглавлениеDass die keltische Wirtschaft maßgeblich auf der Landwirtschaft beruhte, braucht einen erst einmal nicht zu überraschen. Doch zeigen vor allem Funde mediterraner Exportgüter in keltischen Gräbern, dass Kontakte zum Mittelmeerraum – vor allem zu den Etruskern, aber auch Griechen – bestanden haben. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die mediterranen Gegenstände auch als Beutegut oder diplomatische Geschenke gedeutet werden. Allerdings ist letzteres ebenfalls ein Hinweis für Kontakte mit der Mittelmeerwelt. Doch vor allem Wein – antike Quellen bezeugen, dass die Kelten diesem, ursprünglich mediterranen Getränk sehr zusprachen – und das dazugehörige Trinkgeschirr fand regelmäßig seinen Weg nach Nordeuropa. Auch alltägliche (wenn auch aufgrund der Handelsentfernung teure) Schmuckstücke, die in relativ großer Zahl gefunden wurden (wie in Reinheim), zeugen von Fernhandelskontakten (im Falle von Bernsteinschmuck gab es Kontakte in den Ostseebereich). Geht man also von einem regelmäßigen Nord-Süd-Handel aus, muss bedacht werden, dass es sich bei den entsprechenden Grabfunden meist um Luxusgüter gehandelt hat und die Kelten daher adäquate Gegenleistungen erbringen mussten (selbst wenn sie als Gastgeschenke zu deuten sind). Die antiken Quellen nennen einige der aus keltischen Gebieten stammenden Güter. Hierzu gehören vor allem Sklaven und Bergbauprodukte wie Salz und Erz. Vor allem das norische Eisen war im römischen Reich für seine Qualität bekannt. So schreibt u.a. Ovid in seinen Metamorphosen (Ov. 14, 712):
„Jene, so bös wie die See, die sich hebt, wenn die Böcklein vom Himmel schwinden, so hart wie der Stahl„ der in norischem Feuer geglüht ist, […].“ (Übers. Breitenbach)
Vor allem in Gallien spielte der Zwischenhandel mit dem aus Britannien stammenden Zinn eine nicht zu unterschätzende Rolle. Doch kann man in dem weiten keltischen Kulturraum, basierend auf Rohstoffvorkommen, Boden- und Klimabedingungen und natürlichen Handelswegen (wie Täler, Flussläufe etc.), verschiedene Wirtschaftsräume festlegen, so dass eine Betrachtung der gesamtkeltischen Wirtschaft an dieser Stelle nicht erfolgen kann (s. Abb. 2).
Doch gibt es einige feste Faktoren, die für einen überregionalen Handel von Bedeutung sind. Dies sind neben den bereits genannten festen (und gesicherten) Siedlungen (Oppida oder in früherer Zeit die Fürstensitze), feste Gesellschaftsstrukturen, handelbare Rohstoffe, bekannte Handelswege und -partner, sowie ein akzeptiertes Tauschverfahren. Letzteres wird durch die Einführung eines Münzwesens erleichtert, wenn nicht gar erst ermöglicht. Der Beginn der keltischen Münzprägung wird in Lt C angesetzt, allerdings gab es wohl erst in Lt D genug unterschiedliche Nominalien, um von einem richtigen Währungssystem zu sprechen. Nachzuweisen ist dies anhand gefundener Tüpfelplatten (zur Herstellung der Schrötlinge) und Prägestempeln (so u.a. in Manching), aber auch von Feinwagen (ebenfalls in Manching und Hochdorf gefunden). Nun existieren auch typisch keltische Bildmotive. Ursprünglich wurden meist griechische Gold- und Silbermünzen (oft die von Philipp II. und Alexander III.) nachgeahmt. Eine Ausnahme hiervon ist Süddeutschland, wo eher römische Nominalien imitiert wurden.