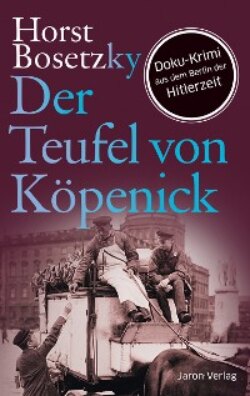Читать книгу Der Teufel von Köpenick - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 6
Zwei 1921
ОглавлениеHeinz Franzkes Hand war bereits oben, noch bevor der Lehrer seine Frage richtig formuliert hatte, und zudem schnipste er auch noch mit Daumen und Mittelfinger. Das wurde zwar auf dem Gymnasium nicht gern gesehen, brachte ihm aber dennoch den gewünschten Erfolg, und er wurde aufgerufen.
»Franzke, was verstehen wir unter der Benrather Linie?«
»Die Benrather Linie markiert in der Entwicklung der deutschen Sprache, das heißt bei der sogenannten zweiten Lautverschiebung, die Grenze zwischen dem ober- und dem niederdeutschen Gebiet.« Franzke hatte, nachdem er aufgesprungen war, kerzengerade dagestanden und so artikuliert gesprochen wie kaum ein anderer Schüler in Steglitz.
»Und weiter?«, fragte Dr. Jerxheimer.
»Südlich der Benrather Linie wandelten sich verschiedene Laute, und es entwickelte sich das heutige Hochdeutsch, nördlich davon – im Englischen, Holländischen oder im Platt – blieben sie bestehen. Das / t/ beispielsweise wandelte sich unter bestimmten Voraussetzungen im Hochdeutschen zu / ss/ oder / ts/, also wie in water zu Wasser oder two zu zwei, und / p/ wurde zu / ff/ beziehungsweise / pf/, zum Beispiel ape zu Affe oder pound zu Pfund. Zusätzlich wandelte sich das / d/ zu / t/ wie in day zu Tag oder deep zu tief. Schließlich wurde aus dem alten / Þ/, das wir im Englischen heute noch haben, im Hochdeutschen das/d/, also thing zu Ding und thanks zu danke.«
»Danke, Franzke! Setzen, Eins!«
Bei Dr. Jerxheimer hing zu Hause über dem Schreibtisch der große Satz des Heraklit: Erziehung heißt, ein Feuer entfachen, und nicht, einen leeren Eimer füllen. Dem Erreichen dieses Zieles galt sein stetes pädagogisches Streben, obwohl er aus langjähriger Erfahrung wusste, dass es höchst utopisch war, denn nur wenige Schüler waren vom Intellekt und Willen her so ausgestattet, dass sie sich entzünden ließen, die meisten waren ganz gewöhnliche Eimer, manche sogar nur aus Blech und nicht einmal aus Emaille.
Aber dieser Franzke war einer, bei dem sich das besagte Feuer entfachen ließ. Der war begierig danach, Wissen in sich aufzunehmen, der hatte ein ganz ausgezeichnetes Gedächtnis, der konnte wunderbar formulieren. Und außerdem war sein Verhalten durchweg tadellos. Wenn sich andere Schüler seines Alters pubertären Späßen hingaben, zog er in die Arena und trainierte, um einmal ein berühmter Mittel- und Langstreckenläufer zu werden wie Paavo Nurmi aus Finnland.
Trotz seiner guten Noten in allen Fächern, mit Ausnahme von Musik und Zeichnen, ging Heinz Franzke keineswegs gern zur Schule, denn in seiner Klasse war er nicht übermäßig beliebt. Die einen hielten ihn für einen Streber, den anderen galt er als Schleimer, weil er sich bei Konflikten zumeist auf die Seite der Lehrer schlug, den Dritten schließlich war er zu ernsthaft und kaum einmal für Späße und Streiche zu haben.
Dabei wäre Franzke so gern zum Vertrauensschüler gewählt worden, doch nie erhielt er mehr als drei Stimmen – seine eigene mitgezählt. Da half es auch nicht, dass er die ganze Klasse zum Essen und Trinken in die Gaststätte seines Vaters einlud.
Nun stand wieder eine Wahl bevor, und niemand zweifelte daran, dass Robert Cholet, ein schwarzhaariger Filou hugenottischer Herkunft, nahezu alle Stimmen bekommen würde. Bis auf die von Franzke und dessen beiden Freunden Werner Rosinski und Lothar Lemke.
Die drei tuschelten in jeder Stunde und suchten nach Möglichkeiten, um Robert Cholet die Gefolgschaft abspenstig zu machen.
»Ich schlage ihn dermaßen zusammen, dass er für eine Weile ins Krankenhaus muss«, sagte Werner Rosinski.
Franzke verdrehte die Augen. »Mensch, dann wird er doch zum Märtyrer, und sie wählen ihn erst recht alle.«
Lothar Lemke sah das auch so. »Das muss man viel klüger anfangen. Wir müssen ihn in eine Falle locken.«
Dr. Glinka, ihr Lateinlehrer, fuhr dazwischen: »Lemke, hörst du wohl auf zu schwatzen! Zur Strafe schreibst du bis morgen hundertmal Ave Caesar, morituri te salutant. Das heißt?«
»Äh …«
»Nicht äh! Setzen, Fünf! Sondern … Cholet?«
»Sei gegrüßt, Kaiser, die dem Tod Geweihten grüßen dich.«
»Richtig! Und wer bei mir keine Vokabeln kann, der ist dem Tode geweiht. Also, Rosinski: famem perferre?«
»Die … äh … die Familie vollenden.«
»Unsinn! Fames ist der Hunger, fame mori verhungern und famem perferre Hunger leiden.«
Mit sichtlicher Freude verpasste er Werner Rosinski die nächste Fünf. Dr. Gernot Glinka war der meistgehasste Lehrer des Gymnasiums. Schule hieß für ihn Selektion, und nur wenige hielt er für auserwählt, sich mit dem Lorbeerkranz des Abiturs schmücken zu dürfen. Noten waren für ihn die Machete, mit der er sich ohne jedes Mitleid ans Ausholzen machte. Starke Bäume entstanden nur dadurch, dass man ihnen ausreichend Licht und Nahrung verschaffte, indem man die schwächeren rechtzeitig fällte.
Eigentlich gefiel Heinz Franzke diese Einstellung, zumal er als Primus nicht Gefahr lief, ausgeholzt zu werden, aber seine Freunde Werner Rosinski und Lothar Lemke waren Wackelkandidaten. Ihre Versetzung war auch diesmal wieder arg gefährdet. Dr. Glinka hatte sie auf der Abschussliste, und niemand zweifelte daran, dass er sich bei der nächsten Zensurenkonferenz mit seiner Meinung auch durchsetzen würde. Zwar gab es Lehrer mit sozialem Mitgefühl, aber die kamen gegen Dr. Glinka nicht an.
Dr. Glinka war ein einsamer Mensch. Das machte ihn hart. Ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer konnte er frei agieren. Nur ganze zwei Monate hatte seine Verlobung gehalten, dann war ihm klargeworden, dass er nur als Einzelgänger glücklich werden konnte. Dass er so isoliert war, hing auch damit zusammen, dass er aufgrund eines Magenleidens, das noch kein Arzt richtig diagnostiziert hatte, unter einem üblen Mundgeruch litt.
»Mit dem an der Front hätten die Deutschen den Krieg nicht verloren«, spotteten die Schüler. »Der hätte die Alliierten nur anhauchen müssen, und ganze Bataillone wären zur Erde gesunken.«
Tatsache war, dass alle seine Gesprächspartner bemüht waren, einen Abstand von mindestens einem Meter zu ihm zu halten, andernfalls wagte man nicht mehr zu atmen.
»Fast wäre ich erstunken«, sagten die, die ihm zu nahe gekommen waren.
Niemand aber traute sich, ihm zu sagen, dass er – wie der Hausmeister Leibniz es ausgedrückte – »aus dem Mund stank wie eine Kuh aus dem Arschloch«.
Dr. Glinka selber aber nahm nicht wahr, wie es um ihn stand.
Das alles brachte Franzke auf eine Idee. Konnte er die in die Tat umsetzen, hätte er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: seine beiden Freunde gerettet und Robert Cholet in den Schatten gestellt.
Als sie am Sonntagabend von Rangsdorf aus, wo die Franzkes ihre Laube hatten, mit der Bahn nach Hause fuhren, steckte ein kleines, sorgfältig verschlossenes Glas in seinem Rucksack – ein Glas voll mit Jauche. Die nun füllte er am Montagmorgen ungesehen in das Tintenfass, das nach alter Sitte im Lehrertisch eingelassen war.
Dr. Glinka kam gewohnt energisch ins Klassenzimmer und warf sein Lateinlehrbuch derart krachend auf den Lehrertisch, dass die Jauche aus dem Tintenfass schwappte und sofort ihren vollen Duft entfaltete.
»Hier stinkt es aber heute!«, rief Dr. Glinka.
»Hier stinkt es immer«, murmelten einige.
»Wo kommt das her?«, fragte Dr. Glinka.
»Vom Lehrertisch«, sagte Franzke.
Jeden anderen hätte Dr. Glinka nun zusammengestaucht, aber Franzke war sein bester Schüler. Der war nie aufmüpfig. Dem konnte er doch keine unlauteren Motive unterstellen. Als er sich nun auf dem Lehrertisch umsah, entdeckte er die Jauchespritzer und kam auch schnell dahinter, dass im Tintenfass noch etwas anderes schwappte als nur Tinte. »Wer war das?«
Schweigen.
Franzke blickte zu Boden, konnte aber an sich halten. Sich jetzt zu melden hielt er für unklug. Sein Plan sah anderes vor.
Als sich auch nach einigen Minuten keiner gemeldet hatte, holte Dr. Glinka den Rektor und erstattete sozusagen Anzeige gegen unbekannt.
Der Rektor war ein eingefleischter Reformpädagoge und hatte immer wieder überlegt, wie er Dr. Glinka wohl loswerden könne. Die Jauche war ihm nun ein willkommener Anlass, mit dem anderen Tacheles zu reden. »Es tut mir leid, Herr Kollege, aber einmal muss es ja sein, dass Ihnen jemand die Wahrheit sagt, in Ihrem ureigensten Interesse.«
»Was für eine Wahrheit?«, fragte Dr. Glinka.
»Dass Ihre Atemluft für Ihre Mitmenschen eine gewisse olfaktorische Belästigung darstellt.«
Dr. Glinka fuhr auf. »Wollen Sie damit sagen, dass ich Mundgeruch habe?«
»Ja!«
Das Gespräch, das die beiden anschließend noch führten, wurde immer erregter und endete damit, dass Dr. Glinka den Schuldienst quittierte und einen leitenden Posten in einem großen Wörterbuchverlag übernahm – mit einem Einzelzimmer.
Der Rektor fand am nächsten Vormittag in seiner Post einen anonymen Brief, in dem geschrieben stand, dass der Schüler Heinz Franzke dem Lehrer Dr. Glinka Jauche ins Tintenfass geschüttet hatte. Geschrieben hatte den Brief Franzke selber, und zwar auf der Schreibmaschine seines Onkels.
Als Franzke ein volles Geständnis abgelegt hatte, jubelte die ganze Klasse und wählte ihn, den Tyrannenmörder, anschließend zum Vertrauensschüler.
Die Strafe fiel gering aus, denn zum einen hasste der Rektor alles Denunziantentum, und zum anderen war er Franzke insgeheim zu großem Dank verpflichtet, hatte er sich doch durch dessen Missetat endlich von Dr. Glinka trennen können.
Von nun an allerdings bekam Heinz Franzke keine ganz so guten Noten mehr, denn die übrigen Lehrer legten Dr. Glinka gegenüber, sosehr sie ihn auch gehasst hatten, sozusagen posthum eine Solidarität an den Tag, mit der Franzke nicht gerechnet hatte.
Wenn er später einmal gefragt wurde, warum er nicht Staatsanwalt geworden sei, sondern »nur« Kriminalbeamter, dann hing das sicher mit der Aktion »Jauchefass« zusammen und konnte als Dr. Glinkas spätere Rache verstanden werden. Aber noch war es nicht so weit. Walter Franzke, der Vater von Heinz, war in Kalisch zur Welt gekommen, einer Kreisstadt in der preußischen Provinz Posen, hatte einige Zeit Agrarwissenschaft in Breslau studiert und war dann als Gutsverwalter nach Pilchowitz gegangen, einem Dorf in der Nähe von Kattowitz. Erst normaler Soldat an der Ostfront, hatte er sich bei Kriegsende der Marine-Brigade Erhardt angeschlossen und in dessen Freicorps im Baltikum gekämpft. Bis zum Leutnant war er aufgestiegen, dann hatte man ihm im Verlaufe des Kapp-Putsches sein linkes Knie zerschossen. Was tun mit einem steifen Bein? Die Reichswehr hatte ihn als »Krüppel« ausgemustert, und der Gutsherr hatte schnell verkauft, als sich abzuzeichnen begann, dass die Versailler Siegermächte weite Teile Oberschlesiens den Polen zuspielen würden. Nach einigem Hin und Her in Berlin hatten ihm seine alten Kameraden schließlich zu einem kleinen Lokal in der Steglitzer Albrechtstraße verholfen, dem »Heimatstübchen«. Hier nun konnte er nach Gutdünken herrschen. Und das Geschäft lief gut, kamen doch zu den normalen Gästen regelmäßig auch Mittelsmänner der Organisation Consul.
Heinz Franzke bewunderte seinen Vater. Schneidig war er, trotz seines Hinkefußes, und kommandieren konnte er wie kein Zweiter. Entweder man hatte diese Gabe, oder man hatte sie nicht. Walter Franzke hatte sie. Sich ihm zu fügen hieß immer, das Richtige zu tun und auf der Siegerstraße zu sein. Seine Feinde nannten Walter Franzke einen Herrenreiter, doch das empfand er als Ehrung. Er war alles andere als ein tumber Landsknecht und konnte die Zeichen der Zeit viel besser lesen als die meisten Intellektuellen in den Redaktionen und Hörsälen, und wenn er sagte »Kinder, wartet nur ab, unsere große Zeit wird noch kommen«, dann hatte das einiges Gewicht, und sein Sohn sah ihn durchaus als Propheten.
Heinz Franzkes Mutter, Ida mit Vornamen, war ihrem Mann mehr Dienerin als Ehefrau. Schon als Magd auf seinem Gut, zuständig für das Kühlen der Milch, hatte sie ihn angehimmelt und war ihm willig gefolgt – erst ins Heu, dann vor den Traualtar. Immerhin. Er konnte sich keine bessere Mutter für die vielen Kinder wünschen, die er zu zeugen beabsichtigte. Fünf waren es geworden, und Heinz war das jüngste. Außerdem war Ida die Schönste weit und breit gewesen, und auch heute noch kamen viele Männer ins »Heimatstübchen«, um sich den nötigen sexuellen Appetit für zu Hause zu holen. Daneben war Ida Franzke eine glänzende Köchin.
Heinz hatte keine besonders enge Bindung zu seiner Mutter. Bei fünf Kindern konnte die Ration an Liebe und Zuwendung, die jeder Einzelne bekam, ohnehin nicht groß sein, aber er hatte das Gefühl, dass sie ihn geradezu hasste. Vielleicht lag es daran, dass er diese etwas überhebliche Art an sich hatte, diese Arroganz des Gebildeten allen dumpfen Menschen gegenüber, und seine Mutter verstand von Politik, Kunst und Kultur nur wenig, und die Briefe, die sie schrieb, wenn sie überhaupt welche schrieb, wimmelten von Fehlern. Die Glucke, die er sich immer gewünscht hatte, die wärmende und alles umfassende Mutter war sie auch nicht. Wenn sie ihn nur einmal so gestreichelt hätte wie ihre Katze oder ihren Hund!
Dabei versuchte er durchaus, der Mutter zu gefallen, indem er viel im Haushalt half und das erledigte, wozu sie keine Zeit mehr fand, zum Beispiel Jagd auf die Getreidekäfer zu machen, die sie seit kurzem in der Küche hatten. Wenn die Beamten vom Lebensmittelaufsichtsamt die bei ihnen entdeckt hätten, wäre sicher der Teufel los gewesen, und womöglich hätte man die Schließung des »Heimatstübchens« angeordnet.
Franzke nahm sich eine Lupe und ging auf die Jagd. Die Käfer waren etwa drei Millimeter lang und so schmal wie ein dicker Bleistiftstrich. Wenn sie entdeckt wurden, dann stellten sie sich häufig tot, und oft hatte er schon ein Teeblatt zerdrückt und in seiner Liste vermerkt. Darum also die Lupe. Immer auf der Suche nach Brotkrümeln, aber auch Nusssplittern, wie sie in der Schokolade steckten, streiften die Tierchen umher. Riss er die Schranktüren auf, verharrten sie entweder und hofften, für einen toten Gegenstand gehalten zu werden, oder aber sie krabbelten los und flitzten in Richtung irgendeiner Ritze. Aber bevor sie ihm entkommen konnten, hatte er sie bereits mit dem rechten Zeigefinger erwischt und genüsslich zerquetscht. Es war ein lustvolles Gefühl, die Welt von Ungeziefer zu reinigen. Ein jeder Käfer ergab einen Strich auf seiner Liste. Sein Rekord lag bei dreißig Stück am Tag, und er hoffte, noch auf fünfzig zu kommen. Sie mussten irgendwo hinter den Schränken ein Nest haben, jedenfalls fehlte es nie an Nachschub. Manchmal ließ er, obwohl es ihm schwerfiel, einen Tag verstreichen, um dann am nächsten eine größere Ausbeute zu haben.
»Morgen kommt der Kammerjäger«, sagte sein Vater.
»Nein, bitte nicht!« Franzke fürchtete um den Verlust seiner Lieblingsbeschäftigung. »Ich schaff das schon alleine.«
Das war zu einer Zeit, als er Joseph Fouché, den französischen Polizeiminister, bewunderte. Der war 1793 nach Lyon geschickt worden, wo es einen Aufstand gegen die neuen Herren gegeben hatte. Man wollte den König wiederhaben. Um die Gegenrevolution niederzuschlagen, ließ Fouché an die 1600 Todesurteile vollstrecken und bekam dafür den Namen mitrailleur de Lyon, der Schlächter von Lyon.
Das imponierte Franzke. Man musste alles ausmerzen, was die Ordnung störte. Diese Gedanken bewegten ihn auch, als er in der Zeitung las, dass in der Gegend um den Schlesischen Bahnhof herum, insbesondere im Luisenstädtischen Kanal, immer wieder Leichenteile gefunden wurden. Ein Frauenmörder trieb dort sein Unwesen. Mit seinen Freunden Werner Rosinski und Lothar Lemke diskutierte er das lang und breit.
»Wer kann so was nur machen?«, fragte Werner Rosinski.
»Ich war es nicht!«, antwortete Lothar Lemke.
»Doch, dein Opa wohnt ja in der Koppenstraße, und da fährst du immer hin.«
»Nein, geht nicht«, warf Franzke ein. »Es heißt ja, dass die Leichenteile immer nachts ins Wasser geworfen werden, und da liegt Lothar bestimmt zu Hause in seinem Bettchen. Aber vielleicht war es ja sein Opa.«
»Du kriegst gleich ein paar gescheuert!«, rief Lothar Lemke.
Werner Rosinski war immer knapp bei Kasse und hätte gern durch die Ergreifung des Täters sein Taschengeld ein wenig aufgebessert. »Ist denn ’ne Belohnung ausgesetzt?«
Franzke schüttelte den Kopf. »Nein. Aber die Kriminalpolizei, das ist ja sowieso nur ein Haufen von Stümpern. Seit Jahren finden sie nun schon Leichenteile, und noch immer haben sie den Kerl nicht gefasst. Dabei ist die Sache doch ganz einfach: Man braucht nur Polizisten als Lockvögel am Schlesischen Bahnhof herumlaufen zu lassen.«
»Das fällt doch auf«, wandte Lothar Lemke ein. »Spätestens dann, wenn der denen an die Wäsche will.«
»Mensch, dann haben sie ihn doch!«, rief Werner Rosinski. »Ob wir uns nicht auch verkleiden können?«
Sie überlegten ernsthaft, wie sie das anstellen konnten, und wären womöglich auch ausgezogen, den Lustmörder zur Strecke zu bringen, wenn die Polizei nicht am 21. August 1921 Karl Großmann verhaftet hätte, die »Bestie vom Schlesischen Bahnhof«.
Eine wichtige Bezugsperson für Heinz Franzke war sein Onkel Richard, Richard Franzke, von Beruf Staatsanwalt. Schon sein Äußeres war furchteinflößend. Auf dem massigen Körper, weit über einhundert Kilo wog er, saß ein Schädel von Kürbisgröße, kahlgeschoren und glänzend wie eine Billardkugel. Durch die dicken Gläser seiner schwarzen Hornbrille wurden die dunkelbraunen Augen derart vergrößert, dass die Angeklagten das Gefühl hatten, bis in den letzten Winkel ihrer Seele und ihres Gedächtnisses durchleuchtet zu werden. Aber nicht nur durch diese Wucht wurden sie eingeschüchtert, sondern ebenso durch die schneidende Stimme Richard Franzkes und seinen scharfen Verstand. Nicht zufällig war er ein blendender Schachspieler und hatte seinem Verein bei Wettkämpfen schon viele Punkte eingebracht. Wäre er von seinem Beruf nicht aufgefressen worden, hätte er es, so sagte man, durchaus zum Großmeister bringen können.
Als Junge genoss es Heinz Franzke, mit seinem Onkel, wenn der sich einmal vom Dienst freimachen konnte, am frühen Abend hinten in der Gaststube zu sitzen und Schach zu spielen. Ins Wohnzimmer durften sie nicht, da der Onkel Zigarre rauchte und Ida Franzke um ihre Gardinen fürchtete.
Zum Aufwärmen kam er dem Jungen ein jedes Mal mit einer Denksportaufgabe. »Welches sind die größten Philosophen des Abendlandes?«
Heinz Franzke musste nicht lange nachdenken. »Aristoteles, Platon und Sokrates.«
»Gut, mein Junge! Platon und Sokrates unterhalten sich. Sagt Platon: ›Sokrates’ nächste Behauptung wird falsch sein.‹ Antwortet Sokrates: ›Platon hat die Wahrheit gesagt.‹ Na, Heinz, was sagst du als großer Logiker, wer hat recht?«
»Das kann man nicht entscheiden, das geht einfach nicht, das ist wie die Quadratur des Kreises.«
»Richtig, das nennt man eine Paradoxie.« Der allmächtige Onkel war zufrieden. »Nun aber zu unserer ersten Schachpartie! Möchtest du lieber Weiß, wo du die Initiative ergreifen kannst, oder Schwarz, wo du nur reagieren musst?«
»Weiß natürlich!«
»Mutig, mein Junge, mutig! Soll ich dir die Dame vorgeben, oder soll ich auf meine beiden Türme verzichten, damit du auch mal eine Chance hast?«
Heinz Franzke guckte böse. »Hör auf, mich zu beleidigen, sonst … Du weißt, wenn es zum Duell kommt, schieße ich viel besser als du.«
Sein Vater hatte es ihm heimlich beigebracht. Man wusste ja nie, wozu es gut war.
Der Onkel grinste. »Ich wollte ja nur einmal sehen, ob du auch wirklich standhaft bist. Ich könnte dich auch gewinnen lassen, ohne dass du es merkst, aber ich will dir nicht die Freude nehmen, mich im fairen Wettkampf zu schlagen. Also los, den ersten Zug!«
Natürlich verlor Heinz Franzke auch diesmal, wenn es auch bis zum 34. Zug dauerte, bis der Onkel sein »Matt, mein Lieber!« verkünden konnte, was Rekord war.
»Du verstehst es schon großartig, ein Spiel systematisch aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die Figuren sich gegenseitig decken. Was dir aber noch fehlt, ist die Fähigkeit, strategisch zu denken, also mehr als zwei Züge im Voraus zu planen.«
»Ich setze mehr auf originelle Einfälle«, erklärte Heinz Franzke.
Und damit sollte er im nächsten Spiel Erfolg haben, als er sich absichtlich viele wichtige Figuren schlagen ließ, so dass sich der Onkel schon gar nicht mehr richtig konzentrierte und ihm prompt in die Falle ging. Der König seines Onkels stand so eingeklemmt, dass Franzke ein und denselben Zug unendlich wiederholen konnte, und das bedeutete, dass die Partie remis gewertet wurde.
»Herzlichen Glückwunsch, mein Junge!«, rief der Onkel. »Auf diese Leistung kannst du stolz sein. Bist erst dreizehn Jahre alt und ringst mir schon ein Remis ab. Walter, für mich ein Glas Sekt und für den Jungen … Ach was, der darf das auch mit einem kleinen Schluck begießen.«
Sie hatten gerade miteinander angestoßen, als ein maskierter Mann ins Lokal stürzte. Mit nur zwei Sätzen war er am Tresen und schrie: »Geld her – oder ich schieße!« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, jagte er eine Kugel in die Decke.
Walter Franzke hatte an der Front zu viele Gefechte erlebt, um auch nur für eine Sekunde die Contenance zu verlieren. Seine Gäste hingegen duckten sich, sprangen auf und hetzten zur Toilette oder warfen sich, wenn gar nichts anderes möglich war, zu Boden.
So auch Heinz Franzke. Er ging unter dem Tisch in Deckung, wagte es aber nach ein paar Sekunden, neugierig, wie er war, das lang herabhängende Tischtuch ein wenig anzuheben und zu beobachten, was sich weiterhin abspielte.
Seelenruhig hatte sein Vater in die Schublade gegriffen und ein Bündel Geldscheine hervorgeholt. Der Maskierte riss sie an sich und schien zufrieden zu sein.
Während er so dastand und einen Augenblick brauchte, um die Menge des Geldes abzuschätzen, bemerkte Heinz Franzke, dass der Mann dunkelbraune Sandalen trug und am rechten Fuß ein großes Loch in der beigefarbenen Socke hatte. Genau am großen Zeh. Und der sah komisch aus – dick und unförmig. Ein sogenannter Hammerzeh war das. Eine Cousine seiner Mutter litt schon seit Jahren darunter. Komisch, dass auch Männer so etwas hatten.
Der Räuber ließ seine Beute in einer Aktentasche verschwinden und lief auf die Straße hinaus.
Die Anspannung der Gäste löste sich. Alles schnatterte durcheinander. Einige machten sich an die Verfolgung.
Als würde ihn das alles langweilen, griff Walter Franzke zum Telefonhörer, um die Polizei zu verständigen.
Sein Bruder lief zu ihm hin und bedauerte ihn wegen des gestohlenen Geldes.
»Ach, Richard!« Walter Franzke lachte, als wäre die Szene eben nicht blutiger Ernst gewesen, sondern nur Teil eines Theaterstückes. »Man wird ja öfter mal überfallen, und für diese Anlässe habe ich mir einige gut gemachte Blüten verschafft. Falschgeld kostet ja nicht viel. Und wenn der Mann es ausgeben will, dann …«
Die Kriminalpolizei rückte an und fragte die Gäste, was sie beobachtet hätten. Auch Heinz Franzke kam an die Reihe. Er gab zu Protokoll, dass der Räuber am rechten Fuß einen Hammerzeh hatte.
Aufgrund dieser Angabe konnte der Mann schon am nächsten Vormittag gefasst werden, und ein Kriminalkommissar lobte Heinz Franzke: »Junge, du bist ja der geborene Kripomann, du musst später unbedingt zu uns kommen.«
»Nein, ich werde einmal Staatsanwalt, der steht ja über allen Polizisten.«