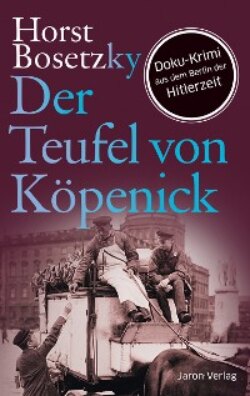Читать книгу Der Teufel von Köpenick - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 8
Vier 1932
ОглавлениеErich und Martha Zeitz hatten das Wochenende in Leipzig verbracht, wo ihre Tochter nach der Hochzeit hingezogen war. Ausgerechnet zu den Kaffee-Sachsen, und wie nicht anders zu erwarten, hatte es am Sonntagabend einen heftigen Streit zwischen ihnen und ihrem Schwiegersohn gegeben. Folglich waren sie nicht noch ein paar Tage länger geblieben, wie sie es eigentlich vorgehabt hatten, schließlich waren sie Rentner, sondern hatten den ersten D-Zug genommen, der am Montagmorgen von Leipzig aus abfuhr.
Der Kalender zeigte den 21. Februar 1932. Draußen war es so kalt, dass die Zugheizung es kaum schaffte, die Wagen ausreichend zu erwärmen. Also stand Martha Zeitz schließlich auf, um sich ihren Mantel anzuziehen.
Ihr Mann verstand das nicht. »Nicht doch, Martha, dann frierst du doch draußen doppelt so schnell. Und außerdem sind wir gleich in Berlin.«
Sie sah aus dem Fenster. »Stimmt, das war ja schon Lichtenrade.«
»Alles öd und leer«, murmelte Erich Zeitz.
Ihre Freude, wieder in der Heimat zu sein, hielt sich in Grenzen. Es waren nicht nur die Minusgrade auf dem Thermometer, die ihnen zu schaffen machten, es war auch die Kälte in den Herzen der Menschen. Man brauchte nur die Zeitung aufzuschlagen, um zu wissen, was los war. Allein in Berlin waren 600 000 Arbeitslose registriert, im ganzen Reich waren es über sechs Millionen. Dazu kamen drei Millionen Kurzarbeiter. Die Länge der Schlangen vor den Arbeitsämtern wurde nicht mehr in Metern, sondern schon in Kilometern angegeben. Und das bei bitterster Kälte. Diebstähle und Plünderungen häuften sich. Im Humboldthain prostituierten sich Arbeiterkinder.
»Gott!«, rief Erich Zeitz und warf seine Zeitung ins Gepäcknetz, »wo soll das alles bloß noch hinführen?«
Seine Frau lachte bitter. »Na, zu den Nazis!«
Viele ihrer Nachbarn gingen in die Kneipen der Nationalsozialisten, um sich dort zu betrinken und dabei von herrlicheren Zeiten zu träumen.
Am Anhalter Bahnhof hätten sie sich gern ein Taxi genommen, denn die beiden Koffer wogen mehr, als für ihre angeknacksten Rücken gut war, doch das Geld dafür hatten sie nicht. Also blieb ihnen nur die Straßenbahn, und mit der Linie 4 kamen sie, ohne umzusteigen, bis zum Hermannplatz. Von dort aus bis zur Friedelstraße 23 mussten sie dann laufen, da half alles nichts.
Sie nahmen die Abkürzung über die Weserstraße und trafen unterwegs auf den Räucherwarenhändler Valentin, der am Kottbusser Damm 24 sein Geschäft hatte und als guter Bekannter gelten konnte.
Ganz aufgeregt war er heute. »Die Kommunisten hetzen gegen mich, dass keiner mehr bei mir kaufen soll.«
»Warum denn das?«, fragte Erich Zeitz.
»Angeblich soll ich einen Erwerbslosen aus einem meiner Häuser in der Lenaustraße rausgeworfen haben, weil der seine Miete nicht bezahlt hat. Das ist aber totaler Quatsch! Der Krause, so heißt er, ist erstens Säufer und randaliert dauernd, und so was kann man nicht länger dulden, und zweitens sind das nicht meine Häuser. Die verwalte ich nur für eine alte Dame.«
Martha Zeitz schloss die Augen. »Wo soll das alles bloß noch hinführen? Dieser Hass überall!«
Sie beteuerten, weiter bei Valentin kaufen zu wollen, zumal der sich bereit erklärte, beim Schleppen ihrer Koffer zu helfen.
»Vorderhaus, dritte Treppe rechts!«, sagte Erich Zeitz.
Da sie mit ihrer Rente nicht mehr auskamen, hatten sie untervermieten müssen. Es war schwer zu ertragen, nur noch in einem Zimmer zu leben und andauernd einen fremden Menschen in der Wohnung zu haben, aber es ging eben nicht anders, und vielleicht, so der gängige Trost, brachten Untermieter ja auch Leben in die Bude und wurden nach einiger Zeit sogar richtige Familienmitglieder.
Sie bedankten sich bei Valentin.
Erich Zeitz machte sich daran, die Wohnung aufzuschließen. Das war ein geradezu hoheitlicher Akt, den er sich nicht nehmen ließ, schließlich war er alter Zollbeamter. Als er den Schlüssel ins Sicherheitsschloss gesteckt hatte und ihn herumdrehen wollte, stutzte er. »Ist ja gar nicht abgeschlossen!«
»Erich, das wirst du beim Wegfahren glatt vergessen haben«, sagte seine Frau. »Und das ausgerechnet du!«
»Unsinn! Ich schließe immer sorgfältig ab. Das wird dieses Flittchen gewesen sein.«
Gemeint war ihre neue Untermieterin, die noch keine Woche bei ihnen wohnte und schon zwei Cousins mit nach Hause gebracht hatte.
Kaum stand Erich Zeitz im Korridor, da klopfte er auch schon an ihre Zimmertür, um sie wegen ihrer Nachlässigkeit zur Rede zu stellen. »Fräulein Rolland, würden Sie bitte mal …«
Doch drinnen rührte sich nichts. Wahrscheinlich schlief die Dame noch. Das tat sie immer, wenn sie keine Arbeit hatte. Klopfte er an ihre Tür, so machte sie auf toten Käfer.
Er lauschte. Nichts. Nun hämmerte er mit der rechten Faust gegen die Tür. Wieder nichts.
»Ist sie doch schon aus dem Haus«, sagte Martha Zeitz.
»Und ohne abzuschließen!« Erich Zeitz konnte sich nur schwer beruhigen. Dazu wurde in letzter Zeit zu viel eingebrochen. Jetzt riss ihm der Geduldsfaden. Mit den Worten »Jetzt komme ich aber!« drückte er die Klinke nach unten. Da die Rolland ihre Tür immer von innen verriegelte, konnte dies nichts anderes sein als eine leere Drohung.
Doch als er etwas energischer gegen die Tür drückte, flog diese geradezu auf.
Was er dann sah, ließ ihn aufschreien – eine Leiche auf dem Fußboden.
Mathilde Rolland lag zwischen Sofa und Tisch. Und zwar auf dem Rücken. Um ihren Hals war der Gürtel eines Kleides zweimal fest herumgeschlungen und verknotet. In ihrem Mund steckte ein Klaviertastenschoner – offenbar als Knebel. Das Kleid war hoch-, der Schlüpfer heruntergezogen.
Heinz Franzke, nun 24 Jahre alt, hatte sich zu einem Menschen mit vielerlei Facetten entwickelt. Er hatte stets vor Augen, was Adolf Hitler gefordert hatte: Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier muss erst wieder aus ihren Augen blitzen.
Auf der anderen Seite aber war er feinnervig und kreativ wie ein jüdischer Intellektueller, obwohl er diese Gruppe hasste wie keine zweite. Dazu kam eine außergewöhnliche formale Intelligenz, die er sich vor allem in den langen Schachpartien gegen seinen Onkel erworben hatte. Hoch aufgeschossen war er und schlank, und seine Gesichtszüge konnte man asketisch nennen. Das lag daran, dass er viel trainiert hatte und auf den Mittelstrecken fast Berliner Meister geworden wäre. Seine Wirkung auf Frauen war groß, und was dieses Thema betraf, da hätte er ebenso, wie es Joseph Goebbels am 15. Juli 1926 getan hatte, in sein Tagebuch schreiben können: Jedes Weib reizt mich bis aufs Blut. Wie ein hungriger Wolf rase ich umher. Und dabei bin ich schüchtern wie ein Kind. Ich verstehe mich manchmal selbst kaum.
Mit der nationalsozialistischen Bewegung war er schnell in Berührung gekommen, denn sein Vater hatte nicht nur eine niedrige Parteinummer, sein Lokal in der Steglitzer Albrechtstraße war auch ein beliebter Treffpunkt von SA und NSDAP geworden. Bald hatte Heinz Franzke beschlossen, im Spiel des Lebens auf diese Karte zu setzen. Ordentliches Mitglied in der NSDAP konnte er allerdings erst mit dem Erlass vom 29. Juli 1932 werden, denn bis zu diesem Zeitpunkt war preußischen Staatsbeamten die Mitgliedschaft in der NSDAP untersagt gewesen.
Nach dem Abitur, abgelegt 1927, hatte er begonnen, Jura zu studieren, war aber des trockenen Tons schnell überdrüssig geworden und hatte beschlossen, in die Berliner Kriminalpolizei einzutreten. Den Volkskörper von verbrecherischen Elementen zu reinigen war für ihn von ungeheurer Wichtigkeit. Ohne Zögern erklärte er, dass ein Mann wie Ernst Gennat für ihn im gesellschaftlichen Gefüge denselben Rang einnähme wie Robert Koch oder Rudolf Virchow. Die einen eliminierten jene Bakterien und Viren, die darauf aus waren, Menschen zu töten, der andere brachte Mörder zur Strecke, Lebewesen also, die schon getötet hatten und nichts anderes verdienten als das berühmte »Kopf ab!«. Auch als eine Art Kammerjäger sah er den Kriminalbeamten, denn beide Berufsgruppen hatten Ungeziefer zu bekämpfen und gegebenenfalls auch auszurotten. Spürte er, dass einem Gesprächspartner dieser Vergleich zu drastisch erschien, dann bezeichnete er sich als Arzt, insbesondere als Chirurg. Abtöten und herausschneiden, was Leben und Gesundheit gefährdet – das sei die Aufgabe eines Kriminalbeamten.
Es war also zu Beginn der dreißiger Jahre ein loderndes Feuer in ihm entfacht worden, und wer weiß, welche Karriere er noch gemacht und welchen Verlauf sein Leben sonst genommen hätte, auch nach 1945, wenn er nicht mit einem Menschen aus einer ganz anderen Ecke der Gesellschaft zusammengetroffen wäre: mit Bruno Lüdke, dem »doofen Bruno«. Aber noch war es nicht so weit. Noch war er Kriminalanwärter, also eine Art Lehrling, und hatte den Kriminalkommissaren Albrecht und Litzenberg bei der Aufklärung des Falles Mathilde Rolland Hilfsdienste zu leisten. Da Litzenberg heimlich Parteigenosse war, konnte sich Franzke von diesem eine besondere Förderung erhoffen. Später jedenfalls. Nach der Machtergreifung.
Nach Ende des Ersten Weltkrieges hatte es eine erhebliche Professionalisierung der Berliner Kriminalpolizei gegeben. So etwa war eine systematische Auswertung von Fingerabdrücken eingeführt worden, man hatte mit ballistischen Untersuchungen begonnen, eine neue Mordinspektion und die weibliche Kriminalpolizei waren geschaffen und im Jahre 1927 ein Institut für Polizeiwissenschaft in Charlottenburg gegründet worden. Schon am 1. Juni 1925 hatte das Landeskriminalamt, das LKA, seine Arbeit aufgenommen.
Die Kripo, im Polizeipräsidium am Alexanderplatz angesiedelt in der Abteilung IV, lehnte es strikt ab, sich mit politischen Angelegenheiten zu befassen, und kooperierte anfangs auch nur widerwillig mit der politischen Polizei, der Abteilung IA, und der Schutzpolizei. Man war eben der Adel.
Die Kriminalkommissare im Morddezernat der Abteilung IV standen in dem Ruf, die besten in Deutschland zu sein. Dies beruhte auf den Leistungen einzelner Beamter wie Ernst Gennat, Ludwig Werneburg, Otto Trettin oder Dr. Erich Anuschat.
Nur wenige jüngere Beamte, die aufsteigen wollten, und einige ältere Beamte, die zu sehr unter ihren Enttäuschungen litten, fanden sich in der nationalsozialistischen Zelle der Kripo zusammen. Ein Mann wie Dr. Rudolf Braschwitz hatte, um sich bei seinen jeweiligen Vorgesetzten beliebt zu machen, erst der DDP, der Deutschen Demokratischen Partei, und der SPD angehört, ehe er 1933 Mitglied der NSDAP wurde. Zu groß war der Einfluss von Ernst Gennat, der zwar ein ziemlich unpolitischer Mensch, aber »demokratisch bis auf die Knochen« war, wie seine Kollegen zu berichten wussten.
Gennats politischer Gegenspieler war der Emporkömmling Otto Busdorf, Sohn eines Dorfbäckers und Polizeispitzel in der Kaiserzeit. Um seine Beförderung zum Kriminalrat voranzutreiben, trat er erst in die SPD ein und näherte sich dann, als dies nicht fruchtete, 1931 der NSDAP mit kleinen Geldspenden.
Die Nationalsozialisten taten alles, um die Berliner Kriminalpolizei zu unterwandern. Einen großen Schritt auf diesem Wege schafften sie im Dezember 1932, als es ihnen bei den Wahlen zum Beamtenausschuss des Polizeipräsidenten gelang, alle sieben Sitze zu erringen, die für die Vertreter der höheren Kriminalbeamten reserviert waren. Die NS-Kandidaten um den Kriminalrat Alfred Mundt sowie die Kommissare Erich Liebermann von Sonnenberg und Arthur Nebe erhielten jeweils etwa 75 Prozent der abgegebenen Stimmen.
Es gab drei wesentliche Gründe für die Berliner Kriminalbeamten, sich der NSDAP anzuschließen oder wenigstens auf sie zu setzen. Zum einen glaubten sie, dass der Weimarer Rechtsstaat sie in ihrer Arbeit behinderte und das neue Regime ihnen mehr Chancen zur Durchsetzung rigoroser Maßnahmen gegen das organisierte Verbrechen geben würde. Zweitens steckten sie, wenn sie Kommissare waren, im Beförderungsstau und konnten kaum damit rechnen, im bestehenden gesellschaftlichen System jemals befördert zu werden. Und drittens gehörte ein erheblicher Teil von ihnen der zwischen 1890 und 1900 geborenen »jungen Frontgeneration« an, die am Weltkrieg beziehungsweise den Aktionen der Freikorps teilgenommen hatte und stramm antirepublikanisch eingestellt war.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 übernahm Erich Liebermann von Sonnenberg die Abteilung IV. Er war es auch, der für die Einführung nationalsozialistischer Methoden sorgte und eine große Säuberungsaktion einleitete. Insbesondere wurden SPD-Mitglieder aus der Abteilung IA auf Posten versetzt, auf denen sie mit Politik nichts zu tun hatten, andererseits wechselten viele Kriminalbeamte, an ihrer Spitze Arthur Nebe, zur Gestapo in die Prinz-Albrecht-Straße. Nebe sollte dann 1935 zur regulären Kriminalpolizei zurückkehren und Chef der gesamten preußischen Kriminalpolizei werden. NS-Anhänger, die nicht in die Gestapo übernommen wurden, entschädigte man durch ansehnliche Beförderungen. Nur Otto Busdorf fiel nicht nach oben.
Rein technokratisch gesehen, verlor die Abteilung IV nach den politischen Ereignissen von 1933 nichts von ihrer Qualität, zumal Ernst Gennat bis zu seinem Tode am 21. August 1939 im Polizeidienst verblieb.
Noch aber, im Februar 1932, wurde Preußen von Otto Braun regiert, einem Sozialdemokraten, und der Berliner Oberbürgermeister hieß Fritz Elsas und war Mitglied der DDP.
Heinz Franzke staunte, wie groß das Zimmer war, das die Rolland gemietet hatte. Das mussten knapp dreißig Quadratmeter sein. Da war sogar Platz für ein Klavier. Die linke Ecke des Zimmers wurde von einem Kachelofen ausgefüllt, bis zum Fenster folgten dann auf dieser Seite des Raumes ein Tisch mit einem Stuhl und ein Paneelsofa, über dem ein üppiger Spiegel angebracht war. Rechts vom Fenster standen das besagte dunkelbraun gebeizte Klavier, ein Bett, ein Kleiderschrank, ein kleiner Schreibtisch und ein Schließkorb. Vervollständigt wurde die Einrichtung von einem Wäscheständer, der links neben der Tür an der Wand zum Korridor aufgebaut war. Neben der Waschschüssel, die mit trübem Seifenwasser gefüllt war, lagen Kamm und Bürsten. Eine Parfümflasche war umgefallen.
»Fällt Ihnen etwas auf?«, fragte Litzenberg.
Franzke musste nicht lange nachdenken. »Ja, das Bett! Das ist völlig unberührt.«
»Im Gegensatz zu dieser Dame hier.« Albrecht zeigte auf die Leiche. »Die wird es nicht mehr sein. Die Wirtsleute sagen, dass sie, kaum war sie eingezogen, schon Herrenbesuch gehabt hat und die Geräusche eindeutig gewesen seien.«
»Was schließen wir daraus?«, fragte Litzenberg den Kriminalanwärter, wobei er gleichzeitig seinen Blick bedeutungsvoll durch das Zimmer schweifen ließ.
Wieder musste Franzke nicht lange nach einer Antwort suchen. »Dass es die Rolland, wenn sie die Miete für das Zimmer aufbringen wollte, für Geld getan hat.«
»Richtig!«, rief Litzenberg. »Und wenn Sie mir jetzt noch den Namen des Täters sagen, verkürzen wir Ihre Anwärterzeit um die Hälfte.«
Franzke lachte. »Nichts leichter als das! Ich tippe mal auf N. N.«
»Treffer! Aus Ihnen kann noch mal was werden, Franzke.«
Mochte es für die altgedienten Kommissare auch Routine sein, Heinz Franzke fand das alles überaus aufregend.
Nach einer Kurtisane oder Hetäre sah die Rolland nicht gerade aus. Ihre Strümpfe waren nicht von verführerischen Strumpfbändern gehalten worden, sondern links von einem dünnen Gummiband und rechts von einem Bindfaden. Auch ihr schwarzblaues Kleid sah ärmlich aus. Die rote Wolljacke, die sie darüber getragen hatte, war abgenutzt und wies Mottenlöcher auf. Am rechten oberen Jackenaufschlag steckte ein Parteiabzeichen der NSDAP.
Einerseits freute das Franzke, andererseits erfüllte es ihn mit ungeheurer Wut. Vielleicht hatte einer von der Rotfront die Rolland erschlagen. Heinz Franzke schwor sich, nicht eher zu ruhen, bis er den Täter gefasst hatte. »Mathilde Rolland, wir rächen dich!«, flüsterte er.
Im offenen Mittelfach des Schreibtisches lagen Sturmabzeichen und ein Wimpel mit Hakenkreuz, wie man ihn an Autos und Fahrrädern anbrachte, sowie die Mitgliedskarte Nummer 637 643, ausgestellt am 16. Oktober 1930 in München.
Sogar München, dachte Franzke, alle Achtung.
Nun wurde all das, was auf dem Schreibtisch herumlag, Stück für Stück unter die Lupe genommen.
»Im Portemonnaie kein Geld«, sagte Litzenberg. »Natürlich, der Freier hat ja auch nicht bezahlt. Dafür zwei Ausweise: einer für die Leihbibliothek, der andere für das Amtsgericht Neukölln.«
»Da soll sie angeblich mal gearbeitet haben«, fügte Albrecht hinzu. »So die Wirtsleute.«
Litzenberg zeigte auf eine Butterstulle, die auf der Schreibtischplatte lag. »Franzke, was sagt uns das?«
»Da sie nicht angebissen ist, muss der Besuch überraschend gekommen sein.«
Der Kriminalkommissar war nicht ganz zufrieden. »Ja, aber was kann es noch bedeuten?«
»Dass sie die Stulle für ihren Besuch geschmiert hat, der aber nicht mehr zum Essen gekommen ist.«
»Sehr schön, Franzke!« Litzenberg roch an der Stulle. »Die teure Butter und keine Margarine, hm!« Er wusste selber nicht so genau, wie das einzuordnen war. »Vielleicht hat sie ihn verwöhnen wollen. Also doch kein Freier, sondern ein Liebhaber. Einer von denen hier vielleicht.« Er zeigte auf die Photographien eines Reichswehrsoldaten und eines anderen jungen Mannes, die neben einer Hindenburg-Büste auf dem Schreibtisch standen.
»Kann es nicht auch sein, dass beide gleichzeitig hier waren?«, fragte Franzke.
Albrecht schüttelte den Kopf. »Dann hätte sie zwei Butterbrote geschmiert.«
Litzenberg lachte. »Der eine hatte keinen Hunger.« Er sah Franzke an. »Wie kommen Sie denn darauf, dass beide hier gewesen sein könnten?«
»Na, weil hier Skatkarten liegen, und das geht nur richtig zu dritt.«
»Sie könnte ja auch mit den Wirtsleuten gespielt haben«, wandte Albrecht ein.
Litzenberg winkte ab. »Die sind doch gleich, nachdem die Rolland einzogen ist, verreist. Sehen wir mal weiter!«
Das taten sie. Sie fanden Notenblätter, die mit handschriftlichen Anmerkungen der Rolland versehen waren und darauf schließen ließen, dass sie selber Klavier gespielt hatte, und einen Stapel Briefe.
»Was haben wir denn da?«, rief Litzenberg, als er einen Aschenbecher aus durchsichtigem Glas entdeckt hatte. »Einen herrlichen Fingerabdruck! Von der Größe her ganz bestimmt der eines Mannes. Na bitte!«
Man machte sich daran, mit den Eheleuten Zeitz zu sprechen und die Nachbarn zu befragen. Zwei von ihnen hatten einen fremden Mann am 21. Februar die Treppe heraufkommen sehen und konnten ihn recht gut beschreiben. Als man ihnen die Photos der beiden Männer zeigte, die bei der Rolland auf dem Schreibtisch standen, schlossen sie aus, dass es einer von denen gewesen war.
Als sie wieder an den Tatort zurückkehrten, sagte ihnen Erich Zeitz, dass ihm inzwischen noch etwas eingefallen sei. »Beim Umzug, da haben dem Fräulein zwei Männer und eine Frau geholfen, und da kann ich mich erinnern, dass die Frau zu einem gesagt hat, als sie das Klavier hochgetragen haben: ›Mehr nach rechts!‹ Daraufhin hat der Mann geantwortet: ›Jeht nich, ick heiße Lincke, ick kann nur nach links.‹«
Das war ein Ansatzpunkt, und als sie die Einwohnerkarteien durchsahen, hatten sie schnell den Mann gefunden, der es sein konnte: Heinz Lincke, ein junger Schlächter aus der Elbestraße. Er kam auch deshalb in Frage, weil Mathilde Rolland vorher ganz in der Nähe, in der Kaiser-Friedrich-Straße, gewohnt hatte.
Litzenberg und Franzke machten sich auf den Weg in die Elbestraße. Genau in der Mitte zwischen dem Neuköllner Schifffahrtskanal und der Sonnenallee fanden sie Lincke in einem Mietshaus. Er wohnte noch bei seinen Eltern und war arbeitslos.
»Det se umjebracht worn is, hab ick schon jehört. Traurig, wa? Woher ick die Hilde kenne? Na, aus de Partei. Erst war ick inne KPD, aba bei die Nappsülzen, da war ja nischt zu holen, dann bin ick in die NSDAP und inne SA. Jetroffen ham wa uns alle in unsam Sturmlokal, Kaiser-Friedrich-Straße 25. Und letzten Sonnabend, da hab ick die Hilde beim Ziehen jeholfen.«
Franzke verstand das nicht. »Beim Ziehen?«
»Beim Umziehn! Da isse ja von hier weg inne Friedelstraße. Die Marianne Intek, det war ihre Freundin, der Bruda von der und icke, wir drei, wir ham ihre Sachen inne Friedelstraße jebracht.«
Litzenberg nickte. »Und Sie waren dem Fräulein Rolland auch sonst sehr verbunden?«
Lincke grinste. »Und wie! Aba ick hab et umsonst bei ihr bekommen. Und inne Friedelstraße ham wa jleich det neue Bett einjeweiht.«
»Und dann sind Sie gegangen?«
»Ja, um viere bin ick weg, ick hatte noch ’n Einsatz. Fragen Se bei uns int Sturmlokal. Außerdem war se um fünf noch mit eenem andern verabredet. Eena, der ma, als wa die Klamotten nach ohm jetragen ham, schon anjequatscht hatte, uff da Treppe.«
Franzke glaubte Lincke. Es gab nicht den geringsten Grund für ihn, die Rolland umzubringen. »Niemand schlachtet das Huhn, das ihm die schönsten Eier legt«, sagte er zu Litzenberg.
»Ganz meine Meinung!«
Sie ließen sich von Lincke eine Beschreibung des Unbekannten geben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, sportliche Figur, mittelblondes langes und glatt nach hinten gekämmtes Haar, längliches Gesicht mit hervorstehenden Wangenknochen, helle Stimme, ein bisschen weiblich. Bekleidet mit einer Joppe und langen dunklen Hosen. In der Hand eine Aktentasche.
Als sich dann herausstellte, dass die Fingerabdrücke auf dem Aschenbecher von Lincke stammten, waren die Ermittler enttäuscht.
Blieb der Hinweis auf die NSDAP. Franzke und Litzenberg behagte es gar nicht, dass der Mörder der Rolland womöglich in ihrem eigenen Milieu zu suchen war, aber Dienst war Dienst, und so kamen sie nicht umhin, im Sturmlokal Kaiser-Friedrich-Straße 25 Nachforschungen anzustellen.
Dort trafen sie auf einen früheren Nachbarn der Rolland, einen gewissen Franz Pitarski, der ihnen erzählte, dass die Ermordete viel für die Partei geschrieben hatte und eine fanatische Anhängerin gewesen war. »Wie ich die Mathilde kennengelernt habe? Durch die Partei, ich bin auch Nationalsozialist und sogar Zellenführer. Da muss ich regelmäßig Parteigenossen aufsuchen und ihnen Nachrichten bringen. Und die Beiträge kassieren. Die Hilde, das war eine intelligente Frau, aus der hätte noch was werden können. Erst war sie beim Amtsgericht Neukölln beschäftigt als Justizangestellte, glaube ich, dann im Wohlfahrtsministerium in der Leipziger Straße.«
»Und warum hat sie da aufgehört?«, wollte Franzke wissen.
»Aufgehört?« Pitarski schüttelte den Kopf. »Sie hat nicht freiwillig aufgehört. Man hat ihr gekündigt!«
»Und warum?«
»Keine Ahnung! Es hieß damals, dass sie in eine Spionagegeschichte verwickelt gewesen sein soll. Als sie in Schöneberg wohnte, hatte sie Polen als Freunde gehabt, und die sollen der Grund dafür gewesen sein, dass sie gefeuert worden ist.«
Litzenberg hakte bei den Behörden nach, konnte aber nichts in Erfahrung bringen, was für sie interessant gewesen wäre. Ganz abwegig schien aber der Gedanke an einen politischen Mord nicht zu sein, denn Lincke und die Geschwister Intek, die der Rolland beim Umzug geholfen hatten, berichteten, dass am Vormittag angeblich ein Onkel bei ihr aufgetaucht sei und sich nachmittags ein jüngerer Mann nach ihr erkundigt habe. Näheres konnten sie aber auch nicht sagen.
Das Gespräch mit Marianne Intek brachte aber in anderer Hinsicht wertvolle Erkenntnisse. Man hatte die Büroangestellte nicht in ihrer Wohnung oder an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht, sondern ins Präsidium vorgeladen.
»Die Hilde, die Mathilde habe ich bei Ziemann kennengelernt, bei Oskar Ziemann in Charlottenburg, da sind wir Kolleginnen gewesen.«
»Und was haben Sie da gemacht?«, fragte Litzenberg, der schon etwas zu ahnen schien.
»Ich war Helferin für Bestrahlung und Höhensonne«, antwortete die Intek.
»Keine Massagen?«, wollte Litzenberg wissen.
Marianne Intek senkte den Kopf. »Doch …«
»Also ganz gewisse Massagen?«
»Ja, aber ich hatte nie Geschlechtsverkehr mit einem Patienten.«
»Und die Rolland?«, fragte Litzenberg.
»Kann sein …«
Franzke hakte nach. »Und kann es auch sein, dass sie Männer, die bei Ziemann waren, zu sich nach Hause bestellt hat?«
»Gott, junger Mann, wir wollen alle überleben!«
Franzke nickte. Ja, es musste eine andere Zeit kommen, ein Drittes Reich, in dem die Menschen wieder Arbeit und eine sichere Zukunft hatten!
Litzenberg zückte seinen Notizblock. »Können Sie denn den jüngeren Mann beschreiben, Fräulein Intek, der sich mit der Rolland treffen wollte?«
»Ja, klar!«
Die Beschreibung, die ihnen Marianne Intek lieferte, deckte sich weithin mit der von Heinz Lincke, so dass sie ein »Mordplakat« drucken und überall in Neukölln und nebenan in SW 29 aushängen konnten. Für Hinweise zur Ergreifung des Mörders wurden eintausend Reichsmark Belohnung ausgesetzt.
Litzenberg und Franzke konnten erst einmal Atem holen und die Ruhepause im Fall Rolland nutzen, um zum Sportpalast zu gehen, wo Joseph Goebbels eine Rede halten sollte. Es hieß, er würde bei dieser Gelegenheit die Kandidatur Adolf Hitlers für das Amt des Reichspräsidenten verkünden.
Noch war es nicht so weit, dass alle Deutschen wussten, was es mit der Vorsehung auf sich hatte, aber wenn Heinz Franzke später auf das zu sprechen kam, was er im Mai 1932 erlebt hatte, kam er ohne sie nicht aus.
In der Kantine des Polizeipräsidiums hatte es eine kleine Feier gegeben, den Tanz in den Mai bei einer gehaltvollen Bowle.
Franzke war ein annehmbarer Tänzer, und bei der Damenwahl stand Fräulein Grützmacher vor ihm, Gisela Grützmacher, und fragte ihn: »Darf ich bitten?«
Das Licht war zum Glück so schummrig, dass niemand sehen konnte, wie sehr er errötete, denn die Stenotypistin, die ein wenig älter war als er, stand in dem Ruf, gerne Männer zu vernaschen, und seine Erfahrungen auf erotischem Gebiet beschränkten sich auf Doktorspiele, harmlose Knutschereien und das, was man umgangssprachlich Handbetrieb nannte. Vor käuflicher Liebe war er stets zurückgeschreckt, denn die stand bei ihm für undeutsche Dekadenz. Außerdem fürchtete er zweierlei: zum einen, sich anzustecken – mit der Gonorrhö oder gar der Syphilis –, und zum anderen, bei einer Razzia im Bordell erwischt und wegen sittlicher Verfehlungen aus dem Dienst entfernt zu werden. Freundinnen hatte er mehrere gehabt, aber nie war es zum Intimverkehr gekommen, höchstens hatte sich sein Samen, nachdem er sich lange an einem Frauenkörper gerieben hatte, in die Unterhose ergossen.
Die Aussicht, von Fräulein Grützmacher noch an diesem Abend verführt zu werden, ließ seinen Blutdruck hochschnellen, erfüllte ihn aber auch mit gehöriger Angst. Wenn er nun versagte und sie das überall herumerzählte, wäre er erledigt gewesen. Es musste also die berühmte Güterabwägung getroffen werden, und da entschied er sich nach längerem innerem Ringen für das erste Mal. Schließlich war er 24 Jahre alt. Allerdings … Vater werden wollte er auf keinen Fall. Aber so erfahren, wie Fräulein Grützmacher war, hatte sie ganz sicher eine Packung Fromms zu Hause.
»Sie sind doch sicherlich Kavalier und bringen mich nach Hause?«, fragte sie, als die Feier gegen zehn Uhr abends zu Ende ging.
»Aber selbstverständlich! Wo wohnen Sie denn?«
Fräulein Grützmacher lachte. »Na, gleich um die Ecke, draußen in Lichterfelde.«
Franzke deutete eine kleine Verbeugung an. »Sie würde ich bis ans Ende der Welt bringen.«
Sie fuhren mit der Straßenbahn bis zum Potsdamer Bahnhof und erwischten dort den letzten Zug nach Wannsee. Im Zug kuschelte sie sich an ihn und ließ sich nach dem Aussteigen in einer dunklen Ecke des Bahnhofs Lichterfelde-West auch küssen, doch als die beiden vor ihrem Wohnhaus am Weddingenweg angekommen waren, kam die kalte Dusche für ihn.
»Nett, dass Sie mich gebracht haben«, sagte Fräulein Grützmacher beim Aufschließen der Haustür.
Er spielte den Mann von Welt und gab sich so wie die Männer in den UFA-Filmen. »Den Dank, edle Dame, begehr ich wohl, und wenn es nur eine Tasse Kaffee bei Ihnen oben ist. Ich brühe ihn auch gern selber.«
Sie warf ihm eine Kusshand zu. »Tut mir leid, aber mein Verlobter wartet oben auf mich. Und es ist seine Wohnung.«
Damit war er also abgeblitzt. Er konnte es nicht begreifen. In der ersten Aufwallung wollte er einen Stein nehmen und ihn in die Scheibe des Zimmers werfen, in dem gerade das Licht anging, aber er konnte sich gerade noch beherrschen. Dann stand er da wie gelähmt. Wie ein begossener Pudel, wie der Ritter von der traurigen Gestalt.
Was blieb ihm also anderes übrig, als nach Hause zu trotten. Die Kommandanten- bis zur Ringstraße und dann den Gardeschützenweg hinauf in Richtung Bahnhof Steglitz. Drei Kilometer mochten es sein, also keine Entfernung, die ihn hätte jammern lassen.
Er blickte in jede Wohnung hinauf, in der noch Licht brannte, in jedes Schlafzimmer, und stellte sich vor, was sich dort gerade anbahnte oder bereits geschah. Alle genossen das, was ihm verwehrt worden war, und er glaubte, Lustschreie zu hören.
Nein … Er blieb stehen. Das eben hatte eher nach einem Hilfeschrei geklungen.
Er war aus der Villa rechts vor ihm gekommen. Eben wurde dort ein Vorhang vorgezogen. Mit einem kräftigen Ruck.
Der Kriminalist in ihm erwachte. Kein Wohnungsinhaber riss derart an einem Vorhang, musste man doch damit rechnen, dass einem die Gardinenstange auf den Kopf fiel oder der Stoff Schaden nahm. So konnte nur ein Fremder handeln, ein Einbrecher. Und wenn das, was er eben gehört hatte, wirklichein Hilfeschrei gewesen war, dann hieß das, dass der Einbrecher vom Wohnungsinhaber überrascht worden war. Jetzt stand er vielleicht mit gezogener Pistole vor ihm, um ihn zu fesseln und zu knebeln. Oder zu erschießen, wenn es zur Gegenwehr kam. Das war das übliche Szenario.
Franzke überlegte. Ehe er die nächste Telefonzelle fände und die Kollegen von der Schutzpolizei alarmieren könnte, verging zu viel Zeit, also musste er selber handeln. Tat er es nicht und geschah in der Zwischenzeit ein Mord, konnte das disziplinarrechtliche Folgen für ihn haben. In jedem Fall aber würde ihm dies die herbe Kritik und den Spott seiner Vorgesetzten und Kollegen einbringen, und das war nicht gut für seine Karriere. Also schlich er sich durch den Vorgarten. Die Eingangstür war nur angelehnt, was ihn in seiner Vermutung bestätigte. Er kam in einen Windfang und dann in die Diele. Im ersten Stock hörte er Stimmen.
Zwei Männer sprachen mit einer jungen Frau.
»Wo ist der Schüssel zum Tresor?«
»Das weiß ich nicht, den hat mein Vater.«
»Raus mit der Sprache, sonst knallt’s!«
Das sagte alles. Franzke überlegte. Wenn er doch nur seine Dienstwaffe bei sich gehabt hätte! Aber so? Allein hätte er gegen zwei Männer, von denen zumindest einer eine Schusswaffe bei sich führte, keine Chance gehabt.
Was tun? Jedes Zögern konnte der jungen Frau das Leben kosten, aber wenn er jetzt nach oben stürzte, starrte er auch nur in den Lauf einer Pistole und hatte die Hände hochzunehmen.
Es blieb ihm nur ein Überraschungscoup.
Er sah eine Steckdose. Nun brauchte er nur noch eine Büroklammer, drei Nägel oder … In der Schale, die auf der Flurgarderobe stand, entdeckte er zwei Haarklammern aus Metall. Mit denen ging es auch. Er verdrillte sie miteinander, bog sie zurecht, fasste das U-förmige Gebilde in der Mitte mit seinem Taschentuch und steckte die beiden Enden in die Dose.
Es gab einen gewaltigen Kurzschluss, und im gesamten Haus erlosch das Licht.
»Hände hoch, Polizei!«, schrie er gleichzeitig. »Die Waffen auf den Boden!«
Der Diplom-Ingenieur Martin Diemitz galt als ein gemachter Mann. Aus der Sicht von Konzernen wie Thyssen, Krupp oder Mannesmann war seine Metallwarenfabrik in der Britzer Gradestraße nur eine kleine Klitsche, aber sie hatte ihm immerhin eine stattliche Villa, ein Wassergrundstück in Wernsdorf, eine Motoryacht und einen kleinen Fuhrpark eingebracht. Daneben aber auch eine wunderbare Frau, seine Isolde, die seinetwegen ihre Karriere als Opernsängerin aufgegeben hatte. Zwei Kinder hatte sie ihm geschenkt, einen Sohn und eine Tochter, ein Pärchen also, was als Idealfall galt. Ingemar hatte Medizin studiert und gab als Chirurg in der Charité zu großen Hoffnungen Anlass, Irmhild ging auf das Konservatorium und wollte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und Opernsängerin werden. Sie war der Augapfel des Vaters, und so hatte dieser nicht gezögert, den Retter seiner Tochter zu einem festlichen Essen einzuladen. Ins Adlon natürlich.
Nach der Suppe hob Diemitz sein Glas, um eine kleine Rede zu halten. »Mein lieber, verehrter junger Freund, lieber Herr Franzke! Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Ihnen von Herzen für die Rettung unserer Tochter und Schwester zu danken. Sie ist unser Ein und Alles. Und wären Sie nicht rechtzeitig erschienen und hätten großen Mut bewiesen, wäre sie womöglich … Ich kann es nicht aussprechen, verzeihen Sie mir. Wie Sie die Verbrecher mit Ihrer List, würdig eines Odysseus, dazu gebracht haben, von Irmhild abzulassen, und einen von ihnen bei der Flucht dann auch noch gepackt und niedergeschlagen haben, verdient unsere höchste Bewunderung. Da nun auch der zweite Einbrecher gefasst ist, können wir wieder in Ruhe das Haus verlassen. Auch unsere Irmhild hat sich von dem Schrecken erholt, heute ist sie nun endlich von ihrer Kur zurück, und wir können nachholen, was lange fällig war: unser Beisammensein hier im Adlon. Ein dreifaches Hoch auf unseren edlen Ritter, auf Herrn Heinz Franzke!«
Das Essen kam, und es entwickelte sich ein sehr anregendes Gespräch.
»Was halten Sie eigentlich von Adolf Hitler?«, fragte Diemitz.
Franzke zögerte mit einer Antwort. »Politische Lieder sind ja immer garstige Lieder, wie der Herr Goethe meint, und der Rehrücken hier ist so wunderbar, dass ich …«
»Wir sind immer deutschnational gewesen«, sagte Diemitz. »Und wenn Hugenberg Hitler unterstützt, dann soll es uns recht sein. Ingemar liebäugelt auch schon mit der NSDAP.«
»Nun gut!« Franzke wollte es wagen, ein Geständnis abzulegen. »So, wie ich aufgewachsen bin, kann es für mich gar keine andere Wahl geben. Ich bin am 1. August in die Partei Adolf Hitlers eingetreten.«
»Gut so, junger Mann!«, rief Diemitz, »denn die Zukunft Deutschlands heißt Adolf Hitler!«
Irmhild Diemitz, die bisher geschwiegen hatte, sah Franzke strahlend an und fragte ihn, ob es ihm denn schon gelungen sei, den Neuköllner Frauenmörder zu fassen.
Er stöhnte. »Nein, leider nicht! Und das Schlimmste ist, die Akte Mathilde Rolland wird bis auf weiteres als ergebnislos geschlossen werden müssen. Das macht mich furchtbar wütend, denn jeder Mann, der einer deutschen Frau so etwas antut, verdient meiner Meinung nach nur eines: die Todesstrafe. Und wenn die Akte zehnmal auf Weisung von oben geschlossen wird, ich werde nicht eher ruhen, bevor ich den Mörder der Mathilde Rolland an den Galgen gebracht habe.«