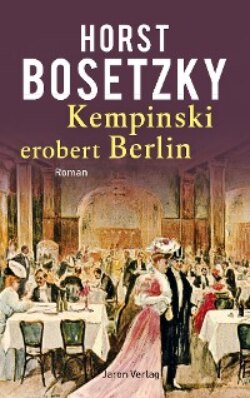Читать книгу Kempinski erobert Berlin - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 8
Kapitel 2 1861
ОглавлениеIm Jahre 1845 hatte König Friedrich Wilhelm IV., der Ostrowo von Besuchen bei seinen Verwandten, den Radziwiłłs in Antonin, gut kannte, der Gemeinde die Gründung eines katholischen Gymnasiums huldvoll genehmigt. Das war eine Sensation, denn die gesamte Provinz Posen konnte nur drei solcher Lehranstalten aufweisen, und lockte in die bisher von Kaufleuten, Beamten und Handwerkern dominierte Stadt eine Schar von hochgebildeten Leuten, die Professoren am Gymnasium wurden, unter ihnen Antoni Bronikowski, der ein bedeutender Hellenist war und Schriften von Platon, Herodot und Thukydides übersetzt hatte, oder Jan Baptysta Piegsa, Mathematiker und Naturwissenschaftler, der 1848 im Frankfurter Parlament gesessen hatte.
Einer der weniger bekannten Professoren war Wilhelm Lagow, 1818 in Breslau geboren und dort auch aufgewachsen. Nach dem Studium an Universität und Lehrerseminar hatte er sich überreden lassen, der besseren Karrierechancen wegen nach Ostrowo zu gehen. Zugleich hatte er gehofft, in der Ruhe einer Kleinstadt mehr Zeit für seine Gedichte und Romane zu haben. Er fühlte sich als Erbe der Zweiten Schlesischen Dichterschule und strebte in seinen Werken nach der Lieblichkeit des Ausdrucks und nach galanter Schreibart.
Deutsch und Latein unterrichtete er, und besonders im ersten Fach schmerzte es ihn, den von Berlin und Posen vorgegebenen Lehrplan einhalten zu müssen. Goethe natürlich. Nicht dass er den hasste, das wäre eine Art Gotteslästerung gewesen, aber es schmerzte ihn schon, dass alles andere in seinem Schatten verkümmerte.
»Bitte schlagen Sie auf: Faust, ab 1335 – Faust: ›Nun gut, wer bist du denn?‹ Dort weiter… Kempinski! «
Schnell hatte der die angegebene Zeile gefunden. »Mephistopheles: Ein Teil von jener Kraft,/Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«
Berthold Kempinski hatte keinerlei Mühe, den Anforderungen des Ostrower Gymnasiums in vollem Maße zu genügen. Ohne Mühe schaffte er es, in allen Fächern zu den besten Schülern zu gehören, und bei entsprechendem Ehrgeiz hätte er es auch zum Primus gebracht, aber im Zweifelsfalle zog er es vor, mit Freunden Karten zu spielen und in einem der nahen Teiche oder im Olobok zu schwimmen, als Vokabeln zu lernen und sich mathematische Formeln einzuprägen.
»Ja, gut.« Professor Lagow sprach nun wieder den Faust: »Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Klodzinski, fahren Sie fort.«
»Mephistopheles: Ich bin der Geist, der stets verneint!/Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,/Ist wert, dass es zugrunde geht.«
Witold Klodzinski, fast gleichaltrig mit ihm, saß in der Klasse rechts neben Berthold Kempinski. Er war Pole und in Ostrowo auf die Welt gekommen. Sein Vater besaß eine Ziegelei und galt als Deutschenhasser, jedenfalls mied er privaten Kontakt mit ihnen und gehörte mehreren Bünden an, die teils offen, teils konspirativ für die Wiederherstellung des polnischen Nationalstaates kämpften. Auch Witold träumte von einem neugeschaffenen Königreich Polen und davon, dass man die Preußen rauswarf aus Posen, nannte aber ungeachtet dessen Berthold Kempinski seinen besten Freund, denn die Juden sah er als eigenes Volk und zählte sie nicht zu den Deutschen. Beide zusammen galten als unschlagbar, denn Berthold war pfiffig und den Klassenkameraden intellektuell weit voraus, während Witold ungemein kräftig gebaut war und so geschickt mit seinen Fäusten umzugehen wusste, dass er es im Zweikampf mit jedem Primaner aufnehmen konnte.
Lagow sah seine Schüler an. »Wie kann man Böses schaffen und dadurch Gutes bewirken, wie soll das angehen?«
Berthold Kempinski meldete sich und bekam das Wort. »Bei uns in Raschkow, der Mord am Regierungsreferendarius von Schecken …«
»Können wir bitte vollständige Sätze bilden!«
»Bei uns in Raschkow hat die Ermordung des Regierungsreferendarius von Schecken dazu geführt, dass die Menschen, die sich vorher spinnefeind waren, in ihrem Abscheu und ihrer Empörung über diese Tat enger zusammengerückt sind, gleichviel, ob nun Deutsche, Polen oder Juden.«
»Sehr gut, Kempinski!« Der Professor vermerkte eine Eins in seinem Notenbüchlein. »Das Verbrechen, das Böse, eint also die aufrechten Gemüter und erinnert zugleich an das Gebot Du sollst nicht töten, bewirkt also auch dadurch Gutes. Da haben wir also ein treffliches Beispiel für Goethes These. Aber wie ist es mit: Denn alles, was entsteht,/Ist wert, dass es zugrunde geht? Wie lässt sich das interpretieren und mit einem Beispiel belegen?«
Mehrere Wortmeldungen erfolgten, er entschied sich für Witold Klodzinski.
Dessen Augen blitzten. »Die preußische Provinz Posen, Herr Professor! Sie ist es wert unterzugehen.«
»Ich verbitte mir das!«, rief Lagow.
Doch Klodzinski war nicht so schnell zum Schweigen zu bringen und konterte mit der nachfolgenden Zeile aus dem Faust: »Steht doch hier: Drum besser wär’s,/dass nichts entstünde.«
Der Pedell schwang die Glocke, um zur Pause zu läuten, und beendete das Gefecht im Klassenzimmer der Unterprima.
Ostrowo sollte erst 1887 Kreisstadt werden, aber bereits im Jahre 1861 war es bedeutender als Adelnau, zu dessen Kreis es offiziell gehörte, denn die meisten Kreisbehörden – so Landrat, Katasteramt, Standesamt und Kreisgericht – hatten ihren Sitz in Ostrowo. Das konnte man in gewisser Weise als Wunder werten, denn 150 Jahre zuvor, genau gesagt, 1711, hatten die Bürger, zumeist Ackerbürger, geplagt von der Pest und großen Bränden, die Annullierung der Stadtrechte beantragt, weil sie sich nicht mehr in der Lage sahen, ihre Steuern zu bezahlen. Aber auch vorher konnte von großer Blüte nicht die Rede sein, denn Ostrowo stand im Schatten der alten, reichen und ziemlich unbeliebten Nachbarstadt Kalisch und war nur eine bessere Karawanserei an der wichtigen Handelsstraße Breslau–Kalisch–Thorn. 1714 erfolgte dann die Neugründung der Stadt durch ihren neuen Eigentümer, Jan Jerzy Przebendowski, den Großschatzmeister von Polen. Mit neu ins Land geholten Siedlern ging es aufwärts. Ein Fünftel der Einwohner waren Deutsche, die 1778 eine Fachwerkkirche errichteten. Nach 1815 gaben sich die Preußen alle Mühe, Ostrowo zu einer Vorzeigestadt zu machen, denn bis nach Kalisch, das schon zu Kongresspolen gehörte, mithin also zum russischen Zarenreich, waren es nur 21 Kilometer. Aus der Ackerbürger- wurde eine Handelsstadt mit preußisch-wilhelminischem Gepräge und sich ansiedelnder Industrie. Tuchwebereien gab es, Ziegeleien, eine Dampf- und eine Schneidemühle. Man glaubte an den Fortschritt und begann gerade mit dem Bau eines Amtsgerichtes mit angeschlossenem Gefängnis. Angedacht waren ein Gaswerk, eine repräsentative Kaserne für das 37. Infanteriebataillon und die 1. Eskadron Ulanen, eine Synagoge, ein Waisenhaus und eine neue katholische Stadtpfarrkirche. Auch um einen Eisenbahnanschluss bemühte man sich, doch es sollte noch bis 1875 dauern, bis die Gleise nach Posen und Kreuzburg befahren werden konnten. Etwa sechzig Prozent der Einwohner waren Polen, dreißig Prozent Deutsche und zehn Prozent Juden.
Raphael Kempinski war es dank seiner vielen Kontakte gelungen, für seinen Sohn ein kleines Zimmer am Ostrowoer Ring zu mieten, von dem aus Berthold einen herrlichen Blick auf Markt und Rathaus hatte. Der hatte sich außerstande erklärt, die zehn Kilometer, die es auf der Landstraße von Raschkow nach Ostrowo waren, jeden Morgen und jeden Abend zu Fuß zurückzulegen, da wäre er ja insgesamt vier Stunden unterwegs. Moritz hatte gemeint, dies sei einem gesunden Mann durchaus zuzumuten und Soldaten marschierten vierzig bis fünfzig Kilometer am Tag, ohne zusammenzubrechen. »Gelobt sei, was hart macht!« Sein Vater hatte zum Glück Mitleid mit Berthold gehabt und überlegt, einen Fuhrmann anzuheuern. Dies wäre aber ungleich teurer gekommen, als das Zimmer bei der Witwe Jastrau zu mieten.
Berthold Kempinski litt einerseits unter der Trennung von seiner Familie, denn die war sein Ein und Alles, andererseits aber war es auch schön, der Knute seines großen Bruders und dem dauernden Geschrei der kleineren Geschwister entkommen zu sein.
Wilhelmine Jastrau, die langsam auf die sechzig zuging, hätte man glattweg für eine englische Gouvernante halten können. Sie kam aber nicht aus Lancester, sondern aus dem ostfriesischen Leer, das zur preußischen Provinz Hannover gehörte. Ihr Vater hatte dort ein gehobenes Hotel betrieben und während der Manöver auch gern die Herren Offiziere beherbergt. So hatte Wilhelmine Jastrau ihren Mann kennengelernt. Leider keinen Mann von Adel, aber immerhin. So groß war die Liebe gewesen, dass sie ihm sogar ans Ende der Welt gefolgt war, nach Posen. Nach seinem Tode war sie der Kinder wegen in der Gegend geblieben.
Gern bekochte sie Berthold, und kam der am frühen Nachmittag aus der Schule, stand schon das Essen auf dem Tisch. Dabei bemühte sich die Offizierswitwe, ein Ambiente zu schaffen, das sie an die Zeiten erinnerte, in denen sie mit ihrem Mann in den ersten Häusern am Platze gespeist hatte.
»Damals in Berlin … ach ja … die zauberhafte Conditorei von Fuchs, wo die hellen Gaslaternen durch Tausende von facettierten Spiegeln ein Lichtermeer ausgießen … das Delicatessenlocal von Dünnwald am Brandenburger Tor, wo man die erlesensten Weine genießen kann …«
»Wie ist es denn in Berlin generell mit den Weinen bestellt?«, fragte Berthold Kempinski, während er sich daranmachte, die erste Scheibe seiner gebratenen Blutwurst auf die Gabel zu spießen. War er am Wochenende in Raschkow, konnte er Moritz mit seinem Wissen ein wenig ärgern.
»Bier ist die Hauptsache, dann kommt der Branntwein und erst an dritter Stelle der Wein. In den großen Delicatessenhandlungen findet man natürlich welchen. Fast jede Weinhandlung hat ihre bestimmten Stammgäste, die dem Charakter der Gegend entsprechen, in der sie liegt. Lutter ist der Sammelplatz der Hofschauspieler, Rähmel sieht großenteils den mittleren Beamtenstand bei sich, der den Aktenstaub hinwegschwemmen muss, Gerold gehört den Aristokraten, für die nur gut ist, was viel kostet, Dedel dem Bonvivant jeder Klasse und Habel dem Geschäftsmann. Als mein Mann in Berlin stationiert war, haben wir Habel bevorzugt, um den großen Devrient leibhaftig vor uns zu haben.«
Durch Wilhelmine Jastrau wurde Berlin für Berthold Kempinski zu einem El Dorado des Savoir-vivre. Obwohl es ihm schwerfiel, stellte er sich vor, ein großer Arzt an der Charité zu sein. Jeden Abend saß er dann bei Dedel und genoss seinen Schoppen.
»Von wem haben Sie denn diesen Tokaji Aszú bezogen?«
»Von Moritz Kempinski.«
»Dann sagen Sie ihm bitte, dass er dieses fürchterliche Bonbonwasser gleich in den Ausguss schütten möge.«
Wie er als Junge zu Hause Gastwirt gespielt hatte, so spielte seine Wirtin jetzt feines Hotel und servierte ihm seine Suppe, sein Hauptgericht und seinen Nachtisch wie einem Kommerzienrat.
»Bei uns zu Hause in Leer haben wir uns immer bemüht, den Gästen das Gefühl zu geben, wir führten eine raffinierte Küche à la française, wie sie in Berlin in den großen Hotels zu finden ist. Die Table d’hôtel bei Meinhardt, im Hôtel St. Petersburg oder im Hôtel du Nord lässt wirklich nichts zu wünschen übrig.«
Berthold Kempinski fand es herrlich, auf diese Weise verwöhnt zu werden. Das Leben liebte ihn, und er liebte das Leben. Nur manchmal kamen kleine Störgefühle auf, so zum Beispiel, wenn Veitel Ungar auftauchte, um mit ihm zu reden. Doch es war unmöglich, diesen einfach abzuweisen, wenn er bei der Witwe Jastrau vorbeikam, um ihn zu einem kleinen Spaziergang abzuholen.
»Der Ewige möge mein Elend sehen und mich erretten.« Wie immer sang der Rabbiner seine Klagelieder. »Dauernd säe ich mit Tränen, aber nie darf ich mit Freuden ernten.«
Berthold Kempinski ärgerte das ewige Jammern über das gottverlassene Posen, das nicht nur bei Ungar, sondern auch bei vielen andern in Raschkow, Adelnau und Ostrowo nie verstummen wollte. Was sollte denn aus der Menschheit werden, wenn alle nach Paris, London und Berlin zogen, dann brach doch alles zusammen! Über den ganzen Erdball mussten sich die Menschen verteilen, wollten sie in Frieden und im Wohlstand leben.
Als er Veitel Ungar dies vortrug, lachte der nur. »Und selber träumst du ständig von Berlin, oder zumindest von Breslau.«
»Träumen ist ja etwas anderes.«
»Im Tagtraum probt man immer Künftiges«, hielt ihm Veitel Ungar entgegen.
Als sie am Ufer des Olobok saßen und er dem Rabbiner erzählte, dass sie in der Schule gerade den Faust durchnahmen, fragte Veitel Ungar mit leicht inquisitorischem Unterton: »Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?«
Berthold Kempinski war es peinlich, darüber zu reden, und um sich mit Anstand aus der Affäre zu ziehen, flüchtete er sich in das, was Goethe gedichtet hatte: »Der Allumfasser,/Der Allerhalter,/Fasst und erhält er nicht/Dich, mich, sich selbst?« Hier wusste er nicht weiter und musste einige Zeilen überspringen. »Nenn es dann, wie du willst,/Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!/Ich habe keinen Namen/Dafür! Gefühl ist alles.«
Bei aller Liberalität, das war eine Antwort, die dem Rabbiner nicht so recht gefallen konnte. »Man merkt, dass ihr keine Synagoge habt bei euch in Raschkow. Ich hoffe nur, ihr habt die Bräuche alle eingehalten?«
»Ja, natürlich«, rief Berthold Kempinski, obwohl dies nur bedingt stimmte. Sie waren als Juden nicht anders als die meisten Christen und ließen, wie Eduard Schlüsselfeld immer sagte, im Allgemeinen den lieben Gott einen guten Mann sein. Pessach, Sukkot, Rosch Haschana, Jom Kippur, die großen Feiertage wurden im Hause Kempinski schon beachtet, ja, aber alles blieb recht oberflächlich.
Veitel Ungar spürte das genau und zitierte aus dem 1. Psalm: »Heil dem Manne, der nicht wandelt im Rate der Frevler, und auf dem Wege der Sünder nicht stehet und im Kreise der Spötter nicht sitzet, sondern an der Lehre des Ewigen seine Lust hat.«
Berthold Kempinski schwieg, denn zum Thema Lust fielen ihm nur der Wein seines Vaters und der Leib Luise Liebenthals ein.
Krojanke biss mit einem so lustvollen Stöhnen in sein Wurstbrot, dass die Leute, die sich in der Nähe seines Standes aufhielten, amüsiert herüberblickten.
»Na, schmeckt’s?«, fragte der Gendarm, der gerade dabei war, einen Stoffhändler wegen seines übergroßen Tisches zurechtzuweisen.
»Ja, danke, Blutwurst ist gesund.«
Warum er das glaubte, verschwieg Krojanke, denn er hatte seine Wurst selbst gemacht – und zwar aus dem Blut und den Innereien eines polnischen Gleisbauarbeiters, der auf dem Weg nach Lissa gewesen war, wo sie mit dem Bau der Eisenbahnstrecke nach Breslau beginnen wollten. Franciszek. Ein wahrer Herkules. Krojanke hatte mit seiner Spitzhacke zweimal zuschlagen müssen, um ihn zu töten. Von hinten auf den Kopf. Aß er von Franciszeks Fleisch, ging dessen Kraft auf ihn über. Er spürte es schon nach dem ersten Bissen.
Der zweite blieb ihm allerdings im Halse stecken, denn vor ihm stand plötzlich der Kommissarius Wilhelm Owieczek. Dass der ihn in ganz Posen jagte, wusste Krojanke schon lange. Sollte es heute so weit sein? Um Zeit zu gewinnen, griff er zur Wasserflasche. »Mit vollem Mund soll man nicht …«
»Ja, trinken Sie mal erst in aller Ruhe«, sagte Owieczek.
Krojanke tat es, wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und schielte auf die Hände des Kriminalen, ob der schon die Handschellen hervorholte. »Womit kann ich dienen, der Herr?«
Jetzt kam der entscheidende Augenblick, und Krojanke überlegte, ob er sich kampflos ergeben oder zu einer der Äxte greifen sollte, die vor ihm ausgebreitet lagen. Owieczek niederschlagen und fliehen. Bis zur russischen Grenze war es nicht weit, und Russland war groß.
»Tja …« Owieczek schien unschlüssig zu sein. »Wie ist Ihr Name?«
»Karl Krojanke aus Obersitzko.«
Owieczek lachte. »Obersitzklo, schöner Ortsname. Sie kommen doch viel herum, Krojanke.«
»Als fliegender Händler muss man viel herumkommen.«
»Sagen Sie, sind Ihnen diese Individuen hier einmal untergekommen?«
Damit holte der Kommissarius einen kleinen Stapel von Steckbriefen hervor und hielt sie ihm hin. Krojanke konnte nicht verhindern, dass seine Finger zitterten, als er die Steckbriefe durchging. Wenn er darunter war, dann … Um Owieczek abzulenken, rief er, dass er einen der Männer ganz genau wiedererkennen würde. »Den hier, denn kenne ich, das ist der Brody aus Czarnikau!«
»Danke!« Erfreut machte sich der Kommissarius Notizen.
»Und die anderen?«
»Nie gesehen.« Erleichtert gab Krojanke die übrigen Steckbriefe zurück. Sein Konterfei war nicht darunter.
»Na, dann …« Owieczek kaufte sich noch eine Nagelschere bei Krojanke, dann ging er weiter, um die anderen Marktleute zu befragen.
»Herrgott, ich danke dir«, murmelte Krojanke. Er konnte aufatmen. Frohgemut rief er denen, die über den Markt bummelten, seine Botschaften zu. »Neue Messer/ schneiden besser! Nach ’ner Weile/ braucht man auch in Ostrowo neue Beile! Nicht so hastig weitereilen,/ kauft erst noch meine Feilen!« Er war mächtig stolz auf seine Reime. »Bäume an den Wegen/ fallen schnell durch meine Sägen!«
Plötzlich verstummte er, denn auf den jungen Mann, der da vor ihm auftauchte, hatte er schon lange gewartet. Krojanke hatte, was seine einmal ausgeguckten Opfer betraf, ein phänomenales Gedächtnis, und so wusste er genau, wer jetzt vor ihm stand, um sich ein Taschenmesser zu kaufen: Das war dieser Berthold Kempinski aus Raschkow. Mit einer Schülermütze, die ihn als Unterprimaner auswies. Er hatte noch keinen Plan, um den jungen Mann in die Falle zu locken, aber irgendetwas würde sich schon finden. Hauptsache, man kam erst einmal ins Gespräch. Und da er die Kunst des Aushorchens meisterhaft beherrschte, hatte er bald herausbekommen, dass der Sohn des Weinhändlers am Sonnabend nach Schulschluss von Ostrowo nach Raschkow laufen wollte. Da war der Plan schnell gemacht: Mit dem Fuhrwerk hinterher, ihn ganz zufällig treffen und fragen, ob er nicht mitfahren wolle. Kein Mensch sagte da nein.
»Proszę mówić nieco wolniej«, sagte Witold Klodzinski so schnell er konnte und lachte dabei schallend.
Berthold Kempinski verzog das Gesicht. »Was ist denn daran so komisch?«
»Weil das heißt: Bitte sprechen Sie etwas langsamer.«
Immer wenn sie mit den Schularbeiten, die sie gern gemeinsam machten, fertig waren, versuchte sich der Freund als Polnischlehrer, denn Berthold fand, dass zumindest Grundkenntnisse in dieser Sprache nützlich waren, wollte man in Posen Geschäfte machen. Sein Vater hatte keine Lust, sie zu erlernen, denn Deutsch, Jiddisch und ein wenig Ungarisch reichten ihm, und sein Bruder Moritz war in dieser Hinsicht mehr als unbegabt. Da machte es sich gut, wenn Polen, die kein Deutsch sprachen, in den Laden kamen und er bei den Kaufverhandlungen zur Hilfe gerufen werden musste.
Witold Klodzinski war mit seiner Prüfung noch nicht am Ende. »Rotwein?«
» Wino czerwone.«
»Sehr gut. Und Weißwein?«
» Wino białe.« Auch das kam wie aus der Pistole geschossen.
»Sehr gut, Kempinski! Man könnte Sie für einen echten Polen halten. Und: Geben Sie mir bitte …«
»Proszę mi dać …«
»Gut.« Witold Klodzinski sah auf die große Standuhr. »Wir sollten gehen, denn mein Vater könnte jeden Augenblick nach Hause kommen.«
Der sah es nicht gern, wenn Deutsche in seine Villa kamen. Um das auch allen klarzumachen, hing im Flur der Spruch: Póki świat światem, Polak Niemcowi nie bedzie bratem. Nur zögernd war er Berthold übersetzt worden: Solange die Welt bestehen wird, wird der Pole niemals des Deutschen Bruder sein.
Seine enge Freundschaft zu Witold Klodzinski war das eine, das andere war Berthold Kempinskis Angst davor, dass sich die Polen in Posen eines Tages so gegen die Deutschen erheben würden, wie sie es 1830 und 1846 nebenan in Kongresspolen gegen die Russen getan hatten. Im ersten Falle, dem sogenannten Novemberaufstand, hatte der Sejm den Zaren für abgesetzt erklärt, und auf den Großfürsten Konstantin war ein Attentat verübt worden. Schlussendlich hatte die russische Armee den Aufstand blutig niedergeschlagen. Sechzehn Jahre später hatten sich polnische Intellektuelle in Krakau gegen die Besatzer erhoben, und die Bauern ringsum waren gegen ihre Grundherren vorgegangen. Wieder hatte die russische Armee eingegriffen, und die vormals freie Stadt Krakau war Österreich zugeschlagen worden.
Witold Klodzinski zeigte Richtung Osten, Richtung Kalisch und Lodz, und senkte die Stimme. »Man flüstert sich zu, dass es drüben bald wieder losgehen wird.«
Berthold Kempinski erschrak. »Und wird es bis zu uns herüberschwappen?«
Das Gesicht des Freundes verdüsterte sich. »Eines Tages wird auch Ostrowo wieder eine Stadt in Polen sein«, lautete die Prophezeiung.
»Das kann mir egal sein, da bin ich schon lange in Breslau.« Berthold Kempinski suchte, die Sache leicht zu nehmen.
»Jedes Volk hat das Recht auf einen eigenen Staat«, sagte Witold Klodzinski.
»Wir Juden haben ja auch keinen«, erwiderte Berthold Kempinski. »Man kann auch so glücklich und in Frieden leben.«
Jetzt wurde der Pole drastisch. »Ja, bis zur nächsten Judenverfolgung.«
»Nicht in Preußen!«, rief Berthold Kempinski.
»Nie was von Zionismus gehört?«, fragte Witold Klodzinski.
»Du meinst: Zynismus?«
»Nein, Zionismus – dass die Juden um Jerusalem herum wieder einen eigenen Staat haben.« Witold Klodzinski hatte von seinem Vater gehört, dass ein gewisser Moses Montefiore, erschüttert von den grausamen Judenverfolgungen im Russischen Reich, Pläne hegte, in Palästina Land von arabischen Großgrundbesitzern zu kaufen und es verfolgten russischen Juden zur Verfügung zu stellen. »Zionismus spielt an auf Zion, den Tempelberg in Jerusalem, und die Erwartung, dass die nach Babylon vertriebenen Juden wieder heimkehren zum Berge Zion.«
Berthold Kempinski interessierte das wenig. »Ich bin Deutscher, ich bin Preuße, und ich will nicht in Jerusalem leben, sondern in Berlin.«
»Ich weiß, als Arzt.«
»Nein. Seit ich damals den Regierungsreferendarius mit seinem eingeschlagenen Schädel gesehen habe …« Berthold Kempinski schüttelte sich. Von Jahr zu Jahr wuchs sich dieser Anblick mehr und mehr zu einem Trauma aus. »Ich glaube nicht, dass ich es im Studium aushalten kann, wenn man Leichen öffnen muss.«
»Was willst du denn sonst nach der Schule machen?«
»Keine Ahnung. Mich treiben lassen. Es geschieht ja doch nur das, was einem vorbestimmt ist.«
Witold Klodzinski staunte. »Ich denke, du bist kein religiöser Mensch?«
Berthold Kempinski zeigte auf eine Zeitung, die am Boden lag. »Siehst du die Ameise, die da über den Leitartikel läuft?«
»Ja, wieso?«
»Die versteht von dessen Inhalt so wenig wie wir vom Sinn des Lebens und unseren Wegen.«
»Damit, Berthold, bleibt dir doch nur eins: im Leben zu scheitern.«
»Dann scheitere ich eben. Lieber fröhlich scheitern, als unfroh etwas Großes werden.« Einen Augenblick zögerte er, dann fügte er noch hinzu: »Am besten wäre es natürlich, man wird etwas im Leben und ist fröhlich dabei.«
Berthold Kempinski war kein großer Marschierer. Ihm reichte es, von der Dachstube in den Weinkeller zu laufen, das war Bewegung genug. Und nun die zehn Kilometer nach Raschkow. Erst kam Radlow, dann Jaskolki, schließlich Przybyslawice, ehe man die Türme von Raschkow erblickte. Immerhin hatte das Ganze den Vorteil, dass er Zeit hatte, um über alles nachzudenken.
Seiner Mutter ging es nicht gut. Sie war eine geborene Liebes und – nomen est omen – hatte etwas ungemein Liebes an sich. Sie war von einer unerschöpflichen Güte und Sorge, was ihre Kinder betraf. Er liebte auch ihren Vornamen, Rosalie, das ließ an eine wunderschöne Rose denken. Nun, leider Gottes war die Rose Rosalie früh am Welken, wie es neulich Dr. Dramburger formuliert hatte. Die vielen Geburten hatten sie früh altern lassen.
Was ihm auch immer wieder durch den Kopf ging, war die Frage, welchen Beruf er denn nun ergreifen sollte, schließlich ging im nächsten Jahr die Schulzeit zu Ende. Nach der Sache mit dem Regierungsreferendarius war er nicht mehr in der Lage, eine Leiche zu sehen, ohne zu kollabieren – wie sollte er da ein Medizinstudium durchstehen können? Nach der ersten Stunde in der Pathologie hätte man ihn aussortiert. Der nächste Wunsch seines Vaters ging in Richtung Jurisprudenz. Aber er hatte eine natürliche Abneigung gegen alle Rechtsverdreher. Und in den Staatsdienst kam er als Jude nicht. Auch in der Armee war er chancenlos, da machte eine Schwalbe, sprich Meno Burg, noch lange keinen Sommer. Außerdem war es für ihn ein schrecklicher Gedanke, auf einem Pferd zu sitzen und mit dem Säbel anderen den Schädel zu spalten oder sie mit einer Kugel zu töten. Nein, nie und nimmer Offizier! Was kam denn noch in Frage? Von Bankier war zu Hause des Öfteren die Rede gewesen. Jude und Geld verleihen, das schien für die Leute eins zu sein, doch er hatte keine besondere Beziehung zum Geld, und der Gedanke, durch Zinsen reich zu werden, erfüllte ihn mit Ekel. Was blieb ihm anderes übrig, als Händler zu werden? Am liebsten Weinhändler, davon verstand er schon ein wenig. Aber er konnte doch seinem Vater keine Konkurrenz machen, und später dessen Geschäft zu übernehmen ging nicht, denn das fiel schon Moritz zu. Und wozu war er der beste Schüler seines Jahrgangs, er musste ganz einfach etwas studieren. Aber was?
Erklärt Euch, eh’ Ihr weiter geht,/Was wählt Ihr für eine Fakultät? Plötzlich hatte er Mephistopheles im Ohr. Und gleichzeitig hörte er auch Professor Lagow, wie der ihn drängte, bei seiner außergewöhnlichen Begabung Geschichte und Philosophie zu studieren. Nachher, vor allen andern Sachen,/Müsst Ihr Euch an die Metaphysik machen!/Da seht, dass Ihr tiefsinnig fasst,/Was in des Menschen Hirn nicht passt … So stand es im Faust, aber das war ja alles nichts als Hohn und Spott und mündete in die eine große Erkenntnis: Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,/Und grün des Lebens goldner Baum.
Was bedeutete, dass es doch am besten war, ein Restaurant aufzumachen. Aber wo und vor allem: womit? Geld hatte er keines, und der Vater hatte auch nicht so viel auf der Bank liegen, dass er ihm den Start finanzieren konnte. Es war alles schier aussichtslos.
Da hörte er ein Fuhrwerk hinter sich. Als er sich umdrehte, erkannte er den Händler, der immer mit seinen Sägen, Beilen, Äxten, Hämmern, Feilen, Scheren und Messern auf den Märkten stand.
Schon hielt Krojanke neben ihm. »Na, wie isses, kann ich dich ’n Stück mitnehmen?«
»Ja, gerne.« Berthold Kempinski schwang sich auf den Kutschbock und war froh, nicht mehr die Landstraße entlanglatschen zu müssen.