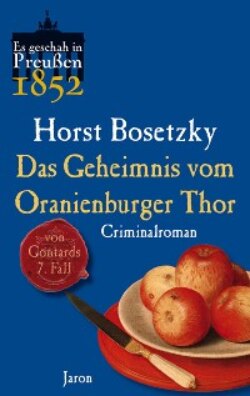Читать книгу Das Geheimnis vom Oranienburger Thor - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 6
Eins
ОглавлениеLucusta ist eine der berühmtesten Giftmischerinnen der Geschichte. Sie lebt im Rom des ersten nachchristlichen Jahrhunderts und hat ein enges Verhältnis zur Kaiserin Agrippina. Für sie mischt Lucusta das Gift, mit dem die Kaiserin ihren Mann und Onkel, den Kaiser Claudius, umbringt. Agrippina möchte den Sohn aus ihrer ersten Ehe an die Macht bringen, einen Mann namens Nero. Allerdings steht diesem Vorhaben Neros Stiefbruder Britannicus im Wege, Sohn des Claudius und der Valeria Messalina. Nero fürchtet, dass Britannicus wegen seiner edlen Herkunft im Volke beliebter sein könnte als er. Außerdem neidet er ihm die klangvollere Stimme. Der Stiefbruder muss also verschwinden! Nero wendet sich an Lucusta, und die lässt sich nicht lange bitten. Aber ihr Gift wirkt nicht, und Britannicus erleidet lediglich eine harmlose Diarrhö. Daraufhin gerät Nero in Rage. Er lässt Lucusta kommen und verprügelt sie eigenhändig. Sie solle ihm sofort ein Gift mischen, das augenblicklich Wirkung zeige. Lucusta macht sich an die Arbeit. Um das Gift zu testen, lässt sie den Sklaven Tiro rufen. Der freut sich über das Pilzgericht, das man für ihn aufgehoben hat – und stirbt auf der Stelle. Jetzt kann Nero seinen Stiefbruder aus dem Weg räumen.
So hatte der Theaterdichter Ernst Raupach sein Stück Die Giftmischerin im Kopf. An diesem Morgen kam er jedoch partout nicht voran, denn er litt unter dem trüben Januar. Wenn er eine besondere Gabe für die Poesie besessen hätte, wäre eine Elegie nach der anderen entstanden.
Vier Jahre waren seit dem Scheitern der großen Revolution vergangen, die Hoffnung auf eine liberale Verfassung wie auch auf einen einigen deutschen Nationalstaat hatte begraben werden müssen. Die politische Reaktion hatte auf ganzer Linie gesiegt. So mancher Bürger schlich bedrückt durch die Straßen, und besonders die geistige Elite Preußens war von einer nie gekannten Lethargie befallen. Selbst nach den Karlsbader Beschlüssen und der Demagogenverfolgung war man reger gewesen. Der verhasste Polizeipräsident Carl Ludwig von Hinckeldey beherrschte die Berliner Gesellschaft mit Hilfe von Spitzeln, Pressezensur, Passkontrollen, Razzien in Wirts- und Vereinshäusern, Verhaftungen von Demokraten und anderen Schikanen. Er schreckte nicht einmal davor zurück, höhere Regierungsbeamte und die Leibgarde des Königs zu überwachen.
Ernst Raupach war im Jahre 1784 in der Nähe von Liegnitz zur Welt gekommen, hatte einige Jahre in Russland verbracht und lebte seit dem Jahre 1824 in Berlin. Ein Reisebericht mit dem Titel Hirsemenzel, das Theaterstück Die Fürsten Chawansky und andere Werke hatten ihm die Gunst des Publikums wie der Kritiker gesichert, und man hatte ihn schon als Nachfolger Friedrich Schillers gehandelt. Nun, daraus mochte nichts geworden sein, aber immerhin schätzte man ihn in Preußen so sehr, dass die Hohenzollern ihm den Rothen Adler-Orden III. Classe verliehen und einen beachtlichen Ehrensold bewilligt hatten. Seine nunmehr 67 Jahre empfand Raupach als Last, aber seit seiner zweiten Eheschließung im Jahre 1848 fühlte er sich doch ein wenig jünger. Seine Ehefrau Amalie Pauline, geborene Werner, hatte sich als Schauspielerin und Schriftstellerin einen gewissen Namen gemacht und war mit ihren 41 Jahren erheblich jünger als er. Und so wollte Raupach an diesem Morgen beim gemeinsamen Frühstück nicht übermäßig klagen, als sie ihn nach seinem Wohlergehen fragte. Doch ganz darauf verzichten mochte er auch nicht. »Ich habe wie immer schlecht geschlafen. Ständiger Harndrang, Nachtschweiß, Rückenschmerzen und schlimme Träume haben mich geplagt.«
»Du Armer!« Amalie Raupach streichelte voller Mitgefühl seine Hände, auf deren Oberfläche sich die Adern immer deutlicher abzeichneten. Eine ironische Bemerkung konnte sich Raupachs Ehefrau jedoch nicht verkneifen. »Bitte erzähle mir stets ausführlich von deinen Leiden! Du weißt, dass ich nach deinem Ableben eine Raupach-Biographie veröffentlichen möchte.«
»Das ist lieb von dir, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das Buch im Himmel käuflich zu erwerben sein wird.«
Kaum hatte das Dienstmädchen den Frühstückstisch abgeräumt und Amalie Raupach sich zum Schreiben zurückgezogen, wurde am Klingelzug gerissen, und Ludwig Rellstab erschien zu einer kleinen Plauderei. Rellstab, geborener Berliner, war ein bedeutender Musikkritiker der Vossischen Zeitung, hatte aber auch schon historische Romane, Novellen, Dramen, Reiseschilderungen und Gedichte veröffentlicht und sich als Buchhändler versucht. In Berlin kannte ihn nahezu jeder, denn zum einen hatte er während der Märzrevolution 1848 den König Friedrich Wilhelm IV. – leider vergeblich – überreden wollen, sich für eine Einigung zwischen Militär und Volk einzuset- zen, und zum anderen hatte er sich musikalische Heroen wie Donizetti, Rossini, Wagner und Meyerbeer durch ätzende Kritiken zu Erzfeinden gemacht und war von ihnen obendrein verklagt worden. Der Komponist und Berliner Generalmusikdirektor Gaspare Spontini hatte es sogar geschafft, Rellstab für sechs Wochen hinter Gitter zu bringen. Da Rellstab großes Geschick darin bewies, Künstler lächerlich zu machen, deren Werke ihm nicht zusagten, war Raupach bei aller Freundschaft immer etwas befangen, wenn der Musikkritiker zu ihm nach Hause kam. Und richtig, kaum war Rellstab eingetreten, hatte er im Bücherregal Raupachs sechzehnteiligen Hohenstaufen-Zyklus entdeckt. »Nun«, fragte Rellstab mit einem maliziösen Lächeln, »jetzt arbeiten Sie an den Folgen siebzehn bis fünfundzwanzig?«
Raupach antwortete ernst: »Nein, denn in diesem Fall müsste ich weit in die Zukunft denken, und wir haben leider kein Orakel in der Stadt.«
»Ich fände es großartig, könnten wir eines erschaffen! Vielleicht könnte man es in den Müggelbergen beheimaten.«
Raupach überhörte das. »Was gibt es Neues in Berlin?«
Rellstab schien diese Frage in gereizte Stimmung zu versetzen. »Alles jammert über die obwaltenden Zustände und den angeblichen Stillstand, aber das ist nicht gerechtfertigt! Industrie und Handel entwickeln sich prächtig. Siemens & Halske sind, was die Telegraphie betrifft, das führende Unternehmen in Europa, und Borsig baut eine Lokomotive nach der anderen.«
»Sehr schön.« Mehr fiel Raupach dazu nicht ein.
»Und woran arbeiten Sie gerade, lieber Raupach?«, fragte Rellstab nun endlich.
»Ich schreibe an einem Stück über eine Giftmischerin aus der Antike«, verriet Raupach.
Rellstab staunte. »Wie sind Sie auf ein solches Thema gekommen?«
»Nicht nur Siemens und Borsig werden in Zukunft Berlins Wirtschaft bestimmen, sondern auch unsere Apotheker. Sie wollen große Fabriken zur Herstellung von Medikamenten erbauen lassen, unterstützt von Chemikern wie diesem Friedlieb Ferdinand Runge aus Oranienburg. In der Literatur werden Apotheker mitunter als zwielichtige Giftmischer dargestellt. So kam mir die Idee zu meinem neuen Stück.«
Rellstab zeigte sich beeindruckt. »Sie erschließen sich also gerade ein neues Feld.«
»In der Tat. Und ich will die Menschen vor Giftmischerinnen und Giftmischern aller Art warnen, obwohl mir hier in Berlin gottlob nichts von Giftmorden bekannt ist. Meine Protagonistin ist die Lucusta, eine Giftmischerin aus dem alten Rom. Ich sehe die Weltgeschichte geradezu als eine Geschichte der Giftmorde.«
Rellstab sah lächelnd zu Raupach hinüber. »Sie müssen sich über die Giftzubereitung in der antiken Welt ausführlich kundig gemacht haben.«
»Davon können Sie ausgehen. Viele Stunden habe ich in den verschiedensten Bibliotheken zugebracht, und ich habe auch einige Forschungsreisende befragt, zum Beispiel Alexander von Humboldt. Als gesichert darf gelten, dass die ersten Gifte, gewonnen aus Kräutern und Pilzen, aus dem Orient nach Europa gekommen sind. An vielen griechischen und hellenischen Höfen soll es gang und gäbe gewesen sein, lästige Konkurrenten zu vergiften.«
Rellstab nickte. »Davon habe ich gehört. Attalos III., der letzte König von Pergamon, soll eigens einen Garten angelegt haben, um Giftpflanzen zu züchten.«
»Bilsenkraut, Nieswurz und Schierling hat er der Überlieferung nach angebaut«, ergänzte Raupach.
»Das erinnert mich an Sokrates!«, rief Rellstab. »Der hat doch den Schierlingsbecher leeren müssen.«
Raupach überlegte. »Dann gab es in der Antike noch Akonit und Dorycnium.«
»Das kenne ich nicht.«
»Akonit ist Eisenhut, und Dorycnium meint nichts anderes als Backenklee. Man gewann im Altertum aber auch Tieren Gifte ab, etwa Schlangen, Kröten und Salamandern. Eine Reihe mineralischer Gifte war ebenfalls bereits entdeckt und ausprobiert worden, etwa Grünspan, Bleiweiß oder Quecksilber, obwohl Letzteres in der Antike auch als Heilmittel Verwendung fand.«
Rellstab hatte Bedenken, was Raupachs Bühnenstück anging. »Wenn die Berliner durch Sie erfahren, was in der Giftmischerei alles möglich ist, kann man nur hoffen, dass Ihre Zuschauer nicht in Versuchung geraten. Ich sehe das Szenario schon vor mir: Eine Frau, die durch Ihre Geschichte auf den Geschmack gekommen ist – die Giftmischerin von Berlin.«
Raupach lachte. »Wozu haben wir unseren trefflichen Gontard? Der würde sie schon in kürzester Zeit überführt haben.«
Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard hatte Weihnachten 1851 und den Jahreswechsel mit seiner Frau Henriette und den beiden herangewachsenen Kindern auf dem Familiengut Wutike verbracht, das etwas abseits in der Prignitz gelegen war. Da entfernte Verwandte ganz in der Nähe lebten, in Wolfshagen und Groß Pankow, hatte man auch in der Einsamkeit genügend Gesellschaft gehabt. Nun ging es zurück nach Berlin, wo Gontard an der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule unterrichtete – noch, hätte man hinzufügen müssen, denn der Oberst-Lieutenant hatte im Jahre 1848 trotz seiner Verpflichtung zur Königstreue auf den Barrikaden gestanden und war dem Polizeipräsidenten von Hinckeldey schon lange ein Dorn im Auge. Doch enge Freunde im Umkreis des Königs hatten sich immer wieder für Gontard eingesetzt. Wie lange würde das noch gutgehen?
Von Hamburg nach Berlin fuhren nur wenige Züge am Tag, und so war es ratsam, pünktlich in Wittenberge zu sein, wo man zusteigen wollte. Gontard trieb die Seinen an: »Beeilt euch bitte! Der Kutscher wartet schon, es ist kalt!«
»Wir sind noch viel zu müde, wir können nicht so schnell!«
Von Wutike nach Wittenberge waren es fast sieben preußische Meilen, also etwa fünfzig Kilometer. Dafür brauchte eine Kutsche mit zwei Pferden rund fünf Stunden, die nötigen Pausen eingerechnet. Wenn sie am späten Nachmittag in Berlin eintreffen wollten, mussten sie in aller Herrgottsfrühe aufbrechen, denn von Wittenberge bis in die preußische Hauptstadt waren es noch einmal über 150 Kilometer. Borsigs Lokomotiven erreichten eine Geschwindigkeit von 35 Kilometern pro Stunde. Endlich saßen alle in der Kutsche, die Gontard im nahen Dorf Gumtow gemietet hatte.
»Hü!« Es ging los. Der Gutsinspector und das Gesinde winkten. Gontard setzte sich nach vorn auf den Bock, um ein wenig mit dem Kutscher zu plaudern. Das sollte er bald bereuen, denn der Mann aus Gumtow war alles andere als gesprächig. Außerdem war es im Fahrtwind so bitterkalt, dass Gontard Angst hatte, ihm würde die Nase abfrieren. Er fragte den Alten, ob die Menschen in der Prignitz über den Ausgang der Revolution enttäuscht seien.
Die Antwort kam nach einem Moment der Stille. »Bloots nich noch rechts un links kieken!«
Gontard musste das erst für sich aus dem Plattdeutschen übersetzen, um es zu verstehen. »Nur keine Veränderung!«
»Jo. Trau kien Oss van vörn, kien Perd van achtern un kein Minsk üm die to!«
Gontard nickte. Der Mann wollte sich einem Fremden gegenüber zu politischen Fragen nicht äußern. Gontard ließ anhalten und setzte sich zu seinen Lieben in die Kutsche. Auch dort war es nicht gerade warm, aber er fror doch nicht mehr ganz so erbärmlich.
Sie kamen durch Perleberg hindurch und grüßten das Roland-Standbild. Schließlich standen sie in Wittenberge auf dem Bahnhof und warteten auf den Zug aus Hamburg.
»Gerade einmal vor sechs Jahren hat die Bahn von Hamburg nach Berlin den Betrieb aufgenommen«, sinnierte Gontard. »Und mir scheint es schon eine Ewigkeit her zu sein, dass wir die Strecke von Wittenberge nach Berlin mit der Postkutsche zurückgelegt haben.«
»Daran siehst du, Vater, dass sich in der Welt doch so einiges ändert«, sagte der siebzehnjährige Ferdinand. »Der Ökonom Friedrich List wird schon recht haben mit seiner Annahme, dass der Eisenbahnbau die Zollschranken in Deutschland überwindet und wir irgendwann doch noch ein einiges Reich bekommen.«
»Das mag vielleicht eintreten, Ferdinand, aber ob die Bürger dann mehr Rechte und Freiheiten haben, sei dahingestellt.«
Henriette verdrehte die Augen. »Ihr immer mit eurer Politik! Denkt an Goethes Worte: Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!«
Luise, fünfzehn Jahre alt, brachte das Gespräch auf Prinzessin Charlotte von Preußen, die vor zwei Jahren den Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen geheiratet hatte. So fröhlich hatte Gontard seine Tochter selten erlebt. »Nach der Hochzeit hat der König dem Ehepaar gestattet, im Nordflügel des Potsdamer Marmorpalais zu wohnen, und von ihrer Mutter hat die Prinzession die Villa Carlotta in Italien übereignet bekommen. Einem Sohn hat Charlotte auch bereits das Leben geschenkt, Bernhard heißt er.«
Ferdinand sah seine Schwester an. »Denkst du etwa, der könnte dich dermaleinst heiraten? Bei dem Altersunterschied halte ich das eher für unwahrscheinlich.«
Unter den Geschwistern entspann sich ein Zank, und es verging eine Weile, ehe Luise erzählen konnte, warum sie Charlotte von Preußen so überaus schätzte. »Sie ist ungeheuer musikalisch, und sie komponiert sogar selbst.«
»Da kommt der Zug!«, rief Ferdinand, der in Richtung Nordwest eine hoch in den Himmel steigende Rauchfahne entdeckt hatte.
Gontard war es zwar gelungen, Billetts für die erste Klasse zu erwerben, sie mussten das Abteil aber mit zwei Fremden teilen, was die familiäre Konversation erheblich erschwerte. Doch sie hatten Glück, denn der Herr am Fenster, der nicht viel älter als dreißig Jahre alt sein mochte, stellte sich als Eduard Titz vor. »Architekt und Baumeister aus Böhmen.«
»Angenehm!« Gontard stand auf und verbeugte sich. »Natürlich wissen wir, welch berühmte Persönlichkeit Sie sind. Spätestens, seit das Friedrich-Wilhelm-Städtische Theater vor zwei Jahren eröffnet worden ist, kennt in Berlin nahezu jeder Ihren Namen.« Gontard machte auch seine Frau und seine Kinder mit Eduard Titz bekannt, dann fragte er den Architekten, mit welchen Aufträgen er derzeit beschäftigt sei.
»Einen Bebauungsplan für Köpenick soll ich erarbeiten, vor allem aber hält mich gerade Krolls Etablissement auf Trab.« Das war im vergangenen Jahr völlig abgebrannt, und Titz war der Wiederaufbau übertragen worden.
»Für diese Arbeit sollte man Ihnen zum nächsten runden Geburtstag den Rothen Adler-Orden verleihen«, fand Henriette.
Titz lachte. »Ich kann mir nicht einmal sicher sein, wann mein nächster runder Geburtstag ist. Niemand weiß genau, in welchem Jahr ich auf die Welt gekommen bin, vom Tag ganz zu schweigen. Es muss 1819 oder 1820 gewesen sein.«
Henriette lachte. »Es heißt doch immer, man sei so alt, wie man sich fühle.«
»Wenn ich danach ginge, wäre ich erst sieben Jahre alt und säße im Sandkasten, um Pyramiden, Burgen und Schlösser zu bauen, wobei …« Er brach ab, denn der Zug bremste so abrupt, dass alle nach vorne gerissen wurden und beinahe von ihren Sitzen fielen.
»Wahrscheinlich stand eine Kuh auf den Schienen«, vermutete Luise, nachdem der erste Schreck vorüber war.
»Nein, bestimmt ist die Lok entgleist!«, rief Ferdinand. »Wir werden bis Berlin alle schieben müssen.« Dann gab er Geschichten über die schrecklichsten Unfälle zum Besten, die es in aller Welt gegeben hatte, seit Dampfrösser über die Schienen glitten. Ferdinand wollte einmal Ingenieur werden und zu Borsig oder einer der Eisenbahngesellschaften gehen und war der Ansicht, dass man aus Katastrophen viel lernen könne. »Das erste Todesopfer hatte man schon am 15. September 1830 in England zu beklagen, in Newton-le-Willows. Am Eröffnungstag der Liverpool and Manchester Railway hat die legendäre Rocket einen Mann überfahren und tödlich verletzt. Acht Tote und achtzehn Schwerverletzte hat es am 24. Dezember 1841 gegeben, wiederum in England, als bei Sonnig eine Zugfahrt durch einen Erdrutsch jäh gestoppt wurde. Das ist aber nichts gegen das Unglück, das sich am 8. Mai 1842 in der Nähe von Versailles ereignet hat: Der Personenzug nach Paris ist nach einem Achsbruch an der Vorspannmaschine entgleist, fünfzig Menschen sind verbrannt, unzählige wurden verletzt.«
In diesem Augenblick meldete sich die Dame zu Wort, die bis eben schweigend und mit geschlossenen Augen Eduard Titz gegenüber am Fenster gesessen hatte. »Hören Sie endlich mit Ihren scheußlichen Geschichten auf, junger Mann, sonst ziehe ich mein Terzerol aus der Tasche und zwinge Sie zum Verlassen des Zuges! Ich halte das nicht mehr aus!«
So, wie sich die Dame präsentierte, vermutete Gontard, dass es sich um eine Schauspielerin handelte. Um ihr zu schmeicheln und um sie zu beruhigen, fragte er, ob sie in Berlin nicht kürzlich auf der Bühne gestanden habe.
»Ihre Frage ehrt mich, aber den Traum von einer Laufbahn als Schauspielerin habe ich schon lange aufgegeben. Vor acht Jahren habe ich zwar einen Ruf ans Berliner Hoftheater erhalten, um dort – als Sängerin wie als Schauspielerin – die Nachfolge von Amalie Wolff-Malcomi anzutreten, wegen meiner familiären Pflichten habe ich aber abgelehnt und mich ganz der Ausbildung meiner drei Töchter gewidmet, die alle auf die Bühne wollen.«
»Dann sind Sie Henriette Schramm-Graham!«, entfuhr es Gontards Frau.
»So ist es.«
Damit war die Stimmung im Abteil wiederhergestellt, und der Rest der Fahrt verging wie im Flug. Im Nu waren die Zwischenstationen Wilsnack, Glöwen, Friesack, Paulinenaue und Nauen passiert. Als sie in Spandau hielten, zog Gontard seine Taschenuhr hervor. »Paul Quappe wird bestimmt schon am Hamburger Bahnhof stehen, um uns in Empfang zu nehmen.«
Doch als sie dort ankamen, war Gontards Bursche, den man in Berlin zurückgelassen hatte, um das Haus in der Dorotheenstraße zu bewachen, nirgends zu entdecken.
»Hat der uns doch glattweg vergessen!«, schimpfte Gontard. »Der Kerl hat wirklich nur Flausen im Kopf. Wahrscheinlich hockt er wieder bei seinem Vater in Schönschornstein.«
Zum Glück gab es genügend Dienstmänner, die Koffer und Taschen der Gontards zu einer der bereitstehenden Droschken schaffen konnten. Der Heimweg führte sie zuerst ein Stück die Invalidenstraße entlang, dann bogen sie rechts am Neuen Thor in die Luisenstraße ab und fuhren auf ihr bis zum Karlplatz, um dann auf der Karl- die Friedrichstraße zu erreichen. Zur Dorotheenstraße war es nun nicht mehr weit.
Es wäre Paul Quappes Pflicht gewesen, wenigstens jetzt vor der Haustür zu stehen und auf die Familie zu warten, aber er war nicht zu sehen. Das neue Dienstmädchen würde erst morgen Vormittag in Berlin eintreffen, mit ihm war ohnehin nicht zu rechnen gewesen.
Der Kutscher stapelte all das Gepäck auf dem Bürgersteig, wurde entlohnt und eilte von dannen. Gontard bummerte gegen die Haustür und rief nach Quappe, doch nichts geschah. »Warte, Bursche!«, brummte Gontard, so gutmütig er sonst auch war. »Dafür gehörst du für eine Nacht in die Hausvogtei.«
Was blieb ihm, als selbst aufzuschließen? Doch als er den Haustürschlüssel herumdrehen wollte, merkte er, dass gar nicht abgeschlossen war. Auch das noch! Er stieß die Tür auf – und fuhr zurück. Vor ihm auf dem Boden lag Paul Quappe in einer Blutlache.
Dr. Friedrich Kußmaul war Gontards ältester und bester Freund und erwartete diesen schon fast sehnsüchtig aus Wutike zurück. Gern hätte er die Familie vom Hamburger Bahnhof abgeholt, aber seine Praxis war am 2. Januar, der auf einen Freitag fiel, so voll von Patienten, dass einige von ihnen im Treppenhaus platziert werden mussten. Die meisten hatten Probleme mit Magen, Darm und Galle, denn an den Weihnachtsfeiertagen hatte man zu fett gegessen und zu Silvester zu viel getrunken.
Kaum hatte Kußmaul den letzten Kranken versorgt, sagte er seiner Frau für ein Stündchen adieu und machte sich auf den Weg zu Gontard. Er hätte eine Droschke nehmen können, aber er wusste, wie gut ihm gerade nach diesen anstrengenden Stunden in der Praxis ein wenig Bewegung tun würde. Außerdem mochte er es, die Leipziger Straße entlangzugehen, gab es dort doch immer etwas zu entdecken, und man traf bisweilen auf Mitbürger, die in der Stadt eine gewisse Reputation genossen. So war Adolf Glaßbrenner hier zur Welt gekommen, und im Haus No. 3 hatte die Familie Abraham Mendelssohn Bartholdy schon seit einem Vierteljahrhundert ihren Wohnsitz. Auch die Friedrichstraße konnte mit einigen berühmten Anwohnern glänzen, zum Beispiel Alexander von Humboldt. Von Napoleon Bonaparte hieß es, er habe 1806 mit drei Begleitern im Haus der Madame Bernhard eine vergnügliche Nacht verbracht.
»Gehe ich durch die Berliner Straßen, so ist es, als würde ich in einem selbstgeschriebenen Roman lesen«, behauptete Kußmaul immer wieder, um zu verdeutlichen, dass er die preußische Residenzstadt kannte wie seine Westentasche.
Als er am Haus seines Freundes in der Dorotheenstraße angekommen war, trat Criminal-Commissarius Waldemar Werpel gerade aus der Haustür heraus und winkte ihm zu. »Gut, dass Sie kommen, Herr Doktor! Gontards Bursche wurde umgebracht.«
Kußmaul stürmte in den Hausflur und drängte alle beiseite, die sich um Quappe versammelt hatten. Henriette von Gontard wischte dem Burschen gerade das Blut von der Stirn. Der Doktor kniete sich daneben, zog einen kleinen Taschenspiegel hervor und hielt ihn Quappe vor den Mund. Dann fühlte er den Puls.
»Der lebt noch«, stellte Kußmaul schließlich fest. »Er muss einen Schlag auf den Kopf bekommen haben und ohnmächtig geworden sein. Legt ihn auf das Sofa! Wenn ich seine Wunde säubere und nähe, wird er schon wieder zu sich kommen.«
So geschah es, und Paul Quappe konnte nach einiger Zeit berichten, dass er bei der Rückkehr vom Schneider einen Einbrecher überrascht habe und von diesem mit einer Keule niedergeschlagen worden sei.
Charles Corduans Vorfahren gehörten zu den zwanzigtausend Hugenotten, die nach dem Edikt von Potsdam, das der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg am 29. Oktober 1685 erlassen hatte, nach Brandenburg-Preußen gekommen waren. Sie hatten einige Schwierigkeiten gehabt, in Berlin Fuß zu fassen, denn Hof, Adel und die geistige Elite hatten die Hugenotten zwar freudig begrüßt, galt doch das Französische als Maß der Hochkultur, die einfachen Berliner aber hatten sie abgelehnt. Sie verstanden die Sprache der Hugenotten nicht, und die Franzosen waren ihnen zu wesensfremd. Die Nachkommen der Einwanderer wurden jedoch inzwischen akzeptiert, und in vielen Berufen waren die französischstämmigen Berliner sehr erfolgreich, insbesondere im Textilgewerbe sowie bei den Confituries, Pâtissiers und Cafetiers.
Corduan war Kürschner und hatte sein Geschäft in der Jägerstraße, unweit der Friedrichstraße. Seine Frau war vor Jahren gestorben. Nun besorgte ihm eine Magd, Susanna, den Haushalt. Außerdem war seine Nichte Caroline zur Stelle, wenn dringend etwas erledigt werden musste. Zwei Gesellen halfen ihm bei der Arbeit.
Der eine war gerade dabei, Galonleder mit dem Kürschnermesser zuzuschneiden, der andere hatte den Grotzenstecher in die Hand genommen, um die Fellmitte, den Grotzen, anzuzeichnen, als Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard in den Laden trat. Charles Corduan selbst war so darin vertieft, ein Fell auf eine hölzerne Unterlage zu nageln, dass er ihn gar nicht bemerkte.
»Bonsoir, Maître, ne vous laissez pas interférer avec le travail!«, sagte Gontard, um auf sich aufmerksam zu machen.
Der Kürschnermeister konnte das Gesagte zwar verstehen, sprach aber selbst kaum noch Französisch, so dass er Gontard auf Deutsch antwortete. »Von Ihnen lasse ich mich gern bei der Arbeit stören, denn Sie sind bestimmt gekommen, um sich einen neuen Pelz zu kaufen.«
»Es hat sich wohl schon herumgesprochen, dass bei mir eingebrochen wurde und man mir einiges gestohlen hat, darunter auch meinen Pelzmantel.« Gontard lachte. »Dann waren Sie das also, damit Ihr Umsatz ordentlich in die Höhe schnellt.«
»Sie haben mich ertappt! Aber das eigentlich Empörende ist, dass ich Ihnen jetzt Ihren Pelz als angeblich nagelneues Stück zum zweiten Mal verkaufe.«
Gontard wurde ernst. »Was können Sie mir empfehlen?«, fragte er.
»Grundsätzlich würde ich zu einem Tier raten, das vollständig oder zumindest zeitweilig im Wasser lebt, weil dann das Fell besonders üppig und strapazierfähig ist. Ferner gilt, dass der Pelz umso dichter und seidiger wird, je kälter der Lebensraum des Tieres ist. Mit Winterfellen liegen sie immer richtig.«
Gontard lachte. »Mit einem Eisbärenfell durch Berlin zu laufen, fände ich für meine Reputation nicht eben förderlich.«
»Dann dürften auch Maulwurf, Nasenbär oder Waschbär für Sie nicht in Frage kommen.«
»So ist es.«
Charles Corduan zeigte auf einige fertige Exemplare. »Hier haben wir einen Mantel aus russischem Desmanfell.«
»Was ist ein Desman?«, wollte Gontard wissen.
»Ein Tier, so groß wie ein Hamster.«
»Nein danke.«
»Aber dies wäre etwas für Sie, Herr von Gontard: ein Stück, fein und seidig, genäht aus Fellen von Edelmardern. Bewundern Sie mit mir dieses glänzende Braun mit seinen Übergängen zu Nuss und Kastanie!«
Wieder winkte Gontard ab. »Das wäre eher etwas für meine Frau.«
Charles Corduan war ein geschickter Verkäufer und wusste sich zu steigern. »Wie wäre es mit dem herrlichen Fell eines Kodiakbären?«
»Wunderbar!« Gontard war begeistert. »Das wird mein neuer Pelzmantel. Fangen Sie bitte sofort damit an! Ich lasse ihn mir auch einiges kosten.«
Corduan verbeugte sich. »Sehr gern.«
Ernst Curtius hatte sich als Hauslehrer des Prinzen Friedrich Wilhelm, des späteren Kaisers Friedrich III., und als außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität einen Namen gemacht. Am 10. Januar 1852, einem Sonnabend, wollte er in der Sing-Akademie einen Vortrag über das antike Olympia halten. Gontard und Kußmaul saßen in der Dorotheenstraße beisammen und überlegten, ob sie sich den Beitrag anhören sollten.
»Eigentlich hatte ich Henriette versprochen, mit ihr Schach zu spielen«, sagte Gontard.
»Und ich wollte mit meiner Frau ins Konzert gehen«, fügte Kußmaul hinzu. »Aber Olympia ist ein wichtiges Thema. Stell dir vor, wir bekommen die Olympischen Spiele der Antike zurück und unsere Jugend übt fleißig, um den Lorbeerkranz des Siegers zu erringen. Du weißt, was das für Preußen bedeuten könnte?«
»Ja, wir würden an die Ideen unseres Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn anknüpfen, und die Menschen würden fleißig ihren Leib trainieren.«
»Genau. Ich hätte weniger Kranke in der Praxis, und du verfügtest über Soldaten, die in zukünftigen Kriegen – und es sind etliche zu erwarten – mit mehr Ausdauer kämpfen könnten.«
»Was schließen wir daraus? Es sei mit der Diskussion nun Schluss, / auf zu Herrn Curtius! So würde dessen Freund Emanuel Geibel bestimmt reimen.«
»Gut. Auch der König soll zugegen sein.«
Die Sing-Akademie hatte seit 1827 ein eigenes Konzertgebäude am Festungsgraben, so dass sie es von der Dorotheenstraße aus nicht weit hatten. Als Gontard und Kußmaul ins Foyer traten, kam ihnen der Theaterdichter Ernst Raupach mit seiner Frau entgegen. Gontard erschrak, denn der Schöpfer des Hohenstaufen-Zyklus sah ziemlich elend aus und hustete so sehr, dass die Umstehenden zurückwichen.
»Die Lunge«, erklärte Raupach, als sie sich begrüßt hatten.
»Wenn er doch nur meinem Rat folgen und sich schonen würde!«, seufzte seine Frau. »Tag und Nacht sitzt er an seinem neuen Stück. Es heißt Die Giftmischerin.«
Gontard ging durch den Kopf, dass er selbst auch gerne ein Stück schreiben würde, eines über den Polizeipräsidenten von Hinckeldey. Ein Giftmord käme darin wohl auch vor … Er behielt diesen Gedanken lieber für sich.
Da erschien der König mit seiner Entourage. Die Anwesenden brachen in Jubel aus. Friedrich Wilhelm IV. hatte für alle, die ihm persönlich bekannt waren, ein Lächeln übrig. Auch für Gontard, obwohl sein Blick zu sagen schien: Ich weiß genau, dass du auf den Barrikaden gestanden hast – die Abrechnung folgt!
Gontard trug es mit Fassung. Vielleicht hatte er es sich auch nur eingebildet. Ihm blieb immer noch die Möglichkeit, nach Österreich oder nach Russland zu gehen.
Kußmaul und er warteten, bis der König den Saal betreten und sich in der Ehrenloge niedergelassen hatte, dann begaben sie sich auf die ihnen zugewiesenen Plätze.
Pünktlich trat Ernst Curtius ans Podium. Er war ein sehr ansehnlicher Mann, weshalb Gontard nicht ganz verstehen konnte, warum er eine Witwe geheiratet hatte. Als hätte sich keine Jungfrau für ihn gefunden! Nun gut, er ging auf die vierzig zu, und die besagte Witwe war vorher mit dem Buchhändler Wilhelm Besser verehelicht gewesen, was auf ein gewisses geistiges Niveau schließen ließ.
»Was wissen wir über die Olympischen Spiele der Antike?«, begann Ernst Curtius, nachdem er alle Gäste, allen voran natürlich Seine Majestät, gebührend begrüßt hatte. »Sie nahmen vermutlich um 880 vor Christi Geburt ihren Anfang und fanden bis in das vierte nachchristliche Jahrhundert alle vier Jahre in der Landschaft Elis auf dem Peloponnes statt. Der Anlass für die Austragung der Wettkämpfe kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um kultische Feste, die zu Ehren einer Gottheit, möglicherweise Herakles, abgehalten wurden. Andere Deutungen gehen davon aus, dass der König Pelops sie als Wiedergutmachung ins Leben rief, nachdem er bei einem Wagenrennen den König Oinomaos durch Betrug besiegt und anschließend getötet hatte. Weitere Forschung ist vonnöten. Unser Wissen um die Art der Wettkämpfe ist ebenfalls nicht umfassend. Zuerst soll es nur einen Wettlauf über eine Stadionlänge gegeben haben, dann sind Wagenrennen und Disziplinen wie Weitsprung, Gymnastik, Ringen, Boxen und Pankration, eine Mischung aus Ringen und Boxen, dazugekommen. Etwa 1300 Jahre später, so nehmen wir an, erlosch das olympische Feuer erst einmal. Kriege unter den griechischen Stämmen mögen ein Grund dafür gewesen sein, auch eine zunehmende Unlust am Treiben der Athleten oder Geldmangel sind vorstellbar. Genaueres wissen wir bis heute nicht. Fest steht nur, dass der Tempel des Zeus, an dem die Spiele stets mit einem Schwur der Sportler begannen, im sechsten Jahrhundert nach Christi Geburt durch schwere Erdbeben zerstört wurde. Meterdicke Schlamm- und Schuttschichten liegen seitdem über den olympischen Wettkampfstätten. Der englische Archäologe Richard Chandler war es, der im 18. Jahrhundert die Erinnerung an Olympia im Rahmen seiner Griechenlandreisen wachgerufen und den Ort recht eigentlich neu entdeckt hat. Hier sollte Preußen anknüpfen, denn mit Ausgrabungen in Olympia hätten wir die einmalige Gelegenheit, eine kulturelle Großtat zu begehen, für die uns die zivilisierte Welt dankbar umarmen wird. Zugegeben, ein solches Vorhaben würde viele hundert Millionen preußische Reichsthaler verschlingen, aber es wäre die Sache wert.«
»Das Geld sollte man lieber in unsere Schulen und Universitäten stecken«, brummte Raupach.
»Die Griechen würden mit Sicherheit darauf bestehen, das Eigentumsrecht an den Fundstücken aus Olympia zu behalten«, fuhr Curtius fort. »Aber wenn Preußen alle Kosten des Projekts übernähme, dann würden wir das Recht fordern, von allen ausgegrabenen Gegenständen Kopien herstellen zu dürfen. Die könnten wir dann hier in Berlin präsentieren.«
Kußmaul kommentierte ironisch: »Welch Entzücken, einen Lorbeerkranz zu bestaunen, der einem Dioxipoppulus einst über den Kopf gestülpt wurde!«
»Kulturbanause!«, zischte Gontard. »Nichts wäre für die körperliche Ertüchtigung unserer jungen Soldaten besser geeignet als das Pankration.«
»Damit sie die Kraft haben, eure Geschütze aus dem Morast zu ziehen.«
Als sie nach dem Vortrag auf die Straße traten, fror Gontard in seinem dünnen Militärmantel erbärmlich und dachte sofort an seinen Kürschner. »Hoffentlich hat Corduan meinen neuen Pelz bald fertiggenäht!«
Charles Corduan gab sich alle Mühe, Gontards Ansprüchen gerecht zu werden. Es ging schon auf Mitternacht zu, und die Gesellen hatten sich längst in ihre Schlafkammern zurückgezogen, da saß er noch immer in der Werkstatt und beugte sich über das gute Stück. Aber irgendwann begannen seine Hände zu zittern und seine Augen zu tränen, so dass er für diesen Tag aufgeben musste. Doch ins Bett gehen mochte er noch nicht, denn ihn begann ein plötzlicher Heißhunger zu plagen. So eilte er über den Flur zur Kammer seiner Dienstmagd und klopfte an die Tür. »Susanna, Pardon, aber ich möchte gern noch nachtmahlen.« Den Ausdruck hatte er von österreichischen Freunden.
»Wat denn, mitten in die Nacht möchten Sie noch mahlen? Mehl – oder wat?«, kam es von drinnen.
»Ich möchte etwas essen«, erklärte ihr Charles Corduan. »Ein kleines Nachtmahl zu mir nehmen.«
»Die Küche is schon kalt.«
»Ach was!«, entgegnete der Kürschner. »Etwas Glut ist immer im Herd. Es wird dir doch wohl glücken, mir schnell eine Bohnensuppe zuzubereiten!«
»Na jut, wenn et unbedingt sein muss. Et is ooch noch von dem Bohneneintopp von neulich wat übrich.«
»Gut, dann wärme den bitte auf und bringe ihn mir auf die Stube!«
Seit Corduan seine Frau begraben hatte, waren in dem Zimmer das Sofa und die Stühle unter Schonbezügen verschwunden. Am Ende des langen Esstisches hatte er sich ein Sitzmöbel aus der Werkstatt hingestellt, auf dem er ab und an Platz nahm, um sich vorzustellen, Eugenie sei noch an seiner Seite und speise gemeinsam mit ihm.
Endlich kam Susanna mit dem aufgewärmten Eintopf. Charles Corduan schaufelte ihn in sich hinein, obwohl er heute etwas seltsam schmeckte. Als Corduan sich satt gegessen hatte, ging er schlafen. Nach zwei Stunden aber wachte er auf, weil ihn starke Leibschmerzen plagten. Als ihm auch noch übel wurde, zog er sich an und eilte auf den Hof hinaus, wo sich der Abort befand. Er erbrach sich, und sein Durchfall wollte kein Ende mehr nehmen. Wadenkrämpfe kamen hinzu. Corduan lief zurück ins Haus, um auf der Diele zusammenzubrechen. Er wollte sich noch an der Garderobe festhalten, riss sie aber im Stürzen mit sich.
Der Lärm weckte Susanna. Als diese ihren Dienstherrn bewusstlos in der Diele vorfand, rief sie nach den Gesellen. »Los, lauft nach einem Doktor!«
»Mitten in der Nacht?«
»Ja, sonst stirbt er uns!«
Es dauerte eine Weile, bis man einen Arzt gefunden hatte. Als der Mediciner schließlich beim Kürschner Charles Corduan eintraf, war der bereits verstorben.