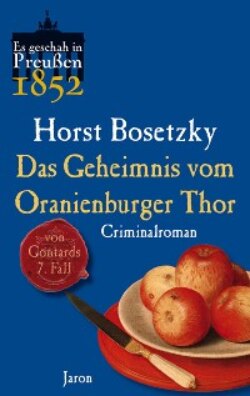Читать книгу Das Geheimnis vom Oranienburger Thor - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 7
Zwei
ОглавлениеOberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard stand zwar gerne im Hörsaal der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule, doch des Lehrinhaltes seines Hauptfaches – Physik unter besonderer Berücksichtigung der Ballistik – wurde er langsam ein wenig überdrüssig. Jahraus, jahrein den jungen Offizieren zu erklären, worin sich die Wurfparabel von einer ballistischen Kurve unterschied, unterforderte einen intelligenten Menschen wie ihn.
»An der Tafel sehen Sie oben die Flugbahn eines Körpers beim sogenannten schiefen Wurf in einem homogenen Schwerefeld bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes. Darunter habe ich die Parabel gezeichnet, wie sie sich aus einem schiefen Wurf mit Stokes-Reibung ergibt. Wer war Stokes?«
Der etwas vorlaute Lieutenant Eike von Flieth, der sich zu gerne selbst reden hörte, nutzte sofort die Gunst der Stunde. »Ein Mann aus Stoke in England.«
»Irrtum! Sir George Gabriel Stokes, geboren am 13. August 1819 in Skreen, in der Provinz Connaught, ist gebürtiger Ire und hat als Mathematiker und Physiker Weltruhm erlangt. Ich darf Ihnen seine berühmte Formel über die Reibungskraft an die Tafel schreiben.«
Die jungen Lieutenants seufzten einvernehmlich, und Gontard war froh, als er die Stunde endlich hinter sich gebracht hatte. Umso mehr freute er sich auf seine zweite Lehrveranstaltung an diesem Tage, die der brandenburgisch-preußischen Militärgeschichte gewidmet war.
»Ich möchte Ihnen, meine Herren, in den nächsten Wochen bedeutende Heerführer Brandenburg-Preußens nahebringen«, waren seine ersten Worte. »Leider muss ich mit einem Österreicher beginnen, einem Manne, der am 20. März 1606 in Neuhofen an der Krems zur Welt gekommen ist: Georg von Derfflinger. Er war Sohn protestantischer Eltern und wuchs in Armut auf. Sie werden sich nun sicher fragen, wie er es bis zum Heerführer geschafft hat, zumal er nicht die geringste Schulbildung vorweisen konnte. Nun, als Soldat hatte er das Glück, in der Blüte seiner Jahre an den Schlachten des Dreißigjährigen Krieges teilnehmen zu können. Er trat in die Dienste verschiedener Herren und stieg im schwedischen Heer bis zum Reiter-Oberst im Generalsrang auf. Das ist eine beachtliche Leistung. Danach verpflichtete er sich dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Derfflinger schuf eine völlig neue brandenburgische Armee, wobei sein Augenmerk der Kavallerie und der Artillerie galt. Der Sieg von 1675 über die Schweden, die unter Karl XI. kämpften, war zum größten Teil sein Verdienst. Es ist als genial zu bezeichnen, wie er den Handstreich gegen Rathenow ausgeführt und die Feinde anschließend verfolgt und über das Kurische Haff gejagt hat.«
Wieder meldete sich Eike von Flieth zu Wort. »Was haben wir unter dem Handstreich gegen Rathenow zu verstehen, Herr Oberst-Lieutenant?«
Gontard musste weit ausholen. »Das Ereignis trug sich am 15. Juni 1675 zu. Der Große Kurfürst und seine Mannen hatten in Erfahrung gebracht, dass der schwedische Oberst Wangelin mit sechs Kompanien seines Dragonerregiments zur Verstärkung der schwedischen Besatzung in der Stadt Rathenow eingerückt war. Wangelin sollte über Rathenow auf dem kürzesten Weg nach Magdeburg vorstoßen und die Stadt einnehmen. Für den Großen Kurfürsten gab es nur eine Lösung: Sein Regiment musste Rathenow unbedingt vor dem Eintreffen des schwedischen Hauptheeres erobern. Doch die Stadt an der Havel wies starke Befestigungen auf, man hätte sie im Kampf niemals erstürmen können. Deshalb wurde eine List ersonnen. Derfflinger, der aufgrund seiner Zeit beim schwedischen Heer gut Schwedisch sprach, ritt mit einigen wenigen Dragonern auf die hochgezogene Brücke der Stadt zu. Dort angekommen, wurde er von der schwedischen Wache angehalten, die nur aus einem Unteroffizier und sechs Mann bestand. ›Wie Volk?‹, wurde er gefragt. Man wollte also wissen, wer er sei und woher er komme. Derfflinger machte den Schweden weis, er sei ein schwedischer Lieutenant vom Regiment Bülow und befinde sich auf der Flucht vor den brandenburgischen Truppen. ›Ich muss dennoch erst Oberst Wangelin fragen, ob Ihr einrücken dürft‹, kam es von jenseits des Grabens. ›Das ist nicht nötig!‹, rief Derfflinger zu den Schweden hinüber. ›Oberst Wangelin ist ein guter Freund von mir, und wenn ich nicht sofort in die Stadt darf, riskiere ich, von den nachrückenden Brandenburgern gehängt zu werden.‹ Da wurde die Zugbrücke tatsächlich herabgelassen. Derfflinger ritt mit seinen Dragonern auf die Wache zu, hieb sie nieder – und Rathenow konnte alsbald vom Großen Kurfürsten eingenommen werden.«
Die jungen Lieutenants in dem Hörsaal brachen in Hurrarufe aus, was bei den Ausführungen zur Ballistik nie geschah, und so konnte Gontard mit dem Gefühl einer tiefen inneren Befriedigung die Stunde beenden.
Auf dem Flur begegnete ihm der Apotheker Gustav Rosengarth, der in diesem Jahr vertretungsweise das Fach Chemie übernommen hatte und sich in Berlin, besonders in der Gegend um das Oranienburger Thor, eines guten Rufes erfreute. Rosengarth war hochgewachsen, hatte ein schmales Gesicht und trug seine Haare lang wie ein Gelehrter. Gontard kannte ihn seit Jahren, und zwischen beiden war eine gewisse Vertrautheit entstanden. »Nun«, fragte Gontard, nachdem sie sich begrüßt hatten, »sind Sie auch auf dem Wege nach London?« Das war eine Anspielung auf Rosengarths Apothekerkollegen Theodor Fontane, von dem es hieß, er siedle Anfang April für einige Zeit auf die britische Insel über.
»Nein.« Rosengarth lachte. »Ich bin nichts weiter als ein einfacher Apotheker – und kein Schriftsteller und Correspondent bei der Centralstelle für Preßangelegenheiten wie Fontane.«
»Es ist meiner Meinung nach ganz schön, wenn man neben seinem Brotberuf noch etwas anderes mit Leidenschaft betreibt«, erklärte Gontard. »So wie ich gern den Criminal-Comissarius spiele.«
»Und Sie haben ja auch schon einige Erfolge aufzuweisen.« Rosengarth schaute auf seine Stiefelspitzen. »Womit könnte ich mich wohl in meiner arbeitsfreien Zeit vergnügen?«
Gontard dachte einen Augenblick nach. »Sammeln Sie etwas, oder erfinden Sie etwas! Als Apotheker könnten Sie doch eine neue Arznei kreieren. Es gibt Hunderte von Krankheiten, welche die Ärzte noch nicht heilen können.« Rosengarth seufzte. »Wenn das so einfach wäre!«
Sie unterhielten sich noch einen Moment und gaben dann ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das neue Jahr etwas aufregender werde als 1851, das so unglaublich langweilig gewesen sei. Danach eilte Rosengarth zu seiner Lehrveranstaltung und Gontard zum Kürschner Corduan, um zu sehen, ob sein neuer Pelzmantel schon zur Anprobe auf dem Garderobenständer hing. Doch als er den Laden in der Jägerstraße betrat, war nicht der Kürschner, sondern einer der Gesellen gerade dabei, den rechten Ärmel an den Mantel zu nähen.
»Nanu!«, wunderte sich Gontard und fragte, wo der Meister sei. »Er hat sich doch höchstpersönlich um meinen neuen Pelz kümmern wollen!«
»Herr Corduan ist in der Charité«, antwortete der andere Geselle höchst lakonisch.
»Ist er plötzlich krank geworden?«
»Nein, viel schlimmer. Er ist in der vergangenen Nacht plötzlich zusammengebrochen und gestorben. Es heißt, der Schlag habe ihn getroffen. Jetzt liegt er da, wo die Leichen aufgeschnitten werden.«
Es gab Verlierer der gescheiterten Märzrevolution von 1848 – und es gab Gewinner. Zu Letzteren schien der Jurist Dr. Wilhelm Stieber zu gehören. Am 3. Mai 1818 in Merseburg zur Welt gekommen, wurde er schon als Schüler nach Berlin geschickt, wo er das Abitur am angesehenen Gymnasium zum Grauen Kloster ablegte. Anschließend studierte er an der Friedrich-Wilhelms-Universität Rechtswissenschaften. Er war ab 1844 als Auskultator, also Referendar, beim Berliner Criminalgericht tätig und ging bald – mit einigem Erfolg – gegen politische Oppositionelle vor. Zwar musste er seinen Dienst 1847 quittieren, weil er bei seiner Arbeit mitunter ein wenig gegen Recht und Gesetz verstoßen hatte, doch gerade das sicherte ihm die Gunst einflussreicher Männer, und so durfte er 1850 als Assessor ins Polizeipräsidium einrücken und die Ermittlungen gegen den Bund der Kommunisten leiten. Er war gerade dabei, gemeinsam mit Karl Georg Ludwig Wermuth Steckbriefe für das sogenannte Schwarze Buch zusammenzustellen, dessen voller Titel lautete: Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten Jahrhunderts. Im amtlichen Auftrage zur Benutzung der Polizei-Behörden der sämmtlichen deutschen Bundesstaaten. Erster Theil. Enthaltend: Die historische Darstellung der betreffenden Untersuchungen. Wermuth war der Königliche Hannöversche Polizeidirektor, dem man ein besonders gutes persönliches Verhältnis zu König Georg V. von Hannover nachsagte.
Stieber und Wermuth saßen in Stiebers Bureau im Berliner Polizeipräsidium beisammen, um zu beraten, welche Personen noch ins Schwarze Buch aufzunehmen seien.
»Ich hätte einen ganz interessanten Kandidaten«, begann Dr. Stieber.
»Schießen Sie los!« Dr. Wermuth war gespannt.
»Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard von der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule.«
Dr. Wermuth zeigte sich erstaunt. »Wieso ausgerechnet den? Gontard war öfter zu Gast bei unseren Manövern im Hannoverschen und hat stets einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen.«
»Mag sein, aber das ist alles nur Tarnung. Er präferiert die Staatsform der amerikanischen Republik, und er ist Leuten wie Virchow kordial verbunden.«
»Und dennoch ist er vor nicht allzu langer Zeit zum Oberst-Lieutenant avanciert?« Dem Polizeidirektor aus Hannover fehlte angesichts dieser Informationen das Verständnis für die Beförderung.
»So ist es«, bestätigte Dr. Stieber. »Jemand am Hofe muss seine Hand schützend über ihn halten.«
»Denken Sie an Seine Majestät selbst?«
Dr. Stieber schüttelte den Kopf. »Nein, ich vermute eher, dass es eine der Hofdamen ist, möglicherweise sogar die Königin.«
Beide schwiegen erst einmal, denn was ihnen durch den Kopf ging, war zu heikel, um es auszusprechen. In Berlin wurde schon seit langem gemunkelt, dass Christoph Wilhelm Hufeland, der wohl bedeutendste Arzt der preußischen Residenz, beim König bereits in jungen Jahren eine unheilbare Impotenz diagnostiziert habe. Ob dieses Gerücht nun stimmte oder nicht, Tatsache war, dass die Ehe zwischen Friedrich Wilhelm IV. und seiner Frau Elisabeth kinderlos geblieben war. Und wenn die Königin nun ein Verhältnis mit dem Oberst-Lieutenant von Gontard hatte?
Dr. Stieber beendete das Schweigen. »Gontard soll sich im Jahre 1836 mit Karl Marx getroffen haben.«
»Das ist sechzehn Jahre her«, murmelte Dr. Wermuth.
»Was will das schon heißen? 1836 war Karl Marx an der Friedrich-Wilhelms-Universität eingeschrieben und hat nicht nur Vorlesungen von Friedrich Carl von Savigny, Carl Ritter und Bruno Bauer gehört, sondern auch von Eduard Gans, der Criminalrecht und Preußisches Landrecht gelehrt hat.«
»Und?« Dr. Wermuth konnte sich noch immer keinen Reim auf die Ausführungen Dr. Stiebers machen.
»Eduard Gans und Gontard sind entfernte Verwandte. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass Gontard mit Karl Marx zusammengetroffen ist und sich von dessen staatsfeindlichem Gedankengut hat anstecken lassen.«
Dr. Wermuth wollte keine Entscheidung fällen. »Darf ich vorschlagen, dass wir das mit Gontard vorerst noch offenlassen?«
Gontard hatte an diesem Vormittag eine Verabredung im Café Stehely, zu der er auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Schnell fuhr er mit dem rechten Fuß in seinen Stiefel. In derselben Sekunde hallte ein Schmerzensschrei durch das Haus in der Dorotheenstraße, der für einen Soldaten wenig heldenhaft war.
Henriette eilte sofort in die Diele. »Hat dir jemand ins Bein geschossen?«
»Es fühlt sich zumindest so an.« Gontard zog den Fuß wieder aus dem Stiefel. »Da, bitte!« Blut tropfte aus der grauen Socke.
Es stellte sich heraus, dass Paul Quappe die reparaturbedürftigen Stiefel nicht zum Schuster gebracht, sondern sich selbst ans Werk gemacht hatte. Dabei hatte er allerdings viel zu lange Nägel verwendet.
»Das ist ein Mordversuch«, brummte Gontard. »Man müsste den Burschen sofort standrechtlich erschießen.«
»Ach was, das war doch keine Absicht!«
»Mag sein, aber Paul Quappe hat einfach zwei linke Hände und sorgt tagtäglich für ein fürchterliches Durcheinander.« Derzeit lag Gontards Bursche allerdings in seiner Kammer und kurierte seine Gehirnerschütterung aus. »Wenn Kußmaul sagt, dass es eine Gehirnerschütterung ist, wissen wir wenigstens, dass Quappe über so etwas wie ein Gehirn verfügt«, stellte Gontard fest, während er seine Wunde am rechten Fußballen mit einem Stück Mullbinde versorgte und gleichzeitig, auf dem linken Bein humpelnd, nach einem anderen Paar Schuhe suchte.
»Hat man denn den Kerl schon gefunden, der Paul niedergeschlagen hat?«, wollte Henriette wissen.
Gontard schüttelte den Kopf. »Nein. Werpel wartet sicherlich, bis der Mann zwei Dutzend Einbrüche begangen hat – und womöglich noch einen Mord –, damit er umso mehr Ruhm erntet, wenn er den Übeltäter gefangen hat.«
»Du sprühst heute geradezu vor Ironie«, stellte Henriette fest.
Gontard lachte. »Ich hoffe, das bleibt den ganzen Tag so.« Dann küsste er Henriette und machte sich auf den Weg zum Gensdarmen-Markt. Er sah sich dabei mehrfach um, denn er hielt es nicht für ausgeschlossen, dass ihn einer von Dr. Stiebers Leuten verfolgte. Schließlich würde er einen Mann treffen, der in Preußen ganz sicherlich als Staatsfeind galt: Benedikt Waldeck.
Waldeck war am 31. Juli 1802 in Münster geboren worden, hatte in Göttingen studiert, unter anderem bei Jakob Grimm, war ein hervorragender Jurist geworden und 1844 als Obertribunalrath an das höchste preußische Gericht nach Berlin gekommen. Viele Denker seiner Zeit hatten ihn beeinflusst, unter ihnen auch der französische Autor Henri de Saint-Simon.
»Ich gelte zwar als Anführer des fortschrittlichen Lagers, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit«, gestand er Gontard, als sie sich im Café Stehely gegenübersaßen. »Ich bin nie dafür eingetreten, die amerikanische Verfassung auf Deutschland zu übertragen, ich war immer für die konstitutionelle Monarchie. Meiner Meinung nach sollten alle adeligen Privilegien aufgehoben und die Presse- und Versammlungsfreiheit gewährleistet werden, aber mit einem König an der Spitze.«
»Wie passt das zusammen?«, fragte Gontard.
»Wir müssen die Welt so nehmen, wie sie ist, und alles daransetzen, dass sich unser Volk nicht selbst zerfleischt«, erklärte Waldeck. »Darum bin ich auch zur gemäßigten demokratischen Fraktion gestoßen und habe alles getan, um weitere gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern.«
Gontard nickte. »Ich weiß, zum Beispiel beim Streik der Kanalarbeiter im vergangenen Jahr.«
Waldeck seufzte. »Dreh- und Angelpunkt ist für mich das Parlament. Ich ziehe die Redeschlachten dort den Straßenschlachten allemal vor. Und ein Gefängnis ist auch nicht gerade eine Stätte bürgerlicher Gemütlichkeit.«
Waldeck war im Mai 1849 verhaftet und eingesperrt worden, weil man ihm unter anderem vorgeworfen hatte, ein Attentat auf den König geplant zu haben. Das Gericht hatte ihn allerdings freigesprochen, nicht zuletzt deswegen, weil sich Hinckeldey als Zeuge in Widersprüche verwickelt hatte. Waldeck war anschließend von der Menge frenetisch gefeiert worden und hatte auf seinen Dienstposten beim Obertribunal zurückkehren können.
»Und nun?«, fragte Gontard. »Wie stehen Sie zur Deutschen Frage?«
Waldeck zögerte nicht mit einer Antwort. »Ich halte noch immer nicht viel von der provisorischen Regierung in Frankfurt und glaube, dass wir Preußen das Volk sind, das in Deutschland an der Spitze stehen sollte. Deshalb können nur wir die Einheit Deutschlands herbeiführen, wobei ich Österreich ausschließe. Auch wenn es deswegen Krieg geben sollte.«
Gontard war anderer Meinung, äußerte sich aber nicht, da er an einem der Nebentische einen Spitzel Dr. Stiebers entdeckte hatte. Darum sagte er jetzt so laut, dass der Spitzel es hören musste: »Goethe hat recht, die Politik ist wirklich ein garstiges Lied. Ich mache es so wie Sie, lieber Waldeck, und ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Es lebe das Private!«
Franz Böttschendorf war eigentlich Barbier, übte aber auch den traditionellen Beruf des Baders aus, zog also Zähne und versuchte sich bei armen Leuten, für die der Besuch einer Arztpraxis zu teuer war, als Mediciner. Sehr zum Ärger seiner Frau Dorothea. »Wir haben überall Schulden, und du verplemperst deine Zeit mit Leuten, die auf dem Kirchhof besser aufgehoben wären!«
Böttschendorf blieb gelassen. »Der Herr wird’s mir schon einmal danken.«
»Das denkst du! Ich glaube nicht daran.« Doch Böttschendorfs Frau sollte sich geirrt haben …
An einem Freitag suchte Böttschendorf den Kunstmaler und Kupferstecher Martinus Michels auf, um ihn zur Ader zu lassen. Ein Aderlass sollte den Körper von schlechtem Blut befreien, das durch übermäßiges Essen, Sorgen, Ängste oder Enttäuschungen entstanden sein konnte. Böttschendorf glaubte zwar nicht daran, aber mit dem Aderlass ließ sich noch immer Geld verdienen.
Michels hauste in einem verwahrlosten Gebäude in der sogenannten Parochialritze, der äußerst schmalen Parochialstraße, in einem Raum, der gleichzeitig als Atelier sowie als Wohn- und Schlafzimmer diente. Fast hätte man denken können, Carl Spitzweg sei 1839 hier zu Besuch gewesen, um sich Anregungen für sein wunderbares Gemälde Der arme Poet zu holen, nur dass Martinus Michels nicht dichtete, sondern malte. Manche hielten ihn für ein Genie, nur kaufen wollte niemand, was er auf die Leinwand brachte. Auch seine Radierungen und Federzeichnungen fanden keine Abnehmer.
Während Böttschendorf den Schröpfschnepper hervorholte, mit dem er die Haut an Michels linkem Arm anritzen würde, warf er einen Blick auf einige Federzeichnungen, die der Künstler an der Wand befestigt hatte, wohl, um sich an die Barrikadenkämpfe im März 1848 zu erinnern. »Haben Sie selbst auf den Barrikaden gekämpft?«, wollte Böttschendorf wissen.
Voller Stolz fuhr Michels auf. »Selbstredend! Immer mittenmang. Sehen Sie nicht, da stehe ich doch!« Er deutete auf eine der Zeichnungen.
Böttschendorf hätte sich schnell wieder seiner Profession zugewendet, wenn er nicht in diesem Augenblick neben Martinus Michels ein bekanntes Gesicht auf dem Gemälde entdeckt hätte. »Das darf doch nicht wahr sein!«, rief er aus.
»Was ist?«, wollte Michels wissen.
»Ach, nichts.« Böttschendorf sah keinen Anlass, Michels auf die Nase zu binden, dass er einen der lebensecht gezeichneten Barrikadenkämpfer erkannt hatte. Es war kein Geringerer als der Königliche Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard, verkleidet als Totengräber! Diese Entdeckung konnte Gold wert sein, und so kaufte Böttschendorf die Federzeichnung März 1848 – Barrikade am Alexanderplatz – Vor dem ersten Schusswechsel für so viel Geld, dass es Michels vorkam, als fielen Ostern und Pfingsten auf denselben Tag. Beide waren so glücklich wie schon lange nicht mehr.
Als Gontard am nächsten Morgen zum Rasieren und Haareschneiden zu Böttschendorf kam, holte der die Federzeichnung aus einer Schublade hervor und hielt sie seinem Kunden unter die Nase.
»Das ist der Beweis, Herr Oberst-Lieutenant, der Sie Kopf und Kragen kosten kann. Wie viel ist er Ihnen wert?«