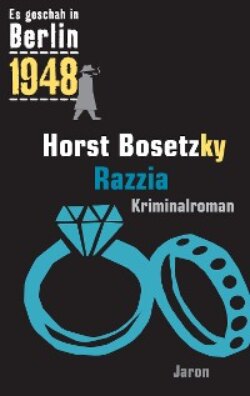Читать книгу Razzia - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 6
ZWEI
ОглавлениеHERMANN KAPPE sah auf die Uhr und hatte nichts anderes mehr im Kopf als seinen Feierabend. « Und das Schiffsvolk jubelt: Halt aus! Hallo! / Und noch zehn Minuten bis Buffalo. »
Gerhard Piossek, sein Gegenüber am Schreibtisch, wollte Fontanes John Maynard an dieser Stelle nicht gelten lassen. «Unser Dienstgebäude ist doch kein brennendes Schiff. Ein schiefes Bild, Kappe.»
«Das ist die Erschöpfung.»
Die Kripo im amerikanischen Sektor hatte in den letzten 24 Stunden mehr als genug zu tun gehabt. Der Telegraf vom 16. Januar 1948 fasste die Geschehnisse wie folgt zusammen:
Der vor einigen Tagen als vermißt gemeldete amerikanische Corporal Stanley L. Claycomb ist gestern früh durch Passanten in einem Kellerloch der Ruine des Hauses Berliner Straße 3 in Tempelhof ermordet aufgefunden worden. Der Tote lag neben einer Hauswand, die Schädeldecke war eingeschlagen, um den Hals war ein Hosenträger geknotet. Verhaftet wurden bisher drei Deutsche, darunter ein Zahnarzt, dessen Wohnung der Amerikaner am 23. Dezember betreten haben soll.
Nicht genug damit, in Britz war die Frau eines Berufsverbrechers bei der Festnahme ihres Mannes von der Polizei erschossen worden. Hier musste also gegen die Kollegen ermittelt werden.
«Dein Sohn muss ja auch ganz schön im Einsatz gewesen sein», sagte Piossek zu Hermann Kappe. «Der erschlagene Schieber da in Pankow, Peter Rembowski …»
Kappe winkte ab. «Keine Ahnung, das geht mich auch nichts an.» Er räumte seinen Schreibtisch auf und widmete sich in den letzten Minuten seiner Arbeitszeit noch einmal der Morgenzeitung. Im US-Senat hatte Kenneth C. Royall, ein Staatssekretär im Verteidigungsministerium, für den Marshall-Plan plädiert: « Würde man Deutschland dem ursprünglichen Plan zufolge zu einem reinen Agrarstaat machen, dann wäre es niemals imstande, sich selbst zu erhalten. »
«Wir Berliner hätten das durchaus geschafft», sagte Piossek. «Wir haben doch schon den Tiergarten zu einem großen Schrebergarten gemacht, und wenn wir den Grunewald, den Tegeler und den Grünauer Forst roden, können wir auch genug Roggen anbauen, um für alle täglich eine Mehlsuppe zu haben, mit Klütern.»
«Keine schlechte Idee», brummte Kappe. «Noch weniger Probleme mit der Nahrungsmittelversorgung hätten wir aber, wenn wir alle wie Gandhi fasten würden.» Und er las vor, was aus Neu-Delhi berichtet wurde: « Mahatma Gandhi begann entgegen früheren Meldungen am Donnerstag den dritten Tag seiner Fastenzeit für den Frieden und betonte, er habe nicht die Absicht, sein Fasten aufzugeben. Im letzten Bulletin vom Donnerstagmorgen erwähnten die Ärzte Gandhis, dass unmittelbare Lebensgefahr für den 78jährigen bestünde. »
«Der stirbt bestimmt nicht daran, dass er nichts mehr isst», sagte Piossek. «Den erschießt bestimmt eher irgendein Fanatiker.»
Kappe war schon beim nächsten Thema. « Hochwasser an Ruhr, Lenne, Volme und Ennepe. »
«Wenn Spree und Havel dran sind, ist das nicht so schlimm», sagte Piossek und zeigte auf seine Beine. «Ich habe sowieso schon Hochwasserhosen an. Geerbt von meinem verstorbenen Bruder, und der war zehn Zentimeter kleiner als ich.»
« Verkehrsstörungen bei der S-Bahn », fuhr Kappe fort. « Zu einer Störung von 45 Minuten kam es am Donnerstag auf der S-Bahnstrecke von Potsdam nach Wannsee infolge eines Kurzschlusses. »
«‹Gibt es auch Langschlüsse?›, würde mein Enkel fragen.» Kappe las unbeirrt weiter. « Der Ausfall eines Zuges durch Moto renschaden verursachte in den Mittagsstunden des gleichen Tages eine Störung von über 30 Minuten auf der Ringbahn zwischen Innsbrucker Platz und Halensee. »
«Interessiert mich nicht», sagte Piossek. «Ich komme mit dem Fahrrad.»
Hermann Kappe aber hatte es in dieser Hinsicht noch wesentlich besser, denn seine neue Wohnung an der Wartburgstraße, Ecke Martin-Luther-Straße lag nahezu in Sichtweite seiner derzeitigen Dienststelle in der Gothaer Straße. Er brauchte bloß quer über den Wartburgplatz zu gehen, dann war er schon zu Hause.
Als er dort angekommen war, wurde er nicht nur von Klara begrüßt, seinem «treusorgenden Weib», sondern auch von Hertha Börnicke, seiner Cousine. Auch das noch! Es kam ihm so vor, als ob sie ihm schon seit hundert Jahren gewaltig auf die Nerven ging. Zunächst hatte sie alles darangesetzt, ihn zu heiraten, dann musste jedes Familienmitglied ihre Romane bis zur letzten Zeile lesen, und schließlich war sie Redakteurin im offiziellen BDM-Organ Mädel im Dienst gewesen, wo sie dafür gekämpft hatte, dass es die echte deutsche Maid als ihr Ziel ansah, für die Wärme des heimatlichen Herdes zu sorgen, Hüterin der Reinheit des Blutes und des Volkes zu sein und die Söhne des Volkes zu Helden zu erziehen. Nun war sie Journalistin beim RIAS, und da der Rundfunk im amerikanischen Sektor im Laufe des Jahres in die Kufsteiner Straße umziehen würde und dann gleich um die Ecke angesiedelt war, würde sie wohl noch öfter bei ihnen auftauchen.
Er konnte sich gerade noch zur Seite wenden, sonst hätte sie ihn auf den Mund geküsst, so traf es nur die rechte Wange. Schon als Kind hatte sie behauptet, Cousine käme von küssen. Er hatte sie deswegen immer nur seine Base genannt, was an Chemie erinnerte und nicht an etwas Erotisches.
Sie setzten sich an den Wohnzimmertisch, wo schon eine Petroleumlampe warmes Licht verbreitete. Strom gab es wahrscheinlich erst ab 22 Uhr. Klara kam mit der Kaffeekanne und goss den Muckefuck ein. Dazu gab es für jeden ein kleines Stück des Stollens, den Kappes Mutter mit den guten Gaben gebacken hatte, die zu Weihnachten aus Wendisch Rietz gekommen waren.
Klara Kappe berichtete von der Tochter einer Nachbarin, dem Fräulein Krause, das gerade einen Captain der US-Army geheiratet hatte und nächste Woche nach New York fliegen sollte.
«Wir hatten im RIAS gerade erst eine Sendung über die warbrides », berichtete Hertha Börnicke. «Eine Untersuchung hat ergeben, dass 95 Prozent der Ehen zwischen US-Soldaten und europäischen Frauen glückliche Volltreffer sind.»
Klara seufzte. «Schade, dass unsere Margarete schon vor dem Krieg geheiratet hat – einen Deutschen auch noch. Sonst würden wir auch immer so schöne Carepakete bekommen.» Und sie zählte auf, was die Nachbarn, die Krauses, alles in ihrem letzten Carepaket gehabt hatten.
Das nun war Hertha Börnicke etwas zu profan, und sie bemühte sich wie immer, das kulturelle Niveau der Familie Kappe zu heben, indem sie über den Film Professor Mamlock referierte, den sie im Kino Aladin in der Friedrichstraße gesehen hatte. « Professor Mamlock ist ja ursprünglich ein Schauspiel von Friedrich Wolf, das im Januar 1934 im Jüdischen Theater Warschau Weltpremiere hatte. 1938 wurde es in der Sowjetunion verfilmt.»
Kappe empfand den Besuch seiner Cousine immer mehr als ärgerliche Störung seiner Feierabendruhe. So fragte er denn auch ziemlich schroff, ob sie nur gekommen sei, um ihnen zu erzählen, dass sie den Mamlock-Film gesehen habe.
«Nein, eigentlich bin ich hier, weil ich eine Sendung über die Gefahren des schwarzen Marktes machen will. Der US-Korporal da in Tempelhof ist offensichtlich auch bei einem Tauschgeschäft ums Leben gekommen, und in Neukölln sind erst vor kurzem zwei Männer ausgeraubt und ermordet worden, die sich in ihrer Wohnung auf Tauschgeschäfte mit Personen eingelassen hatten, die ihnen völlig unbekannt waren.»
«Diesen Rembowski nicht zu vergessen, den sie in Pankow erschlagen haben.»
«Du bist aber nicht mit der Aufklärung des Falles betraut worden, oder?», fragte Hertha Börnicke.
«Nein, das macht mein Herr Sohn in der Dircksenstraße. Da musst du schon Hartmut fragen. Wir sitzen hier im amerikanischen Sektor, und Pankow gehört bekanntlich zum sowjetischen Sektor.»
Seine Cousine winkte ab. «Da darf ich mich als Mitarbeiterin des RIAS nicht sehen lassen.»
«Ich bin lieber auch nur privat und ohne Dienstmarke dort», sagte Hermann Kappe. «Obwohl wir ja eigentlich immer noch eine Polizeibehörde sind und einen gemeinsamen Chef haben, unseren stellvertretenden Oberbürgermeister Ferdinand Friedensburg von der CDU.»
«Verhältnisse sind das!», rief Klara Kappe.
Da musste Hertha Börnicke ihr zustimmen. «Ja, und täglich berichten die Zeitungen von angeblichen Kriminalbeamten, die sich durch Vorzeigen gefälschter Ausweise Zugang zu Wohnräumen erschleichen und dann alles ‹beschlagnahmen›, was sich auf dem schwarzen Markt verkaufen lässt.» Sie sah Kappe an. «Weißt du was davon?»
Kappe grinste. «Was heißt hier ‹angebliche Kriminalbeamte›? Auch wirkliche kommen auf diese Weise zu Essen und Trinken, zu Perserteppichen und Schmuckstücken. Ich ziehe selbst gleich wieder los.»
Er wusste, dass seine schroffe Reaktion damit zusammenhing, dass Hertha Börnicke ihn an seinem derzeit wohl empfindlichsten Punkt erwischt hatte. Er war nämlich durch Zufall dahintergekommen, dass sein Sohn Karl-Heinz kurz vor Weihnachten seine Kripomarke und seinen Dienstausweis gestohlen hatte, um ebendas zu tun, was Hertha Börnicke soeben geschildert hatte. Bis jetzt hatte außer ihm offenbar niemand etwas gemerkt, aber Kappe wusste, dass irgendjemand es früher oder später herausfinden würde.
Karl-Heinz Kappe gefiel sich in der Rolle des schwarzen Schafes der Familie. Was blieb ihm anderes übrig? Zwar sprach sein Vater wieder mit ihm, nachdem die Großmutter mit ihrem Leitspruch Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern zwischen ihnen beiden vermittelt hatte, aber es waren nicht einmal vier Jahre her, dass es ihn zur Hitlerjugend und zur Waffen-SS gezogen hatte. «Mir wäre lieber, er hätte einen Mord begangen, als das», hatte sein Vater damals gemurmelt. Nach dem Krieg hatten ihn die einen nicht haben wollen, und im Kreise der anderen, der alten Nationalsozialisten und der Wehrmachtsoffiziere, zeigte man sich besser nicht. Er war jetzt 21 Jahre alt und merkte mehr und mehr, dass er der geborene Händler war. Kein Wunder, gab es doch mit Oskar Kappe, seinem Onkel, und Richard Börnicke zwei ausgewiesene Kaufleute in der Familie. Aber bis er ein eigenes Geschäft oder gar einen Großhandel eröffnen konnte, musste er erst noch eine Weile kleine Brötchen backen, das heißt auf dem Berliner Schwarzmarkt sein Glück versuchen. Was ihm dabei zugutekam, waren seine Intelligenz, seine Dreistigkeit und seine Begabung für fremde Sprachen. Das erleichterte die Geschäfte mit den Soldaten aller drei westlichen Besatzungsmächte ganz erheblich, und so kam es, dass sich die Großen der Branche gern seiner bedienten. An diesem Wochenende hatte ihn sogar Arthur Schlattke in seine Villa eingeladen, um einiges mit ihm zu besprechen.
Gemeldet war Karl-Heinz Kappe derzeit in der Eisenacher Straße in Schöneberg, er wohnte aber mal hier, mal dort – je nachdem, wo er gerade eine Freundin hatte. Dieser Tage logierte er bei Marga, die sich ihr Geld, wie sie selber sagte, mit der Pflaume verdiente. Ihm war es egal, Hauptsache, er holte sich keinen Tripper bei ihr. Sie konnte sich eine geradezu luxuriöse Wohnung in der Meinekestraße in Charlottenburg leisten. Ein paar Schritte, und man war am Kurfürstendamm.
Marga war von Hause aus Krankenschwester, was sie für bestimmte Kunden besonders interessant machte – nämlich für die, die schwer verletzt aus dem Krieg gekommen waren. Auch wer Angst vor Geschlechtskrankheiten hatte, fühlte sich bei ihr sicher aufgehoben.
Sie sah, dass sich Karl-Heinz Kappe seinen besten Anzug angezogen hatte. «Willste noch ausgehen heute?»
«Nee, ich will noch raus nach Schlachtensee zu Arthur Schlattke, mit dem ein paar neue Sachen anleiern.»
Als sie den Vornamen Arthur hörte, musste Marga lachen. «Ah, der schöne Arthur mit der flotten Haartour!» Wie viele Berliner dachte sie bei diesem Namen sofort an ein sehr populäres Couplet des Komponisten Leopold Maass mit dem Titel Arthur mit der Haartour.
Karl-Heinz Kappe verstand den Scherz nicht, er wusste nur, dass Schlattke sauer reagierte, wenn ihn jemand Atze nannte.
Als er Marga das erzählte, staunte sie. «Zu Artur Brauner dürfen doch auch alle Atze sagen.» Seit Brauner die CCC-Film gegründet hatte und große Pläne schmiedete, war er immer wieder in den Zeitungen.
«Ja, der eine so, der andere so.»
«Fährste mit der S-Bahn nach Schlachtensee?», wollte sie wissen.
«Nein, mit ’ner Taxe, wenn ich schon kein eigenes Auto habe. Bei Schlattke kann man nicht als lumpiger Fußgänger antanzen.»
Arthur Schlattke war am 13. Mai 1916 in Nürnberg als Sohn eines Kolonialwarenhändlers zur Welt gekommen, hatte die Schule mit dem Einjährigen erfolgreich zu Ende gebracht und dann bei der AEG in Berlin Industriekaufmann gelernt. 1937 meinte er, aufs richtige Pferd zu setzen, wenn er in die NSDAP eintrat. Von Pferden verstand er etwas, denn er hatte schon als Kind das Reiten erlernt, und so war es kein Wunder, dass er im Krieg als Obergefreiter und Gruppenführer zur reitenden Schwadron der bayerischen Aufklärungsabteilung 7 abgeordnet wurde. Im Oktober 1943 war ihm am mittleren Dnjepr für seinen Einsatz als Stoßtruppführer das Ritterkreuz verliehen worden. In der Begründung hatte es geheißen: Als Einzelkämpfer rang der Obergefreite zwei feindliche Pak-Bedienungen nieder und setzte mit mehreren Handgranatenwürfen die sowjetische Grabenbesatzung nach und nach außer Gefecht. Gegen Ende des Krieges war er bei der Ardennen-Offensive zum Einsatz gekommen und von den Amerikanern gefangen genommen worden. Im Lager gab es ein Klavier, und da er ein blendender Pianist war, holten ihn die Amerikaner in ihr Casino. Schon immer war sein Englisch ausgezeichnet gewesen, und bald hatte er Freunde unter den amerikanischen Offizieren gefunden, auch Männer, die an kleinen und größeren außerdienstlichen Geschäften interessiert waren. Nach Ende des Krieges war er seiner großen Liebe wegen nach Berlin gezogen, und hier hatte er wegen seiner guten Kontakte zur Besatzungsmacht schnell ein Unternehmen aufgebaut, ganz legal mit ordentlicher Fassade, Ex- und Import, das mit allem Möglichen handelte – von Opium über Brillanten bis hin zu Tabak und Lebensmitteln. Das große Geld machte er mit Schokolade und Zigaretten. Es hatte schon zu einer stattlichen Villa in Schlachtensee gereicht, in der Matterhornstraße. Verheiratet war er mit Dorothea, der Tochter eines Berliner Chirurgen. Zwei Kinder hatten sie. Seine Entnazifizierung war unproblematisch verlaufen, denn natürlich hatte er bei der Antragstellung verschwiegen, dass er noch immer im Stillen sang:
Wir werden weiter marschieren
Wenn alles in Scherben fällt,
Denn heute gehört uns Deutschland
Und morgen die ganze Welt.
Jetzt war er Mitglied der LDP, der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands. Forsch war sein Auftreten, schneidig seine Sprache.
Als Karl-Heinz Kappe an seinem Gartentor stand und klingelte, ließ Arthur Schlattke ihn gerne eintreten. Er hielt viel von ihm, und das, obwohl sein Vater wie auch sein Bruder und sein Onkel bei der Kripo arbeiteten. Das war vielleicht mit gewissen Gefahren verbunden, gleichzeitig aber hatte man mit ihm eine Art Spion im feindlichen Lager.
Er begrüßte Karl-Heinz Kappe im Windfang, ließ ihn dann in der Diele ablegen und führte ihn ins Herrenzimmer, wo sie sich erst einmal eine Lucky Strike ansteckten. Im Ton suchte er eine Mischung von Spieß und väterlichem Freund zu treffen.
«Nun, mein Lieber, was melden die Buschtrommeln: Wer hat den Rembowski in Pankow aus dem Verkehr gezogen?»
«Tut mir leid, keine Ahnung …»
«Und von den Verwandten ist nichts zu erfahren gewesen?»
«Nee.» Karl-Heinz Kappe zuckte bedauernd mit den Schultern.
Schlattke fixierte ihn und gab sich inquisitorisch. «Und du schwörst mir, dass du damit nichts zu tun hast, auch nicht mit dem ermordeten Ami in Tempelhof?»
«Ich schwöre es!» Karl-Heinz Kappe legte die rechte Hand aufs Herz und hob die linke wie zur Eidesleistung.
«Gut, du hältst aber die Augen offen!»
«Ja, mache ich.»
Schlattke rückte nun dichter an ihn heran und sprach ein wenig leiser. «Ich habe nämlich noch einiges mit dir vor und möchte nicht, dass du … Folgendes: Ich werde in den nächsten Wochen an große Ladungen Schokolade herankommen, Cadbury, und jetzt geht es darum, einen Verteilerring aufzubauen …»
Hermann Kappe war von seinem Sohn Hartmut in einem streng privaten Gespräch von einer abgelegenen Telefonzelle aus gebeten worden, sich auf den schwarzen Märkten in den westlichen Sektoren ein wenig umzuhören, ob es zweckdienliche Hinweise auf den Mörder von Peter Rembowski geben würde. Im Westen zu ermitteln war ihm ja generell von seinen Oberen untersagt.
«Gut, ich grase mal mit deiner Tante Hertha alles ab, die macht gerade was für den RIAS über den Berliner Schwarzmarkt.»
Nun war ihm ja Hertha Börnicke nicht gerade ans Herz gewachsen, aber sie hatte zu diesem Thema schon so viele Informationen gesammelt, dass Kappe sich eigenes Recherchieren ersparen konnte. Dass er ein Mensch war, der unnütze Arbeit mied, hatte er nie abgestritten. Also rief er seine Cousine im RIAS an und fragte sie, wo und wann man sich am besten treffen könne.
Sie lachte. «Sagen wir, morgen früh um zehn an der Uhr am Bahnhof Zoo.»
Kappe schluckte, bevor er zustimmte, denn dort trafen sich im Allgemeinen nur frischverliebte Paare. Aber nun ja …
«Wenn du schon in der Gegend bist, kannst du gleich mal deine Mutter besuchen», sagte Klara, als er ihr am Abend von seinem geplanten Treffen mit Hertha Börnicke berichtete. «Du warst jetzt schon zwei Wochen nicht mehr bei ihr, und mir liegt sie deswegen ständig in den Ohren.»
«Gut, wenn du meinst.» Kappe hatte in seinen langen Ehejahren gelernt, welch hohen Wert die Kunst der Resignation doch hatte.
Und so stand er am nächsten Morgen pünktlich um neun Uhr bei seiner Mutter auf der Matte, wie er es ausdrückte. Bertha Kappe hatte am östlichen Ende der Pestalozzistraße in der dritten Etage eines Hinterhauses Stube und Küche gemietet und war immer froh und guten Mutes. Sie hatte sich als alte Theaterliebhaberin natürlich Thornton Wilders Wir sind noch einmal davongekommen angesehen, mehrmals sogar, und sich dessen Botschaft zu eigen gemacht. Eine Rezension hatte sie sich aus der Zeitung ausgeschnitten und hinter den Spiegel gesteckt:
Das Stück führt vor Augen, dass das Böse und das Gute ewige Bestandteile des Lebens sind, und dessen Sinn liegt im Lebendigsein selbst. Das Schicksal der gesamten Menschheit wird am Beispiel einer typischen Durchschnittsfamilie unseres Jahrhunderts gezeigt. Die moderne Allegorie bringt zum Ausdruck, dass der Lebenswille des Menschen alle Katastrophen überdauert.
Bertha Kappe würde im Sommer 82 Jahre alt werden. «Ich habe drei Kaiser überlebt», sagte sie zu ihrem Sohn, als der bei ihr am Küchentisch Platz genommen hatte, «Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. Ich habe Friedrich Ebert, Paul von Hindenburg und Adolf Hitler überlebt. Was will ich mehr? Nun sitze ich hier in meiner Ehrenloge in der Pestalozzistraße und schaue mir von oben an, was in der Welt so passiert. Und allein bei den Kappes passiert eine ganze Menge. Der eine Enkel ist Kommunist, der andere Schieber und Tunichtgut … Immer, wenn sie wieder einen Schieber umgebracht haben, dann zittere ich und denke: Hoffentlich war der Karl-Heinz nicht dabei!»
«Und wer ist schuld daran?», fragte Kappe. «Ich natürlich. Meine Erziehung.»
«Ach Kind, es gibt es viele Ursachen dafür, dass Kinder so sind, wie sie sind.»
Die Anrede «Kind» ließ Kappe schmunzeln. «Du, ich werde am 11. Februar auch schon sechzig Jahre alt.»
Seine Mutter lachte. «Mein Kind bleibst du trotzdem. Übrigens sitze ich schon an einem Gedicht für deinen Geburtstag.»
«Schreck lass nach!», rief Kappe. «Da bekomme ich ja wieder alle meine Sünden zu hören.»
«Und deine Heldentaten. Vor allem, dass du dir bei Adolf nicht die Finger schmutzig gemacht hast. Darauf kannst du stolz sein.»
Kappe winkte ab. «Die Verdienstkreuze haben eher die anderen gekriegt. Aber lassen wir das.» Er sah auf ihre große Wanduhr, deren Perpendikel ihn von jeher irritiert und geängstigt hatte, weil er so unerbittlich darauf hinwies, dass die Zeit eines jeden Menschen einmal ablief. «Ich bin um zehn Uhr verabredet – mit Hertha.»
Die Augen seiner Mutter leuchteten auf. «Was, ihr werdet doch noch ein Paar?»
Er antwortet barsch: «Wir sind dienstlich verabredet. Sie bereitet eine Reportage für den RIAS vor, über den Schwarzmarkthandel in Berlin, und ich soll mich nach dem Mörder dieses Schiebers in Pankow umhören. Hartmut hat mich drum gebeten, der darf ja hier in den Westsektoren nicht mehr ermitteln.»
«Gott, ist das eine Welt!»
«Ja, aber keine Welt wäre auch nicht gut – denn was hätten wir sonst?»
Hermann Kappe verabschiedete sich mit dieser Bemerkung von geradezu philosophischer Qualität von seiner Mutter, natürlich mit einer herzlichen Umarmung, und strebte in Richtung Bahnhof Zoo. Seine Cousine stand schon wartend unter der großen Uhr. Und tatsächlich küsste Hertha ihn, als sei es ihr erstes Rendezvous. Dabei wurde er in drei Wochen sechzig, und so viel jünger war sie auch nicht, Jahrgang 1893.
«The main three black market centres in the british sector appear to be Bahnhof Charlottenburg, Bahnhof Zoo and Schlüterstraße», begann Hertha Börnicke. «At Schlüterstraße the crowd consists mostly of Polish, Allied and German nationals, while at Bahnhof Charlottenburg Polish, Yugoslav, Bulgarian and other foreigners predominate.»
«Nur gut, dass wir nicht im russischen Sektor sind», murmelte Kappe.
«Ich wollte ja nur andeuten, dass bei vielen Geschäften Displaced Persons ihre Hände im Spiel haben.» Damit waren die Zwangsarbeiter und die Verschleppten der Naziherrschaft gemeint, die aus vielerlei Gründen noch nicht in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren. Sie bekamen größere Lebensmittelrationen und konnten knappe Güter des täglichen Bedarfs leichter erwerben, hatten also mehr zum Tauschen.
«Was wollen wir denn alles abklappern?», fragte Kappe.
Hertha Börnicke holte einen Stadtplan aus der Handtasche, auf dem sie die wichtigsten Plätze für Schwarzmarktgeschäfte mit roten Kreisen versehen hatte. Es waren neben den schon erwähnten drei Orten – den Bahnhöfen Zoo und Charlottenburg sowie der Schlüterstraße – die Brunnenstraße, das Areal zwischen Reichstag und Brandenburger Tor, der Potsdamer Platz, der Alexanderplatz und die Gegend am Schlesischen Tor.
«Hier am Zoo ist noch nicht viel los», stellte Hertha Börnicke fest. «Ich schlage mal vor, wir fahren zum Brandenburger Tor.»
«Wieso ist hier noch nicht viel los?», fragte Kappe. «Es singen doch alle: Cia – cia – cio, / Schieber steh’n am Bahnhof Zoo! / Amis, Stella und Orient, / das sind die Marken, die ein jeder Schieber kennt.»
«Warum keiner hier steht?» Hertha Börnicke sah sich um. «Es wird gerade eine Razzia gegeben haben. Komm, wir fahren mit der Stadtbahn bis Lehrter Bahnhof, und dann sehen wir weiter.»
«Wenn ich das Wort Razzia höre, zucke ich immer zusammen», sagte Kappe.
Hertha Börnicke lachte. «Kein Wunder, das Wort kommt aus dem Arabischen – ghazwa heißt so viel wie Kriegszug, Raubzug, Angriffsschlacht.»
«Mann, bist du gebildet!», lästerte Kappe.
«Zumindest gebildeter als Klara», gab seine Cousine mit spitzer Zunge zurück.
Vom Lehrter Bahnhof war es nicht weit zu laufen. Am Brandenburger Tor schien sich tout Berlin versammelt zu haben.
«Hier ist es so schwarz von Menschen, dass ich endlich weiß, warum es schwarzer Markt heißt», sagte Kappe.
Hertha Börnicke hörte gar nicht richtig hin, denn ihr war etwas aufgefallen, das sie sofort auf ihrem Notizblock festhalten musste. «Guck mal, die amerikanischen Soldaten wickeln ihre Geschäfte vom Auto aus ab.»
«Besser als vom Panzer aus», sagte Kappe.
Von amerikanischen, englischen und russischen Soldaten wurde alles gekauft, was es an Uhren, Kleidungsstücken, Ringen, Juwelen, Stiefeln, Ferngläsern, Fotoapparaten, Rasiermessern, Pelzmänteln und seidener Damenwäsche in den Berliner Haushalten noch gab. Ausgehungerte Menschen brachten ihr letztes Schmuckstück und tauschten dafür Essbares ein, Brot, Butter, Wurst, Speck und Zucker. Die Nikotinsüchtigen waren auf Zigaretten aus.
«Eine Stange mit zweihundert Zigaretten kostet den GI weniger als einen Dollar», wusste Hertha Börnicke zu berichten. «Und hier auf dem schwarzen Markt kriegt er für eine einzelne Zigarette unter Umständen fünf Reichsmark. So kann er aus einem Dollar tausend Reichsmark machen. Jeder Zigarettenschieber verdient sich eine goldene Nase.»
Kappe lachte. «Es lebe die Zigarettenwährung!»
Sie fädelten sich ein in den träge dahinfließenden Menschenstrom. Es war wie bei einer großen Prozession. Alle gaben sich furchtbar gleichgültig und taten so, als ob sie Selbstgespräche führten. Kappe brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass die Leute kundtaten, was sie zu verkaufen oder zu tauschen hatten: «Brotmarken» – «Stopfnadeln» – «Eipulver» – «Schinken» – «Bohnenkaffee» – «Broschen, Ringe, Armbanduhren».
Hertha Börnicke fiel dabei ein, dass sie ja – es sollte eine Art Selbstversuch werden – einen Ring ihres verstorbenen Vaters mitgebracht hatte. Sie holte ihn aus ihrer Handtasche und steckte ihn auf den Daumen ihrer rechten Hand, denn für den Ringfinger war er viel zu groß. Dann ging sie mit etwas abgespreizter Hand weiter und sprach dabei leise, aber durchaus hörbar vor sich hin: «Weißgold mit Blautopas … Weißgold mit Blautopas …»
Kappe erinnerte sich an den eigentlichen Grund seines Hierseins: Er wollte sich nach dem ermordeten Schieber Peter Rembowski erkundigen. Aber wen sollte er fragen? Obwohl er fast vierzig Dienstjahre bei der Kripo auf dem Buckel hatte, kam er sich plump und unbeholfen vor. In der Welt des Schwarzmarkts war er nicht zu Hause.
In dieser Sekunde erblickte er seinen Sohn. Karl-Heinz stand neben einem untersetzten jungen Mann, der einem GI einen vergoldeten Sportpokal hinhielt, und spielte den Dolmetscher vom Deutschen in eine Sprache, die er für Englisch hielt. «From ze German football … Zis was for ze winner of ze Berlin Cupfinal … Some years before ze war. To ze Nazizeit, do you know?»
Der Handel kam nicht zustande, und als Karl-Heinz dem Jeep des Besatzungssoldaten hinterherblickte, erkannte er seinen Vater und seine Tante. Sehr begeistert schien er nicht zu sein. «Willste mich verhaften, und der RIAS ist dabei?»
Auch Kappe hätte diese Begegnung lieber vermieden, aber nun ließ es sich nicht ändern. «Du, ich bin immer noch bei der Mordkommission … Und du hast hoffentlich niemanden auf dem Gewissen.»
«Doch. Und das ist mein erstes Opfer.» Er zeigte auf seinen Begleiter. «Helmut Trompale. Mein Sparringspartner beim Boxen.»
«Freut mich», sagte Kappe, drückte dem jungen Mann die Hand und stellte sich und seine Begleiterin vor.
Hertha Börnicke sah Karl-Heinz mit großen Augen an. «Was, du bist jetzt beim Boxen?»
«Ja, bei Karl Schwarz in seiner Boxschule.»
«Das hat er von mir gelernt», sagte Kappe. «Ich hab doch in den letzten Jahren nichts weiter getan, als mich so durchzuboxen durchs Leben.» Die Frage, die ihm noch auf der Zunge lag, stellte er lieber nicht: wie andere Menschen reagierten, wenn Karl-Heinz in den Ring stieg und zu sehen war, dass unter seiner linken Achsel seine Blutgruppe eintätowiert war – was ihn als ehemaligen SS-Mann entlarvte. Aber vielleicht boxte er in einem langärmligen Hemd …
«Wann ist denn dein erster Kampf?», wollte Hertha Börnicke von Karl-Heinz Kappe wissen.
«Nächstes Jahr vielleicht.»
«Na, da komme ich hin!»
Kappe war schon immer ein Freund des Boxsports gewesen, aber einen Kampf seines Sohnes hätte er sich gern erspart. Klara und er hatten früher davon geträumt, dass ihr Jüngster etwas Akademisches würde, Diplom-Ingenieur, Arzt oder Staatsanwalt.
«Was macht ihr’n hier?», fragte sein Sohn.
Kappe kam direkt zur Sache. «Ich suche nach jemandem, der einen gewissen Peter Rembowski gekannt hat.»
Sein Sohn grinste. «Ah, Auftrag von meiner Atze!»
«Von wem?»
«Von meinem Bruder, von Hartmut. Der darf nicht mehr im Westsektor ermitteln, und da hat er dich gebeten … Nee, du, keene Ahnung, wer den Langen auf’m Gewissen haben könnte.»
«Du hast ihn also gekannt?»
Sein Sohn nickte. «Ja, der hat mit Tabak gehandelt, und ich hab ihm mal geholfen dabei. Nicht hier, sondern hinten am Schlesischen Tor.»
«Und – weißt du was über Rembowski, das Hartmut weiterhelfen könnte?»
«Nee …» Sein Sohn hatte jetzt den Ring an der Hand seiner Tante entdeckt. «Mensch, wenn du den verscheuern willst, dann helf ich dir dabei. Zehn Prozent!»